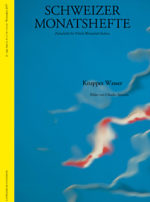Der Aufstieg der Sonderbaren
Menschen in westlichen Ländern unterscheiden sich psychologisch stark von jenen in anderen Weltgegenden. Der Grund liegt im späten Mittelalter – und hat die Weltgeschichte in eine ganz neue Richtung gelenkt.
Wer sind Sie?
Vielleicht sind Sie sonderbar, aufgewachsen in einer Gesellschaft, die westlich, gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch ist. Wenn dem so ist, sind Sie wahrscheinlich psychologisch ziemlich merkwürdig. Im Gegensatz zum Grossteil der heutigen Welt wie auch zu den meisten Menschen, die je gelebt haben, sind wir Sonderbaren höchst individualistisch, selbstverliebt, kontrollorientiert, nonkonformistisch und analytisch eingestellt. Wir konzentrieren uns mehr auf uns selbst – auf unsere Eigenschaften, Leistungen und Bestrebungen – als auf unsere Beziehungen und sozialen Rollen. Wir streben danach, in unterschiedlichen Kontexten «wir selbst» zu sein, und betrachten Inkonsistenzen im Verhalten anderer eher als Heuchelei denn als Flexibilität.
Wie alle übrigen neigen auch wir dazu, uns unseren Mitmenschen oder Autoritätspersonen anzupassen, aber wir sind dazu weniger willens, wenn das im Widerspruch zu unseren eigenen Überzeugungen, Beobachtungen und Vorlieben steht. Wir sehen uns selbst als einzigartige Wesen, nicht als Knotenpunkte in einem sozialen Netzwerk, das sich durch Raum und Zeit erstreckt. Wenn wir handeln, wollen wir die Kontrolle und das Gefühl haben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen.
Beim Nachdenken neigen sonderbare Menschen dazu, nach universellen Kategorien und Regeln zu suchen, nach denen die Welt organisiert werden kann. Ausserdem extrapolieren sie, um Muster zu verstehen und Trends zu antizipieren. Wir vereinfachen komplexe Phänomene, indem wir sie in Bestandteile zerlegen und diesen Eigenschaften oder abstrakte Kategorien zuweisen – seien es Typen von Partikeln, Pathogenen oder auch Persönlichkeiten. Oft übersehen wir dabei die Beziehungen zwischen den Teilen oder die Ähnlichkeiten zwischen Phänomenen, die nicht gut in unsere Schubladen passen: Wir wissen eine Menge über einzelne Bäume, sehen aber oft den Wald nicht mehr.
Sonderbare Leute sind auch besonders geduldig und oft sehr fleissig. Durch ihre Selbstbeherrschung können sie sich jetzt Unannehmlichkeiten und Unsicherheiten aussetzen, um dafür in Zukunft mit Geld, Vergnügungen oder Sicherheiten entschädigt zu werden. Tatsächlich haben sie manchmal sogar Freude an harter Arbeit und empfinden sie als befreiend.
Vertrauen in Fremde
«Paradoxerweise – und trotz unseres
ausgeprägten Individualismus
und unserer Selbstbezogenheit –
neigen wir sonderbaren Menschen
dazu, uns an unparteiische Regeln
oder Prinzipien zu halten;
wir können gegenüber Fremden
oder Unbekannten ausgesprochen
vertrauensvoll, ehrlich, fair
und kooperativ sein.»
Verglichen mit den meisten Bevölkerungsgruppen bevorzugen wir unsere Freunde, Familien, Mitbürger und lokalen Gemeinschaften sogar seltener. Wir halten Vetternwirtschaft für falsch und fetischisieren abstrakte Prinzipien, während wir Kontext, Praktikabilität, Beziehungen und Zweckmässigkeit vernachlässigen.
Emotional gesehen werden sonderbare Menschen oft von Schuldgefühlen geplagt, weil sie kulturell geprägten, aber weitgehend selbst auferlegten Normen und Bestrebungen nicht gerecht werden. In den meisten anderen Gesellschaften dominiert hingegen nicht die Schuld, sondern die Scham. Menschen schämen sich, wenn sie, ihre Verwandten oder selbst ihre Freunde den Standards nicht gerecht werden, die ihnen von ihren Gemeinschaften auferlegt wurden. Nichtsonderbare Menschen können zum Beispiel in den Augen anderer «ihr Gesicht verlieren», wenn ihre Tochter mit jemand Unstandesgemässem durchbrennt. In der Zwischenzeit mögen wir Sonderbaren uns schuldig fühlen, weil wir ein Nickerchen gemacht haben, statt ins Fitnessstudio zu gehen, obwohl das keine Verpflichtung darstellt und niemand je davon erfahren wird. Schuld hängt von den eigenen Massstäben und der Selbsteinschätzung ab, Scham dagegen von gesellschaftlichen Normen und dem öffentlichen Urteil.
Die Reformation und ihre Folgen
Dies sind nur einige Beispiele, die Spitze des oben erwähnten psychologischen Eisbergs, der Aspekte der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit, des Überlegens, der Motivation, der Entscheidungsfindung und des moralischen Urteils umfasst. Aber die Frage stellt sich: Wodurch wurden sonderbare Populationen psychologisch derart eigentümlich? Warum sind wir so anders?
Wenn wir dieses Rätsel bis in die Spätantike zurückverfolgen, zeigt sich, dass eine christliche Sekte für die Verbreitung eines bestimmten Bündels sozialer Normen und Überzeugungen verantwortlich war, das über Jahrhunderte hinweg Ehe, Familie, Erbe und Eigentum in Teilen Europas dramatisch veränderte. Diese grundlegende Umgestaltung des Familienlebens sorgte für eine Reihe psychologischer Veränderungen, die zu neuen Formen der Verstädterung führten und den unpersönlichen Handel anheizten, während sie gleichzeitig die Entstehung von freiwilligen Vereinigungen vorantrieb – von Kaufmannszünften und freien Städten bis hin zu Universitäten und überregionalen Mönchsorden –, die neuen und zunehmend individualistischen Normen und Gesetzen unterworfen waren. Die sonderbare Psychologie lässt auch Religion, Ehe und Familie in einem neuen und exotischen Licht erstrahlen.
Warum Europa?
Ein Verständnis davon, wie und warum einige europäische Bevölkerungen im späten Mittelalter psychologisch merkwürdig wurden, wirft auch Licht auf ein weiteres grosses Rätsel: den «Aufstieg des Westens». Warum konnten die westeuropäischen Gesellschaften ab etwa dem Jahr 1500 so weite Teile der Welt erobern? Warum brach im späten 18. Jahrhundert in derselben Region ein Wirtschaftswachstum aus, das durch neue Technologien und die industrielle Revolution vorangetrieben wurde und jene Globalisierungswellen auslöste, die noch heute über den Erdball schwappen?
«Hätten ausserirdische Anthropologen
die Menschheit um 1000 oder
sogar noch um 1200 nach Christus
vom Weltraum aus beobachtet,
wären sie nie darauf gekommen,
dass bald europäische Völker
die Welt für lange Zeit beherrschen
würden; stattdessen hätten sie
wahrscheinlich auf China oder
die islamische Welt gesetzt.»
Von ihrer hohen Warte aus wäre diesen Ausserirdischen die langsame Fermentierung einer neuen Psychologie im mittelalterlichen Europa entgangen. Diese sich entwickelnde protosonderbare Psychologie legte allmählich den Grundstein für den Aufstieg unpersönlicher Märkte, für Urbanisierung, konstitutionelle Regierungen, demokratische Politik, individualistische Religionen, wissenschaftliche Gesellschaften und unermüdliche Innovation. Kurz gesagt: Diese psychologischen Verschiebungen bereiteten der modernen Welt den Boden.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch «Die seltsamsten Menschen der Welt», das dieser Tage im Suhrkamp-Verlag erscheint. Wir danken dem Autor sowie dem Verlag für die freundliche Genehmigung der Publikation.