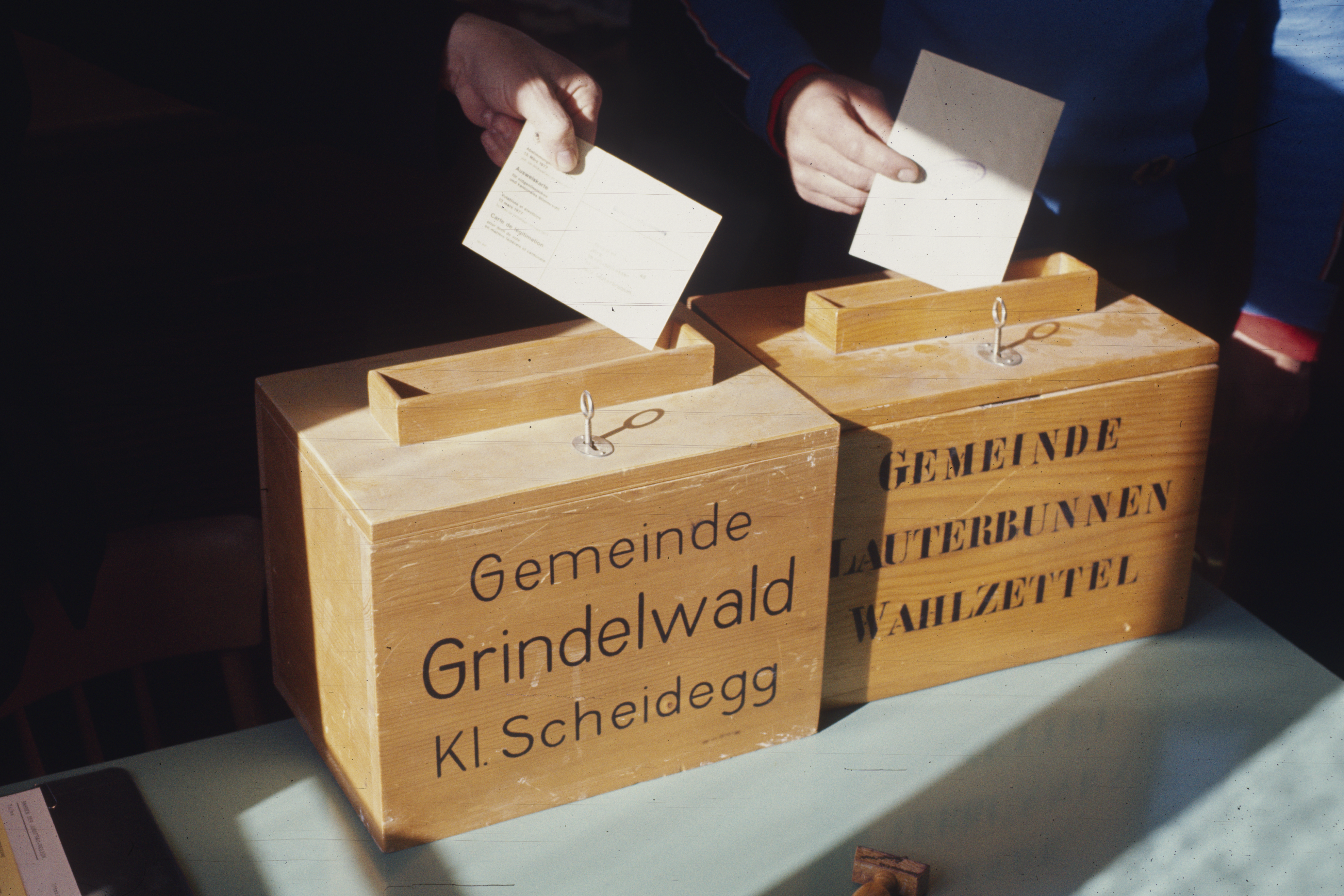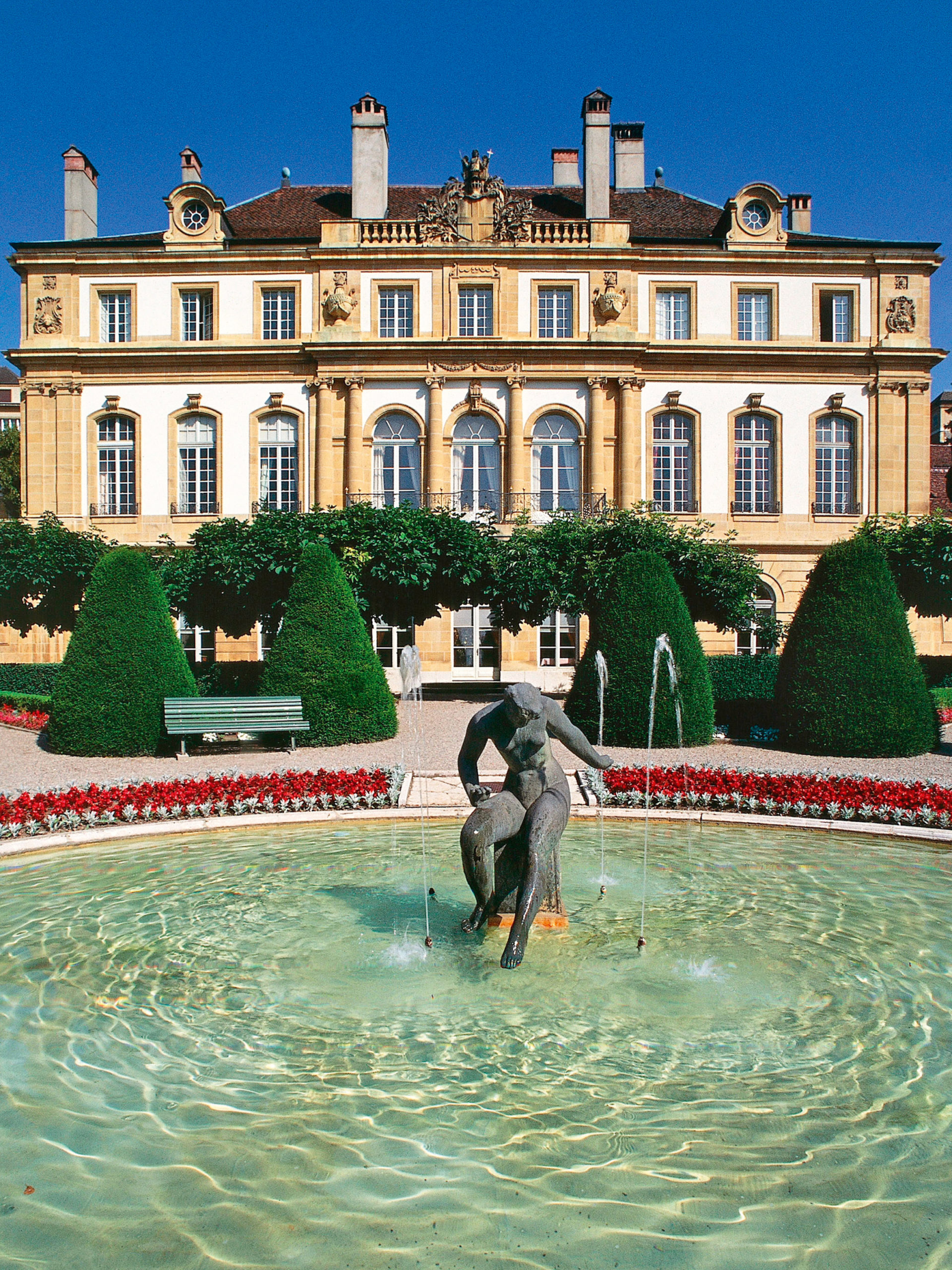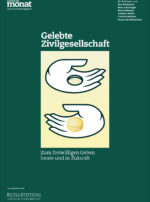Diversifikation bringt Stabilität
Die Schweiz profitiert stark von Globalisierung und Freihandel. Ein Zurückholen der Produktion lohnt sich nur, wenn sie langfristig automatisiert werden kann.
Die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine haben zwei Punkte deutlich gemacht. Erstens können die internationalen Lieferketten und die Versorgung mit wichtigen Gütern in einer Krise kurzfristig gestört werden. So fehlten zu Beginn der Pandemie gewisse Produkte wie Masken. Zudem sorgten die behördlich verordneten Betriebsschliessungen in vielen Ländern dafür, dass die Produktion auch in der Schweiz reduziert werden musste, weil Rohmaterialien und Halbfabrikate nicht rechtzeitig geliefert wurden. Die Problematik akzentuierte sich, weil auch die Transportkapazitäten betroffen waren, insbesondere in China. Noch bevor sich die Lage nach der Pandemie wieder beruhigen konnte, verschärfte der Ukraine-Krieg die Versorgungsprobleme.
Zweitens haben sehr viele Unternehmen in den stürmischen Zeiten eine beeindruckende Flexibilität gezeigt. Es wurde entschieden und umgehend nach Lösungen gesucht, um den grossen Herausforderungen zu begegnen. Die Pandemie eröffnete sogar Chancen. Sie hat sonst kaum zu realisierende Veränderungsprozesse und Innovationen ermöglicht.1
Kurz zusammengefasst: Die Krise hat gleichzeitig die Vulnerabilität und die Flexibilität der international vernetzten Wirtschaft gezeigt. Die Frage ist nun: Wie reagieren die Unternehmen und die Staaten auf die jüngsten Ereignisse? Stehen wir am Ende des Zeitalters der Globalisierung und fallen wir zurück in eine Art Merkantilismus, wo Exporte gut sind, aber Importe verteufelt werden? Und wie soll die Schweiz reagieren?
Unternehmen erhöhen Lagerbestände
Seit Ausbruch der Pandemie hat Economiesuisse in regelmässigen Abständen die Schweizer Unternehmen befragt, wie stark sie betroffen sind und wie sie auf die Probleme reagieren. Ende 2021 gaben rund 80 Prozent der Unternehmen an, dass sie Schwierigkeiten beim Bezug von Vorprodukten hätten. Dieser Wert war noch höher als während des ersten Lockdowns 2020, als gut die Hälfte der Unternehmen mit Lieferproblemen zu kämpfen hatte.
Wie reagieren die Unternehmen auf die Lieferengpässe? Die Antworten hierzu waren über die Befragungszeitpunkte hinweg bemerkenswert stabil. Nicht unerwartet erhöhen viele die Lagerbestände, um Lieferengpässe länger überbrücken zu können. Die zweitwichtigste Reaktion besteht darin, neue Lieferanten im Ausland zu suchen. In-Shoring (also Vorleistungen wieder selber herstellen) oder Near-Shoring (die Produktion nach Europa zu holen) sind als Lösungswege interessanterweise deutlich weniger verbreitet. Nur jedes zehnte Unternehmen überlegt sich, die Vorleistungen neu in Europa zu beschaffen. Ein In-Shoring wird von gerade mal 6 Prozent der Unternehmen geprüft.
Wieso sehen Unternehmen ein In- oder Near-Shoring nicht auf breiter Front vor? In vielen Fällen ist es äusserst schwierig und mit viel zu grossen Kosten verbunden, die Produktion zurück in die Schweiz (oder nach Europa) zu holen. Einerseits gibt es in Asien und insbesondere in China zahlreiche hochspezialisierte Industriecluster. Nicht nur in der Produktion von elektronischen Komponenten, auch bei Schuhen, Textilien, medizinischem Verbrauchsmaterial oder Komponenten für die Maschinen- oder Automobilindustrie liegen grosse Teile der Wertschöpfungskette in China. Wenn nun die Produktion etwa von Schuhen nach Vietnam oder sogar in die Schweiz geholt würde, dann müssten weiterhin Vorprodukte aus China bezogen werden. In anderen Worten: Die Versorgungssicherheit bei einem Unterbruch von Lieferketten würde nicht wirklich verbessert. Man verlagert das Problem lediglich um ein, zwei Glieder entlang der Lieferkette. Andererseits ist die Integration der Herstellungsprozesse für Vorprodukte in das eigene Unternehmen auch deswegen wenig beliebt bei Schweizer Unternehmen, weil es oft am nötigen Know-how fehlt, das erst teuer aufgebaut werden müsste.
Wir müssen nicht alles selber machen
Das Zurückholen der Produktion in die Schweiz kann betriebswirtschaftlich nur dann eine Strategie sein, wenn langfristig ein hohes Mass an Automatisierung möglich ist. Die tiefen Kapitalkosten in der Schweiz erlauben eine kapitalintensive Produktion. Hingegen muss die Personalintensität tief sein, weil die Lohnkosten hierzulande sehr hoch sind. Folglich eröffnet die Digitalisierung durchaus Opportunitäten, eine ehemals personalintensive Produktion durch Automatisierung wieder in die Schweiz (oder nach Europa) zu holen.
Klar ist: Wirtschaft und Bevölkerung wollen mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgt sein. Aber Achtung, Versorgungssicherheit ist nicht mit Selbstversorgung zu verwechseln.2
Die Schweiz kann (und soll) nicht alle Güter und Dienstleistungen selbst herstellen. Als Hochlohnland konzentrieren wir uns richtigerweise auf wertschöpfungsintensive Tätigkeiten. Produkte und Vorprodukte, die viel Arbeitseinsatz erfordern, könnten wir in der Schweiz ohnehin nicht alle herstellen, weil wir dafür nicht genügend Arbeitskräfte hätten. Auch eine weitgehende Rückverlagerung der Produktion in die Schweiz ist illusorisch: Schweizer Unternehmen beschäftigen im Ausland über zwei Millionen Mitarbeitende. Zudem sind wir bei Nahrungsmitteln, Energieträgern und Rohstoffen zwingend auf den Import angewiesen.
«Nur jedes zehnte
Unternehmen überlegt sich,
die Vorleistungen neu
in Europa zu beschaffen.»
Versorgungssicherheit bedeutet also, dass wichtige Güter und Dienstleistungen in der Schweiz verfügbar sind, nicht dass wir diese alle selbst herstellen. Versorgungssicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn die Schweiz weiterhin in den globalen Handel integriert ist. Freihandelsabkommen, die bilateralen Verträge mit der EU oder die multilateralen Handelsregeln im Rahmen der WTO sind entscheidende Bausteine dafür, dass der beidseitige Handel auch in Krisenzeiten aufrechterhalten wird.
Sollte es in Krisenzeiten zu Versorgungsengpässen kommen, helfen die Pflichtlager zur Überbrückung, so dass die Versorgung für einige Monate sichergestellt werden kann. Eine höhere Inlandproduktion ist nicht zielführend. Denn auch die Landwirtschaft benötigt Diesel, Dünger und Saatgut, das meist aus dem Ausland stammt, um in der Schweiz Agrarprodukte herzustellen.
Mängel bei Gasspeicherung
Die Versorgung funktionierte während der Pandemie mit wenigen Ausnahmen gut. Doch nun legt der Ukraine-Krieg deutliche Schwächen bei der Landesversorgung offen: Die Energieversorgung ist gefährdet. Zwar existieren auch hier Pflichtlager. Bei Erdöl etwa sollte die Versorgung für ein paar Monate gewährleistet werden. Bei Erdgas aber verfügt die Schweiz über keine Speichermöglichkeiten. Immerhin ist die Westschweizer Regionalgesellschaft Gaznat an einem französischen Gasspeicher in der Nähe von Lyon beteiligt, der für einige Tage den Konsum abdeckt.
Auch bei Erdgas sind zwar Pflichtlager vorgesehen. Mangels Speichermöglichkeiten in der Schweiz erfolgt die Pflichtlagerhaltung stattdessen in Form von Heizöl. Im Krisenfall könnten indes nur rund 30 Prozent der Anlagen, welche in der Industrie mit Gas betrieben werden, auf Öl umstellen. Wie das Gas für die restlichen Anlagen im Krisenfall beschafft werden könnte, ist unsicher. Immerhin bezieht die Schweiz rund die Hälfte des Gases aus Russland.
Würde es im kommenden Winter zu einem Lieferstopp oder einem Boykott von russischem Gas kommen, könnte sogar die Stromversorgung beeinträchtigt werden. In der EU trägt Erdgas 20 Prozent zur Stromversorgung bei. In einem kalten Winter könnte es knapp werden, mit grossen Konsequenzen für die Schweiz, welche im Winter auf den Import von Strom angewiesen ist.
Doch auch hier darf man die Flexibilität der Menschen nicht unterschätzen: Es wird zu Umstellungen kommen. Haushalte, Unternehmen und Stromproduzenten werden sich anpassen – auch wenn es im Fall von Erdgas etwas mehr Zeit brauchen wird. Auch bei der Energieversorgung gilt: Je breiter die geografische Diversifikation bei den Lieferländern, desto sicherer.
Selbstversorgung ist illusorisch
Die Versorgungsengpässe und der Ukraine-Krieg schreckten die Politik auf und befeuern die Diskussion um die Versorgungssicherheit im In- und Ausland. Schnell wurde klar, dass im Krisenfall protektionistische Massnahmen noch leichter ergriffen werden als sonst. Schon seit einigen Jahren wird von vielen Staaten die zunehmende Abhängigkeit von China als problematisch angesehen. Nun rückt die Abhängigkeit von Russland bei den Ressourcen in den Fokus. Verschiedene Länder ködern mit riesigen Subventionen Unternehmen, die Produktion von Computerchips, Autos oder sonstigen Gütern aufzubauen. Industriepolitik ist wieder en vogue. Bedeutet dies ein Ende der Globalisierung?
Eine vollständige Abkehr von der internationalen Arbeitsteilung ist keine Option. Zu sehr hängen die Volkswirtschaften voneinander ab. Die Entwicklung der Weltwirtschaft kann nur erfolgreich sein, wenn die internationale Arbeitsteilung weiterhin funktioniert. Dies gilt im hohen Masse auch für die Schweiz: Die Lieferketten basieren auf ausländischen Rohstoffen und Vorprodukten. Eine Selbstversorgung ist nicht nur illusorisch, sondern sie würde die Schweiz, die von den Vorzügen der Globalisierung besonders profitiert, weit zurückwerfen. Eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa oder in die Schweiz kann im Einzelfall zweckmässig sein, ist aber keine erfolgreiche generelle Strategie.
Die Unternehmen verfügen über eine hohe Flexibilität in einer Krise und tragen damit wesentlich zur Systemstabilität bei. Sie benötigen dazu vor allem unternehmerische Freiheit und keine staatlichen Interventionen.
Die Schweiz muss zwingend auf Heimatschutz und Protektionismus verzichten. Ein staatlich forcierter Aufbau von Produktionskapazitäten in der Schweiz wäre falsch und kontraproduktiv. Stattdessen muss die Schweiz die Wirtschaftsbeziehungen zu möglichst vielen Ländern stärken. Insbesondere die bilateralen Beziehungen zur EU sind von grosser Bedeutung für die Versorgungssicherheit der Schweiz.
«Versorgungssicherheit kann
nur gewährleistet werden,
wenn die Schweiz weiterhin in
den globalen Handel integriert ist.»
Bei Strom sind verlässliche vertragliche Beziehungen zur EU oder einzelnen Ländern voranzutreiben. Bei Gas sind Speichermöglichkeiten im Inland zu schaffen oder vertraglich Bezugsrechte im Ausland zu sichern.
Die Schweiz ist eine Globalisierungsgewinnerin. Sie muss sich auf der Weltbühne entschieden gegen Protektionismus einsetzen. Nur wenn es gelingt, an den Meriten der internationalen Arbeitsteilung festzuhalten, lässt sich der Wohlstand in der Schweiz sichern.
Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Versorgungsprobleme – gerade hinsichtlich der Energieproduktion – ans Ausland delegieren können. Die Schweiz hat sich verpflichtet, bis ins Jahr 2050 CO2-neutral zu sein, und Dekarbonisierung ist auch immer Elektrifizierung. Mehr als die Hälfte unserer Stromproduktion für das Jahr 2050 ist heute noch nicht gebaut. Wir werden wohl fast 40 Prozent mehr Strom benötigen, vor allem aufgrund der zunehmenden Elektromobilität und des Ersatzes von fossilen Heizungen durch Wärmepumpen.
Die EU steht vor ähnlichen Herausforderungen. Es ist alles andere als sicher, dass die Schweiz künftig grosse Mengen an Strom aus der EU importieren kann. Es braucht deshalb einen Zubau von elektrischer, klimaneutraler Energie – auch in der Schweiz. Dies ist nicht mit Selbstversorgung gleichzusetzen, sondern ist Voraussetzung für die Teilnahme am europäischen Stromnetz, wo Import und Export zur Tagesordnung gehören. Die Schweiz hat ihre längst auf dem Tisch liegenden, aber dennoch nicht erledigten Hausaufgaben nun entschieden an die Hand zu nehmen.
Siehe dazu bei Economiesuisse: «Die Pandemie als Chance: ein Katalysator für Innovation in Unternehmen», http://www.economiesuisse.ch/de/dossier-politik/die-pandemie-als-chance-ein-katalysator-fuer-innovation-unternehmen ↩
Siehe dazu auch bei Economiesuisse: «Güterversorgung in der Krise: Analyse und Lehren für die Schweiz». ↩