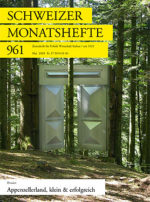Widerstandskünstler Israel
Israel steht unter Beschuss. Seit seiner Gründung 1948 wurde es immer wieder überfallen und in Kriege verwickelt. Auch die Schweiz kann von seinen Erfolgen und Herausforderungen lernen.
Read the English version here.
«Wir befinden uns im Krieg, ich bin einberufen worden, daher die Verspätung.» Mit diesen Worten entschuldigte sich Dmitry Adamsky, der an der Universität von Haifa lehrt, für die verzögerte Abgabe dieses Artikels bei der Redaktion nach dem jüngsten Angriff der Hamas auf Israel. Begleitend dazu schrieb er: «Dieser Artikel wurde unter Beschuss eingereicht. Die darin enthaltenen Argumente sind nach wie vor gültig und gelten sowohl für die Kriegs- als auch für die Nachkriegsrealität.»
Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Israel mehr als jedes andere Land in Kriege verwickelt und ringt seit fünfundsiebzig Jahren mit dieser Problematik. Langwierige Konflikte mit seinen Nachbarn hätten das Land in einen Garnisonsstaat verwandeln können. Israel ist jedoch nicht Sparta, sondern eine wehrhafte Demokratie mit einer lebendigen Gesellschaft, einer wachsenden Wirtschaft und einem innovativen Ökosystem aus Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie. Wie hat es Israel geschafft, gleichzeitig eine bewaffnete Nation und eine Nation der Start-ups zu sein? Welche Denkanstösse kann es europäischen und schweizerischen Staatsmännern und Intellektuellen geben?
Die enorme geopolitische Widerstandsfähigkeit des kleinen Israel hat die Neugierde kleiner Mächte geweckt, die in globale wirtschaftliche, politische und sicherheitspolitische Konstellationen eingebunden sind. Eine enge Definition von Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, einen Angriff auf kritische nationale Infrastrukturen (soziale, zivile und militärische) zu absorbieren, sich zu erholen und Vergeltung zu üben. Eine breitere Auslegung bezieht sich auf einen Mechanismus, durch den der Staat eine effektive Militärmaschinerie bleibt, ohne sozioökonomischen Wohlstand und Liberalismus zu gefährden.
Seit 1948 ist Israel in beidem erfolgreich gewesen. Es hat sechs grosse Kriege und Dutzende von Zusammenstössen geringerer Intensität überstanden, gibt weniger als 5 Prozent des BIP für die Verteidigung aus und bewahrt ein vernünftiges Mass an Demokratie, Lebensqualität und Wirtschaftswachstum. Das ist rätselhaft: Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) sind zu klein für die Bedrohungen und zu gross für den Staat, aber Israel hat sich trotz aller Widrigkeiten, trotz der Unterlegenheit gegenüber den Feinden in bezug auf Landmasse, natürliche und menschliche Ressourcen wacker geschlagen. Drei Faktoren erklären dieses Rätsel: ein ausgeklügeltes, aber sauberes nationales Sicherheitskonzept, ein ganzheitlicher Ansatz für eine umfassend grosse Strategie und eine einzigartige Verwaltungskultur.
Israels strategisches Konzept
Israels nationales Sicherheitskonzept beruht auf dem sogenannten «heiligen Dreieck» – Abschreckung, nachrichtendienstliche Warnung und Entscheidung auf dem Schlachtfeld. Die Gründerväter Israels gingen davon aus, dass begrenzte Ressourcen das Land immer daran hindern würden, in Konflikten einen endgültigen militärischen Sieg zu erringen. Während seine Feinde es sich leisten konnten, Kriege zu verlieren, würde eine grosse Niederlage Israels die Vernichtung des Landes bedeuten. Abschreckung – die erste Säule der nationalen Sicherheit – sollte die Feinde davon abhalten, einen Krieg zu beginnen. Bricht diese Säule zusammen, wird von den Geheimdiensten erwartet, dass sie vor einem drohenden Angriff Alarm schlagen. Eine genaue Frühwarnung vor einem feindlichen Angriff verschafft theoretisch die nötige Zeit, um Reservisten einzusetzen, Präventivschläge durchzuführen und den Vormarsch des Feindes zu blockieren. Und selbst wenn beide Säulen zusammenbrechen (wie 1973 und 2023), wird von den IDF immer noch ein entscheidender Sieg erwartet. Auch wenn es sich nicht um einen endgültigen strategischen K. o. handelt, zielt der Sieg auf dem Schlachtfeld darauf ab, brennende operative Herausforderungen zu lösen.
Der Mangel an geografischer Tiefe, die Abneigung gegen Verluste, die sozioökonomische Sensibilität und ein enges politisches Zeitfenster führten zu einem Reflex der Vorbeugung und des Blitzkriegs, um die Kriegsführung in das feindliche Gebiet zu verlegen. Der Kult der taktischen Offensive als defensive Strategie wurde zur doktrinären Norm. Qualitativer Vorsprung – d.h. die Überlegenheit bei hochentwickelten Waffen und die Fähigkeit, mit ihnen professioneller umzugehen als der Feind – wurde zu einem Mittel, um die numerische Unterlegenheit auszugleichen. Über die Technologie hinaus bezog sich der qualitative Vorsprung auf hohe persönliche und erzieherische Qualitäten der Wehrpflichtigen, auf Motivation, Zusammenhalt der Einheiten und ein kreatives operatives Strategem. Diese Stärken, unterstützt durch hochmoderne, lokal produzierte oder importierte Waffen, waren das Herzstück der Siegestheorie der IDF.
Ganzheitliche Auffassung von nationaler Sicherheit
Wie hat diese effektive Militärmaschinerie eine wachsende Wirtschaft, eine stabile Demokratie und den sozialen Zusammenhalt aufrechterhalten? Der Erfolg der Start-up-Nation ist einem ganzheitlichen Konzept der nationalen Sicherheit zu verdanken. Die Gründerväter Israels hatten ein umfassendes Sicherheitskonzept, das militärische Überlegungen mit sozialen Zielen und wirtschaftlichen Visionen verband.
Der Kern dieses Ansatzes ist ein sorgfältig gepflegtes wissenschaftlich-technologisches, privat-öffentliches Ökosystem. Öffentliches Bildungswesen, Militär, Rüstungsindustrie, private und öffentliche Arbeitsmärkte und Wirtschaft sind in Israel organisch miteinander verbunden. Gymnasien bereiten Kohorten junger Männer und Frauen auf den Militärdienst vor. Nach Beendigung des Pflichtdienstes liefern die IDF diese erstklassigen jungen, aber erfahrenen Experten, Veteranen der IT-Eliteeinheiten, an die israelische High-Tech-Industrie. Dieser Zustrom von Humankapital, das regelmässig auf den Arbeitsmarkt kommt, kurbelt die Wirtschaft an. Sie dienen auch dem Verteidigungssektor, indem sie bis zum Alter von vierzig Jahren als Reservisten dienen.
Der Staat ist bestrebt, das Humankapital zu erhalten, zu rotieren und zu verbreiten. Die Kultivierung von Qualität beginnt bereits vor der Einberufung. Die patriotische Erziehung, die der israelischen Schulbildung innewohnt, schafft ein Reservoir an motivierten Wehrpflichtigen. Die IDF wählen sorgfältig die besten und klügsten Schüler aus und bilden sie in speziellen MINT-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Vorbereitungsprogrammen aus, die in der Regel in Zusammenarbeit mit den Universitäten durchgeführt werden. Die Absolventen dieser prestigeträchtigen Programme werden zu einem wichtigen Bestandteil der militärischen Aristokratie, wenn sie sich für einen Verbleib in den IDF und der Verteidigungsindustrie entscheiden. Wenn sie keine Karriere im Verteidigungsbereich anstreben, durchdringen sie nach ihrer Demobilisierung und nach dem Erwerb zusätzlicher Abschlüsse die wichtigsten Sektoren der israelischen Wirtschaft und werden oft zur Avantgarde der IT-Industrie, der Geschäfts-, Finanz-, Rechts- und Führungselite. Andere begabte und motivierte Jugendliche, die diesen Weg nicht einschlagen, landen dennoch bei den IDF. Die Fähigkeiten und Netzwerke, die sie beim Militär erwerben, sind von unschätzbarem Wert. Die meisten israelischen Einhörner, ganz zu schweigen von der Start-up-Industrie, basieren auf sozialen Verbindungen, die innerhalb von Militäreinheiten geknüpft wurden.
Für die IDF ist es eine Herausforderung, die Qualität der Soldaten über den Pflichtdienst hinaus zu erhalten. Um das Humankapital zu behalten, hat das Verteidigungsministerium in den letzten zehn Jahren attraktive Karrierewege «von der Anstellung bis zur Pensionierung» entwickelt. Bewährt haben sich eine mehrjährige Auszeit für die Ausbildung oder Arbeit in der Privatwirtschaft sowie wettbewerbsfähige Gehälter.
Schliesslich haben die IDF auch eine soziale Funktion. Die Gründerväter sahen das Militär als einen sozialen Schmelztiegel. In Israel geborene Wehrpflichtige und Neueinwanderer gemeinsam zu mobilisieren, um gemeinsam zu dienen, ermöglicht eine reibungslosere gegenseitige Annäherung, nationalen Zusammenhalt und eine gemeinsame Mentalität. Seit Jahrzehnten sitzen die Kinder von Milliardären in denselben Panzern und Schützengräben wie die Kinder aus der israelischen Peripherie und teilen sich mit ihnen die Computerschreibtische. Die IDF sind für Einwanderer und Wehrpflichtige aus weniger privilegierten Verhältnissen ein Instrument der sozialen Mobilität und Integration. Das Ergebnis dieses ganzheitlichen Ansatzes sind individueller Wohlstand und ein kollektives Gefühl der Zugehörigkeit.
Einzigartige Verwaltungskultur
Resilienz hängt auch von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und der Fähigkeit zum organisatorischen Lernen ab. Der Erfolg Israels bei der Bewältigung von Ungewissheit und Instabilität ist auf kulturelle Eigenschaften wie Pragmatismus, Praxisnähe, Durchsetzungsvermögen und Improvisationstalent zurückzuführen. Die Synthese dieser Eigenschaften ist eine einzigartige Verwaltungskultur in militärischen, öffentlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Die strategische Kultur Israels feiert Menschen mit einer «Ich kann das!»-Einstellung, die – im Gegensatz zur historischen Opfermentalität der Diaspora – vorwärtsdrängen, das Unmögliche versuchen und allen Widrigkeiten zum Trotz handeln. Dynamik und Improvisation gehören zur DNA israelischer Fachleute.
Die sozialen Normen Israels führen zu einem offenen, informellen, egalitären und hierarchiearmen Verhalten. Israelis sehen sich selbst als lässig in bezug auf Regeln und Vorschriften, nehmen diese oft als Empfehlungen oder als Einladung zu Verhandlungen. Die israelische Führungskultur legt mehr Wert auf spontane Problemlösungen als auf die Einhaltung von Vorschriften und fördert ein Klima, das Innovationen von unten nach oben ermöglicht. Die Israelis setzen Improvisation mit Kreativität gleich und präsentieren diese Fähigkeit stolz als nationales Markenzeichen für Spitzenleistungen. Die Fähigkeit zur Improvisation ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ausbildung und Beförderung, auch wenn ihre Kehrseite Ungeduld, Amateurhaftigkeit, Abenteurertum und eine Abneigung gegen langfristige Planung sind.
Der israelische Führungsstil legt Wert darauf, dass man die Initiative ergreift, persönliches Urteilsvermögen an den Tag legt und den gesunden Menschenverstand einsetzt. Er sieht es als üblich an, Vorgesetzte in Frage zu stellen, und sieht beide Fähigkeiten als der Nation zuträglich an. Die Atmosphäre des «disziplinierten Ungehorsams» ermutigt die Untergebenen, gängige Weisheiten zu hinterfragen, Änderungen vorzuschlagen und unorthodoxe Lösungen zu finden. Untergebene, die ihre Vorgesetzten nicht in Frage stellen, könnten als «Ja-Sager» wahrgenommen werden, denen es an Fantasie, Initiative und Selbstvertrauen fehlt. Toleranz gegenüber einigermassen mutigen Untergebenen ist die Essenz des israelischen Führungsstils, eine Quelle der Widerstandsfähigkeit und der Ermöglichung von Anpassungen in Kriegszeiten sowie von Innovationen in Friedenszeiten in allen Tätigkeitsbereichen des öffentlichen und privaten Sektors.
Bekannte Unbekannte und der Weg nach vorn
Das israelische Innovationsökosystem ist ein zweischneidiges Schwert. Aufgrund des hohen Grades an sozialer Verflechtung werden grundlegende nationale Probleme auf den Verteidigungsapparat zurückgeworfen. Reservisten und Wehrpflichtige sind Bürger; sie bringen ihre sozialen Probleme in die IDF ein. Letztere sind ein Mikrokosmos der israelischen Gesellschaft, und die Widerstandsfähigkeit (oder der Mangel daran) der einen spiegelt die der anderen wider. In den letzten Jahrzehnten und insbesondere in diesem letzten Jahr haben soziale Unruhen und politische Instabilität den Schmelztiegel in einen Spannungsherd verwandelt.
Vor dem geheimdienstlichen Patzer und dem Überraschungsangriff der Hamas von Anfang Oktober 2023 stand Israel vor einer der grössten Sozial- und Identitätskrisen seiner Geschichte. Die Bewältigung dieser Spannungen ist eine grosse Herausforderung für Politiker und das Verteidigungsministerium. Es wird sich zeigen, ob und wie sich dies auf das Kriegsverhalten der IDF auswirken wird und ob und wie die israelischen Entscheidungsträger und die Gesellschaft den drohenden Verfall dieser «Start-up-Nation» zu einer «Shutdown-Nation» verhindern werden.
«Vor dem geheimdienstlichen Patzer und dem Überraschungsangriff der Hamas von Anfang Oktober 2023 stand Israel vor einer der grössten
Sozial- und Identitätskrisen seiner Geschichte.»
Israels Erfahrungen sind nicht unbedingt auf andere Länder übertragbar. Sie regen jedoch die Fantasie an und führen dazu, dass die richtigen Fragen über die Widerstandsfähigkeit kleiner Regionalmächte gestellt werden. Der Fall Israel legt nahe, dass eine kohärente nationale Identität und soziale Solidarität notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen für die Widerstandsfähigkeit nationaler Sicherheit und ein stabiles Innovationsökosystem sind.