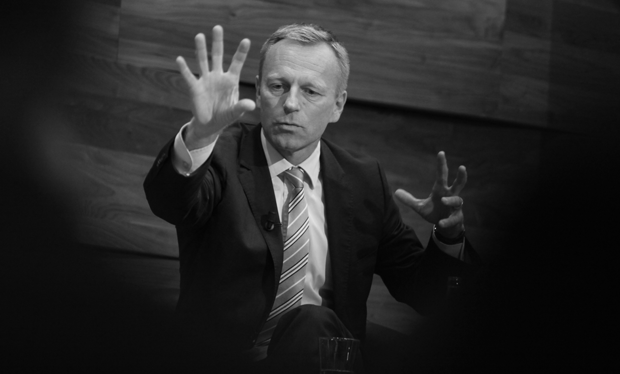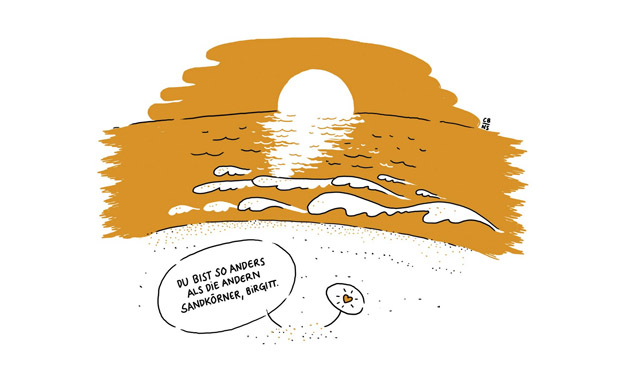Was Vermögen vermöchte
Hat die Allgemeinheit Anspruch auf den Reichtum der wenigen? Natürlich nicht. Haben die Reichen den Anspruch, ihr Geld in die Allgemeinheit zu investieren? Theoretisch ja, doch ist im Zeitalter des Etatismus zur Rarität verkommen, was einst gängige Praxis war.
Wozu dient Reichtum? Diese Frage ist nicht nur eine nach der tatsächlichen Motivlage, sondern eine klassisch politische: Jemand hat es in einer Gesellschaft zu Reichtum gebracht. Wie stellt er sich nun zu ihr? Gibt er ihr etwas davon? In welcher Form? Wie viel? Braucht er sich überhaupt zu rechtfertigen? Im Verlauf der Geschichte haben sich von der antiken Liturgie bis zur modernen Stiftung verschiedene Muster zur Legitimierung von Reichtum herausgebildet und über die Zeit verändert – sie werden in der Folge durchlaufen und immer wieder auf die eine zentrale Frage hingeführt: Wozu reich?
1. Legitimation durch Stiftung öffentlicher Güter
Sagenhaft reich soll Xerxes gewesen sein. Und auch Krösus, ebenso wie Midas. Die orientalische Despotie zeigt seither und bis hin zu Gadhafi oder Abdullah al Saud ein grundlegendes Muster des Reichtums: Aneignung durch Herrschaft. Reichtum durch Zwangsabgaben, Steuern, Enteignung und Krieg. Darin wird ein gewaltsames Grundmuster des Reichtums erkennbar.
Die antike griechische Polis war das einzige Gegenmodell zur orientalischen Despotie: als Verfassungsmodell der Politik, inklusive Demokratie. Verfassungsstaaten lassen keinen Herrscher zu, der ihre Untertanen offen ausbeutet bzw. ihre Gewinne willkürlich abschöpft. Die Bürger verbannen ihn irgendwann oder wechseln die Verfassungsform. Athen, als Musterpolis, kannte keine Steuern; nur die Metöken, die Gastbürger, hatten welche zu entrichten. Die öffentlichen Güter (Tempel, Amtsgebäude, Wehranlagen, Strassen) wurden als sogenannte leiturgia von den Reichen finanziert. Reichtum war legitim, wenn die Reichen ihre Polis beschenkten. Freigebigkeit zählte bei Aristoteles zu den grossen Tugenden. Und die Polis ehrte im Gegenzug ihre Stifter.
Damit wird historisch das erste legitime Grundmuster des Reichtums erkennbar: seine Legitimation durch Stiftung öffentlicher Güter. Im Gegensatz zum orientalischen Despoten mit seinem absoluten Reichtum war der reiche Polisbürger auf die Legitimation seiner Mitbürger angewiesen. Denn die Bürger waren im Wohlstand differenziert, aber politisch gleich. Die Polis achtete auf relative Homogenität. Wenn die reichen Bürger die öffentlichen Güter finanzierten, stärkten sie den Glanz der Polis und die Bürgergemeinschaft.
Das Grundmuster der Legitimation von Reichtum durch die Stiftung öffentlicher Güter – das Leiturgia-System – ist eine in den Poliskontext verschobene Gabenökonomie. Der Poliskontext änderte die auf den Clan bezogene Reziprozitätsstruktur des Gabensystems. Stammesgesellschaften pflegen über Geschenke und Gegengeschenke das Netz der familialen und Zwischenstammesbeziehungen. Die vorpolitische Gemeinschaftlichkeit versichert sich so immer wieder ihrer selbst.
Die Erfindung der Polis beruhte auf der Entmachtung der alten Clanstrukturen. Der Stadtstaat ist keine Stammesgemeinschaft, sondern, als Ausnahme in der Antike, eine Gemeinschaft freier Bürger in Selbstherrschaft. Strukturell betrachtet waren die Stadtstaaten, im Unterschied zur alten Form der Stammesgemeinschaft, eine Gesellschaft von Fremden. Doch auch in ihnen wirkte das Prinzip von Gabe und Gegengabe – nur in anderer Form.
Die spezifische Rolle der Gabenspender für die Gemeinschaft fällt den Reichen zu. Es ist eine moderne Form der Gabenökonomie, die nicht mehr auf personaler Reziprozität beruht, sondern auf einer Reziprozität der Reichen mit der Polis-Öffentlichkeit. Das Moment des Gebens bleibt, aber die Gabe nimmt eine Gemeinschaftsform an, wobei die Gegengabe in der Ehrung des Spenders besteht.
In dieser politischen Ökonomie wächst der Reichtum der Polis mit dem Reichtum ihrer Bürger, unter der Bedingung, dass mit dem Vermögensanstieg proportional die Zahl und das Quantum der Leiturgien ansteigen. Reichtum ist in diesem Reziprozitätsmuster eine legitime und erwünschte Kompetenz. Die pleonexie – das Streben nach dem Mehrhaben – ist nicht verwerflich, wenn sie der Polis zugute kommt.
2. Legitimation durch Caritas
Das zweite legitime Reichtumsmuster findet sich in der Konzeption der Caritas, definiert von Thomas von Aquin: Das, was einer braucht (necessitas), kommt ihm zu. Alles, was an Einkommen und Vermögen darüber hinausweist (superfluum), ist den Armen zu geben.
Auch hier liegt ein Reziprozitätsmuster zugrunde, nun aber nicht mehr polisgemeinschaftlich ausgerichtet, sondern gnadenstrategisch. Die Reichen geben, um in den Himmel zu kommen. Die Barmherzigkeit den Armen gegenüber ist theologisch vermittelt, über Gott und seine Kirche. Nicht mehr die anderen Bürger sind Adressaten der Spende, sondern die Armen. Das Polismodell wird aufgegeben und durch ein ständisches Modell ersetzt, das die Arm-Reich-Differenz festigt.
Allerdings werden auch hier öffentliche Güter gespendet, vorgegeben durch die christliche Gesellschaft: Armenhäuser, Armenspeisungen, Hospitäler, Kirchen, Kapellen. In Gesellschaften, in denen die Wohlfahrt der Seele ebenso bedeutsam ist wie die des Körpers, sind Kirchen als Seelenläuterungsinstanzen notwendige öffentliche Güter. Die Resultate der Caritas gleichen denen der antiken Leiturgia; erhebliche Unterschiede sind jedoch im Motiv zu finden: Das Gemeinschaftliche wird durch die hier neu einfliessende Umverteilungskomponente zum Sozialen.
Die Ehre, die dem antiken Reichen durch die Polis zuteil wurde, bekommt der christliche Reiche durch die Gnade Gottes, die nur in Demut angenommen werden kann. Die Spende ist nicht auf eine Tugend rückführbar, sondern auf Demut und Bussfertigkeit. Die Gegengabe wird nicht in dieser Welt gewährt, auch wenn die Gabe für diese Welt war. Das christliche Geben gehört zu einer transformierten Gabenökonomie: Sie stützt die Gemeinschaft der Brüder in Christo, aber die Gemeinschaft selber kann nicht zurückgeben. Sie ist, eschatologisch verwandelt, eine Gabenökonomie, die die Brücke zwischen der Gemeinschaft der Christen in der Welt und jener der erlösten Seelen im Himmel herstellt – ein Teil der oeconomia divina.
Eindeutig aber wird auch hier Reichtum legitimiert, wenn ein Gutteil davon, das superfluum, gespendet wird. Das bedeutet, dass der, welcher gibt, nichts von der Welt, von der Gesellschaft, erwartet. Weltlich betrachtet schenkt der Reiche bedingungslos: altruistisch. Darin liegt ein gewichtiger Unterschied zum ersten, antiken Legitimitätsmuster: im Verzicht – prima facie – auf die Ehrung des Spenders. Nur äusserst indirekt erfolgt die soziale Ehrung dennoch: diejenigen, welche Stiftungen einrichten, verbinden sie mit ihrem Namen und bauen sich dadurch trotz allem ein Denkmal. Das müssen sie jedoch selber tun; die Gesellschaft anerkennt dies nur stillschweigend.
3. Legitimation durch Wohlstandsmehrung
Das dritte Legitimationsmuster des Reichtums finden wir im 18. Jahrhundert bei Adam Smith (und vielen anderen): Wer als Reicher in ein Unternehmen investiert, darf Profit erwarten und mehrt zugleich den Wohlstand aller, indem er gegen Lohn Menschen beschäftigt. Die Armen werden nicht mehr karitativ versorgt, sondern gegen Lohn für ihre Arbeit beschäftigt. Je mehr produktiv investiert wird, desto mehr Menschen können beschäftigt werden; das Wachstum dieser Kapitalakkumulationswirtschaft löst die alte Armutsfrage.
In diesem Sinne ist die Political Economy eine «Moral Science», indem sie die älteren Sitten und wirtschaftlichen Verhaltensweisen in neue «Moral Standards» überführt, d.h. in eine Verhaltensrationalität, die nicht mehr den geschichtlich ausgeprägten Tugenden folgt, sondern den neuen Allokationsbedingungen. In der Unterscheidung zwischen «Reichtum» (wealth) und «Tugend» (virtue) entscheidet Smith sich für den Reichtum. Dem tugendhaften, aber armen Leben der Wilden bzw. des Naturzustandes bietet der zivilisierte Zustand der «Commercial Society» ein wohlhabenderes Leben, das allerdings auf Kosten der Gerechtigkeit geht: Die Einkommensdifferenzen bleiben bestehen, lösen sich im Wachstumsprozess der später von Smith entwickelten Kapitalakkumulation auch nicht auf, aber der «Wealth of Nations» erhöht sich und lässt alle, proportional, daran teilhaben.
Adam Smith eliminiert die traditionellen Tugendmotive des wirtschaftlichen Handelns. Nicht die moralische Haltung, sondern allein die Angebotsfähigkeit des Händlers ist demnach für die wirtschaftliche Analyse von Interesse. «To better the comfort of life» wird ein «natürliches» Streben nach Reichtum, das in seinen privaten Motiven tugendneutral bleibt, aber die «Benevolence» als gesamtwirtschaftliches Resultat produziert. Das «System of Natural Liberty» ist eine kapitalwirtschaftlich organisierte Ökonomie, die den Hang zum Luxus, die traditionelle ökonomische Untugend des Hyperkonsums, durch den Hang zur Bereicherung, das Mehrhabenwollen, ersetzt.
Diese scheinbare Paradoxie lässt sich sofort auflösen, denn die Erwartung, durch Kapitalinvestitionen zukünftig Profite zu erzielen, setzt voraus, den gegenwärtigen Konsum zu begrenzen. Historisch entscheidend ist dabei die Verwandlung der pleonexie in ein Profitbegehren über Investition und damit in Beschäftigung und Einkommen. Smith entwirft eine Theorie der Kapitalwirtschaft, die Beschäftigung nicht durch sekundäre Einkommensumverteilung, sondern durch Investitionen bewirkt, die eine primäre Verteilung der Einkommen für die «Armen» und die «Reichen» einschliesst.
Diese dritte Legitimation des Reichtums ist identisch mit der beginnenden kapitalistischen Gesellschaft. Wenn der Reichtum mit den Armen qua Beschäftigung geteilt wird, ist jeder darüber hinausgehende Profit gerechtfertigt, sofern weiter investiert wird. Im Prinzip wird die Caritasregel eingehalten, nur dass das superfluum nicht umverteilt, sondern als Kapital reinvestiert wird. Hier beginnt die moderne Wachstumsökonomie, die Reichtum qua Kapital und Investition als produktive Steigerung des allgemeinen Reichtums («The Wealth of Nations») einsetzt. Die Richterskala der Profitabilität ist nach oben offen, was erst dann den neuen bürgerlichen bonum commune verletzt, wenn das akkumulierte Vermögen nicht mehr in beschäftigungsausweitende Investition übersetzt wird. Nicht nur der Reichtum, sondern der Kapitalismus als Wealth-Generating System wird wohlfahrtstheoretisch legitimiert.
4. Legitimation über freiheitliche Eigentumsrechte
Eine Veränderung erfuhr dieses Prinzip durch das um 1900 nachgereichte ökonomische Wohlfahrtskriterium. Das sogenannte Pareto-Kriterium erlaubt jedwelche Einkommensgewinne und damit jeden Reichtum, wenn er nicht auf Kosten der Chancen der Einkommensschwachen erlangt wird. Diese Legitimation ist schwächer: Sie koppelt die Gewinnwirtschaft und ihre Reichtümer nicht mehr an eine Beschäftigungswirksamkeit, sondern nur an einen Schutz bisher erlangter Einkommen und Eigentumsrechte. Damit ist Reichtum sozialer Verpflichtung entbunden, wenn er nicht durch «Ausbeutung» entstand. Das aber ist der Beginn der Auflösung der dritten Reichtumslegitimation. Hat jemand den Reichtum rechtlich einwandfrei erworben, ist er vom Geben – in welcher der drei Legitimationsformen auch immer – befreit.
Man muss hinzufügen, dass die ökonomische Wohlfahrtsregel zu einer Zeit entstand, da jeder Staat bereits Steuersysteme eingeführt hatte: hoheitsrechtliche Zwangsumverteilung und Finanzierung öffentlicher Güter. Die Redistributionsmomente der ersten und der zweiten Legitimationskonzeption wurden jetzt vom Staat bedient, so dass den Reichen zugebilligt wurde, über ihren Gewinn nach Steuern frei disponieren zu können, ohne politische, soziale und sogar ohne Wohlfahrtsverpflichtung. Das war historisch neu: erstmals war Reichtum nicht mehr in eine sozialverpflichtende Struktur eingebunden. Stattdessen wurde Reichtum über freiheitliche Eigentumsrechte legitimiert. Das ist die vierte moderne Legitimationsform des Reichtums: der Staat übernimmt die Verteilung. Man muss sich als Reicher nicht mehr sozial geben.
5. Renaissance des antiken Stiftergedankens – modernisierter Typ 1
Daneben respektive zuvor kannte das 19. Jahrhundert auch den Aufschwung eines Musters, das über den dritten Legitimationstypus nicht zu erklären ist: ein opulentes Mäzenatentum und Stiftungswesen. In den USA florierte dieses noch stärker, weil der Staat dort anders als in Europa etliche soziale Aufgaben nicht übernahm. Es handelte sich dabei gleichsam um eine Renaissance der antiken Leiturgien, in dem Sinne, dass Reiche häufig die Finanzierung von Kunst, Museen, Opernhäusern, aber auch Strassen, Stadtvierteln und Parks übernahmen. Man kann es eine modernisierte mäzenatische Legitimation des Reichtums nennen. In ihr liefen im 19. Jahrhundert mehrere Motive parallel: eine fortschrittliche Haltung des reichen Bürgertums, das die industriell-unternehmerische Modernisierung als kulturelle Modernisierung auffasste; der soziale Anspruch, in der aufkommenden «socialen Frage» eine Form von Nächstenliebe zu zeigen; das Bestreben, in Bildung zu stiften, nicht zuletzt auch, um bürgerliche Eliten heranzubilden und den Nachwuchs zu sichern; die Attitüde, die Rolle des abtretenden Adels zu übernehmen.
Diesem letztgenannten Motiv entsprechend, zeichnete sich die Stiftertätigkeit der Reichen des 19. Jahrhunderts durch Opulenz aus. Was dem Adel in der Luxusdebatte des 18. Jahrhunderts als unproduktive Verschwendung vorgehalten wurde, wurde im bürgerlichen Mäzenatentum des 19. Jahrhunderts reanimiert: als bürgerliches Selbstbewusstsein eines neuen Status. Wohl war dieses Statusstreben mit einem philanthropischen oder gemeinschaftlichen Sinn gekoppelt. Aber das opulente Moment dominierte häufig: Man wollte zeigen, was man hat.
Die Pracht eines bürgermäzenatisch gestifteten Opernhauses oder Theaters sollte die adlige Pracht der Schlösser übertreffen, zumal diese Bauten öffentliche waren, in denen das Bürgertum seinen neuen Status gemeinschaftlich zelebrierte. Dabei spielte die Verknüpfung von Reichtum und Ästhetik eine herausragende Rolle. Das neue reiche Bürgertum entwickelte einen eigenen Stil, der adelsaffin blieb, aber den Willen zur eigenständigen Selbstdarstellung hatte. Kunst und Reichtum verbanden sich zum ästhetischen Ausdruck des Fortschritts. Deshalb wurden neue Formen notwendig: Man wollte zeigen, dass man etwas Eigenes kreiert – eine neue Welt.
6. Reziprozitärer Altruismus
Das alles verlor sich in der darauffolgenden Epoche des Etatismus, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg. Im 20. Jahrhundert veränderte sich das Mäzenatentum. Natürlich stifteten Reiche weiter, aber ihre Intentionen verkehrten sich: es galt und gilt nicht mehr, der Allgemeinheit zu stiften, sondern ins eigene Unternehmen zu investieren – mit gleichzeitiger architektonischer Prägung des Stadtbildes. Die Hülle bleibt dabei öffentlich, aber die soziale Gesinnung reduziert sich auf architektonische Grossformen. Es sind nur marginal noch Stiftungen an die Gemeinschaft, sondern vorwiegend Investitionen ins eigene Geschäft.
Das Geben wird dadurch zu einem Hybrid aus Allgemein- und Eigensinn. Das heisst: man braucht der Allgemeinheit nichts zu geben, was nicht zugleich auch einem selber von Nutzen ist. Es ist eine Inversion der modernisierten ersten und zweiten mäzenatischen Legitimationsform: nennen wir sie die fünfte Reichtumsform der modernen Reziprozität. Ihr Grundprinzip lautet: Stiften muss sich lohnen.
Genaugenommen haben wir es dabei mit einer Form des auf
Reziprozität beruhenden Altruismus zu tun, in dem der, welcher gibt, kein Gegengeschenk erwartet, aber doch eine Art Auszahlung, wenn auch auf anderer Ebene: in Anerkennungswährung – im Sinne eines gesellschaftlichen Kreuztausches von Geld gegen Reputation. Die Reichen stiften optimiert: so viel, dass sie genügend Anerkennung bekommen, ohne allzu viel verauslagen zu müssen.
Da der Staat die Wohlfahrtsaufgaben übernommen hat, folgen Stiftungen jetzt eigensinnigen Zwecken oder streben nach der unmittelbaren Anerkennung durch die Gesellschaft. Viele Stiftungen frönen deshalb eigenartigen und oft belanglosen Zwecken. Eine soziale Rückkopplung ist nicht mehr selbstverständlich vorgesehen: schliesslich hat man ja über die Steuern seinen Sozialbeitrag schon geleistet. Die soziale Funktion des Reichtums wird durch staatlichen Zwang geregelt; deshalb wird die freiwillige, private schwächer. Anders ist es in den USA, wo die staatlichen Wohlfahrtsprogramme viel weniger umfassend ausgelegt sind. Hier herrscht noch ein stärker philanthropisches Moment vor.
Dennoch bleibt insgesamt zu konstatieren, dass dem neuen Stiftungsdenken die Opulenz fehlt. Kaum ein Reicher stiftet heute eine ganze Universität (Soros und Google ausgenommen), baut eine ganze Stadt, legt grosse Stadtparkanlagen an oder bietet einer Kommune an, das Rathaus völlig neu und aufregend zu bauen. Es fehlt der Wille, Zeichen zu setzen, Modelle zu bilden. Das, was man mit dem Reichtum vermag – das Vermögen –, bleibt unterentwickelt.
Die ungeheuren Anstrengungen, Reichtum zu erhalten und zu vermehren, sind heute allzu häufig atelos (aristotelisch: zwecklos). Es wird ignoriert, was früher im gesellschaftlichen Bewusstsein präsent war: dass Reichtum ein Geschenk ist (in effigie als Erbschaft, sonst als Kooperationsergebnis), das auf ein Weitergeben wartet.
Reichtum erfordert Reflexion – auf Seiten der Reichen wie der Gesellschaft
Dabei ist klar: der Umgang mit Reichtum bedarf der Kompetenz. Wer reich und nicht blind ist, wird sich zwangsläufig fragen: wozu reich? Und ebenso wird er, wie etwa der SAP-Mitgründer Hasso Plattner, feststellen, dass er seinen Reichtum seiner exzellenten (Gratis-)Ausbildung verdankt und also spenden muss. Wenn man begreift, dass in einen investiert wurde, bis man selber den Reichtum erwirtschaftete, kommen Kompensationsideen auf. Ebenso klar ist aber auch: Niemand, der seine Chancen ergriff, schuldet deswegen den anderen. Die Verwendung des Reichtums ist immer ein Investitionsthema. Die unüberlegten Reichen investieren weiter in Geld. Die klareren in die Gesellschaft. Nicht aber dadurch, dass sie zurückgeben – als ob ihr Reichtum auf einem Kredit beruhte! –, sondern indem sie weiter investieren: in avancierte Projekte, die niemand sonst lancieren kann. Nur das entspricht ihrer unternehmerischen Haltung, die sie erst zu Reichen werden liess.
Reichtum bedarf der Kompetenz: nicht nur auf Seiten der Reichen, sondern auch auf Seiten der Gesellschaft, die lernen muss, Reichtum anzunehmen und Dankbarkeit zu zeigen. Unsere immer stärker ausgeprägte Neigung, Reichtum zu diskreditieren, hindert uns daran, ihn hinzunehmen und zu ehren. Es stellt sich deshalb nicht nur die Frage, wie und wozu Reiche geben, sondern auch wie wir, als moderne Polis, mit den Reichen umgehen; wie wir nehmen können. Die jetzige Form, den Reichtum als privatum sich selbst zu überlassen, nachdem die Steuern abgezogen worden sind, ist eine politisch nicht reflektierte Form. Wir müssen uns bewusst machen, dass Reichtum eine Basis unseres Wohllebens darstellt, dessen Steuerbeitrag angemessen zu regeln ist – ohne dass damit die Optionen auf Freigebigkeit gemindert werden.
Allzu häufig wird Reichtum sozial gedacht und als Geschenk betrachtet, das der Reiche der Gesellschaft (zurück)zugeben hat. Das Leistungsmoment wird ausgeblendet – als ob der, der reich wurde, dies unverdient und nur durch Glück geschafft hätte. Damit überhaupt freie Formen der Rückzahlung entstehen können, muss anerkannt werden, dass Reiche zuerst einmal leistungsstark waren. Die Theorie des Zurückgebens von Reichtum setzt voraus, dass man versteht, dass Reichtum zwar nur unter Mitarbeit vieler entstehen kann – dass das aber nicht automatisch zur natürlichem Rückverteilung berechtigt. Denn der Wagemut, die Initiative wurden nicht von allen Beteiligten getragen. Wir stehen vor dem unauflöslichen Dilemma, dass der Reichtum, den wir allgemein rückverteilt haben wollen, durch uns selber nie zustande gekommen wäre. Haben wir, die wir nur indirekt beteiligt sind, einen Anspruch auf diesen Reichtum?
Natürlich nicht. Es ist letztlich die freie Entscheidung der Reichen selber. Dass sie sich heute nicht oder nur bedingt zur Rückgabe verpflichtet fühlen, ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht mehr als Gesellschaft begreifen. Der Zwangsumverteiler Staat dient als Ausrede: er soll schliesslich für das Soziale sorgen. Und so wie wir den Staat in dieser Hinsicht verehren, darf uns nicht erstaunen, dass die Reichen sich dieser Ansicht anschliessen. Sie haben ja schon, qua Steuern, gezahlt.