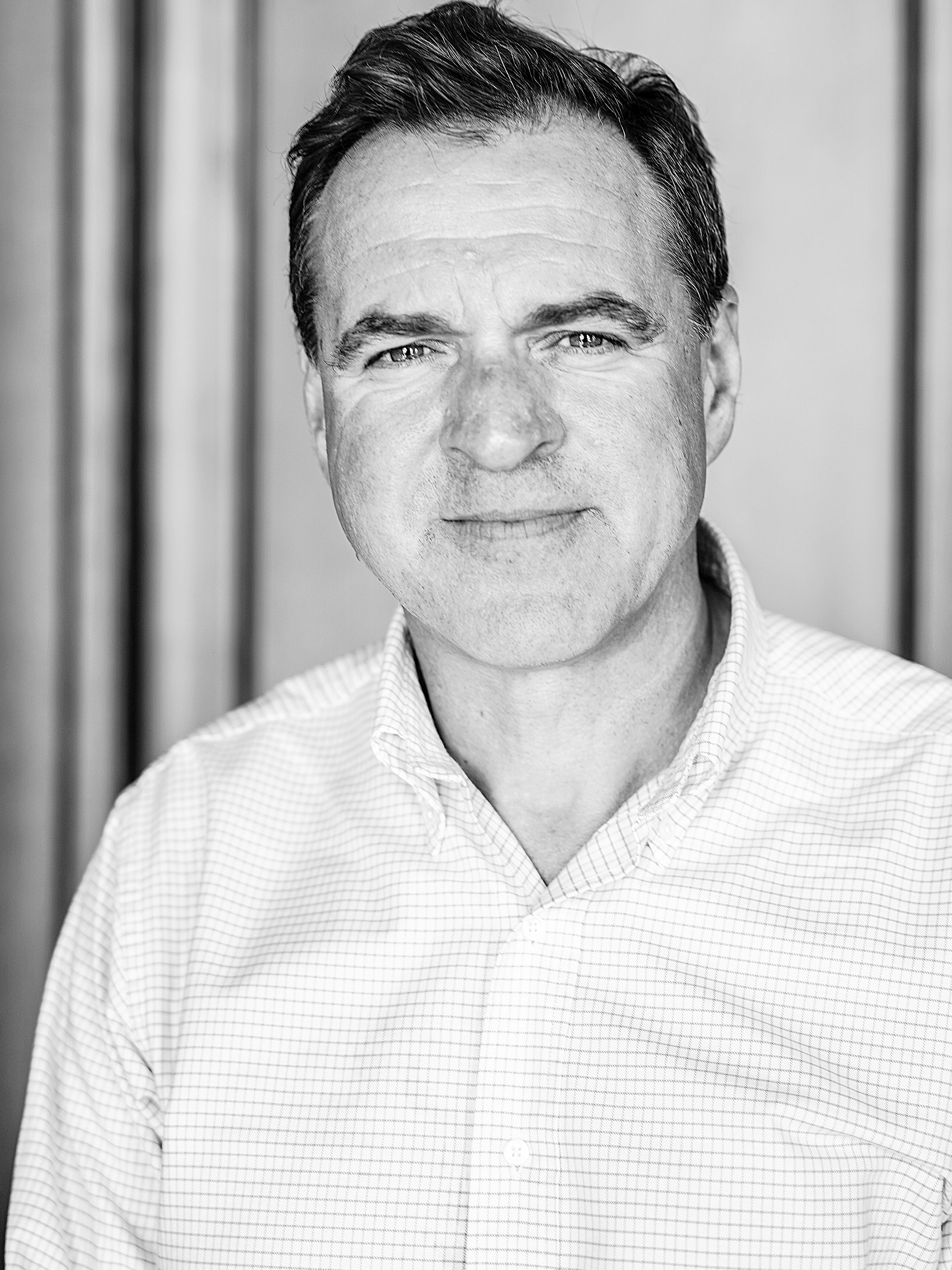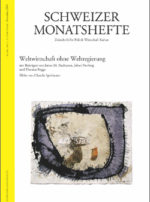Der Wehrwille beginnt im
Elternhaus
Damit sich die Schweiz verteidigen kann, braucht es verantwortungsbewusste Politiker, eine gute Armeeführung, verständnisvolle Unternehmen – und Bürger, die mitmachen.
Kurz vor dem Angriff von Russland auf die Ukraine schätzte der Chef der Armee, Thomas Süssli, die Durchhaltefähigkeit der Schweizer Luftwaffe auf vier Wochen ein – mit dem Verweis darauf, «dass wir die Verteidigungsfähigkeit der Armee 2003 auf den Kompetenzerhalt» reduziert hätten.
Nachdem die Rüstungsausgaben seit 1990 kontinuierlich gesunken waren und 2019 noch 0,71 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) oder 5,6 Milliarden Franken betragen hatten, forderten die bürgerlichen Parteien nun mittels einer Motion die schrittweise Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Konkret soll der Plafond für die Armeeausgaben 2023 um 300 Millionen Franken erhöht werden. Ab 2024 sollen die Armeeausgaben jährlich schrittweise so steigen, dass sie 2030 1 Prozent des BIP betragen, also rund 7 Milliarden Franken.1
Für eine dauerhafte Erhöhung des Verteidigungshaushalts müsste allerdings ein beständiger politischer Wille vorhanden sein. Es sind im bürgerlich dominierten Bundesrat und Parlament aber nicht nur die SPS und die Grünen, die sich konsequent gegen ein angemessenes Armeebudget stemmen. Auch unter bürgerlichen Politikern ging bis vor kurzem der Spruch um, mit Sicherheitspolitik könne man keinen Blumentopf gewinnen.
Es braucht mehr als nur mehr Geld
Doch reicht der materielle Wiederaufbau der Verteidigungsbereitschaft? Die Schweizer Armee leidet nicht nur an Geld-, sondern auch an Personalmangel. Jährlich melden sich rund 6000 Wehrpflichtige aus der Armee ab und leisten Zivildienst. Die Gründe dafür sind vielfältig. Nur 53 Prozent der Zivildienstleistenden gaben in einer wissenschaftlichen Studie für ihren Entscheid Gewissensgründe an.2 Fast die Hälfte der Zivildienstleistenden erklärte, den Wehrdienst aus Prinzip abzulehnen, nicht für einen Militärdienst motiviert zu sein, Probleme mit dem militärischen Alltag und Führungsstil zu haben oder berufliche bzw. schulische Nachteile zu erwarten. In der Tat sind Militärdienst und Studium seit der Einführung des Bologna-Systems noch schwieriger unter einen Hut zu bringen. Aber auch Arbeitgeber nehmen die Wehrpflicht und die damit verbundenen Abwesenheiten der Arbeitnehmer nicht mehr als selbstverständlich hin – Vaterland hin oder her. Immerhin begrüsst heute wieder eine ganze Gruppe bedeutender Arbeitgeber öffentlich eine militärische Kaderlaufbahn.3 Zu den Abgängen in den Zivildienst kommen nun geburtenschwächere Jahrgänge. Es droht die Gefahr, dass der Soll-Bestand der Armee in den nächsten Jahren nicht mehr erreicht wird.
Die Schwächen der Schweizer Armee sind nicht das Resultat eines tiefen Volkseinkommens oder einer zu kleinen Geburtenrate, sondern eines mangelnden politischen Willens. Einerseits erkennt der Bundesrat angesichts der Verschlechterung der Finanzlage keine Dringlichkeit, mehr Mittel in die Landesverteidigung zu investieren, andererseits will das Parlament die hämorrhagischen Abgänge in den Zivildienst nicht stoppen. Und schliesslich sehen die jungen Männer die allgemeine Wehrpflicht nicht mehr als eine Bürgerpflicht, sondern als eine unter mehreren Optionen. Faktisch herrscht ja auch Wahlfreiheit.
«Geistige Widerstandskraft unseres Volkes stählen»
Bereits der Erste Weltkrieg hatte bewusst gemacht, dass Landesverteidigung mehr war als der Einsatz von Streitkräften. Das Aufkommen von Film und Radio in der Zwischenkriegszeit erleichterte die Verbreitung totalitärer Ideologien. Seit den 1920er-Jahren wuchs deshalb die Überzeugung, dass der demokratische Rechtsstaat bereits in Friedenszeiten zu verteidigen sei. Ab 1933 verlangten Parlamentarier, Intellektuelle, Medienschaffende und verschiedene Organisationen, darunter auch der Schweizerische Lehrerverein, Massnahmen zur Stärkung der kulturellen Grundwerte der Schweiz. Angestrebt wurden ein Schulterschluss über alle Parteien hinweg und die Überwindung der Klassengegensätze.4
Diesen Forderungen kam der Bundesrat mit seiner Botschaft vom 9. Dezember 1938 nach. Ziel der Botschaft war die «Kulturwahrung und Kulturwerbung».5 Ein jährlicher Kredit von 500 000 Franken sollte dazu dienen, «in unserem eigenen Volke die geistigen Grundlagen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die geistige Eigenart unseres Landes und unseres Staates neu ins Bewusstsein zu rufen, den Glauben an die erhaltende und schöpferische Kraft unseres schweizerischen Geistes zu festigen und neu zu entflammen und dadurch die geistige Widerstandskraft unseres Volkes zu stählen».
Die erste grosse Manifestation dieser geistigen Landesverteidigung war zweifellos die Landesausstellung von 1939 in Zürich. Weit über eine Million Schweizerinnen und Schweizer besuchten die «Landi», die einerseits im Landidörfli die schweizerischen Traditionen hochleben liess, andererseits die Innovations- und Leistungsfähigkeit der schweizerischen Industrie zeigte.
Der Bundesrat war von Anfang an der Auffassung, die «geistige Landesverteidigung» sei nicht primär eine staatliche Aufgabe, sondern diejenige der Bürger. Es waren daher die zivilgesellschaftlichen Organisationen Pro Helvetia und die Neue Helvetische Gesellschaft (NHG), ab November 1939 aber auch die neu geschaffene Armeesektion Heer und Haus, die vor allem der staatlich gelenkten Kulturpropaganda aus Deutschland und Italien entgegentraten.
Der Oberbefehlshaber der Armee, General Henri Guisan, förderte die geistige Landesverteidigung gezielt. Mit seinen häufigen Truppenbesuchen, aber auch mit dem Rütli-Rapport vom 25. Juli 1940 und seiner Radioansprache vom 1. August 1940 leistete er selber Informations- und Überzeugungsarbeit. Er beseelte Armee und Bevölkerung mit Widerstandsgeist und machte aus dem Réduit ein nationales Symbol, indem er eine Symbiose von Volk und Truppen schuf und den Kontakt zu Zivilisten und den Mannschaftsdienstgraden pflegte.6

Schlüsselfaktoren für die Wehrbereitschaft
Wie erfolgreich aber war die geistige Landesverteidigung? Der Wehrgeist der Truppe war bei Beginn des Zweiten Weltkrieges zweifellos sehr gut. Allerdings traten mit der Zeit bei vielen Soldaten Ermüdungserscheinungen und – insbesondere bei weniger gut geführten Verbänden – Zweifel an der Zweckmässigkeit der Verteidigungsmassnahmen auf. Insgesamt blieb aber die Wehrbereitschaft hoch. Befragungen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten, dass der Zusammenhalt im kleinen Kampfteam und in der Einheit, also Kameradschaft und gute Führung, Soldaten veranlassten, ihr Leben im Krieg zu riskieren. Soldaten kämpfen danach primär für Soldaten; die Kohäsion in der Einheit als wichtigster Faktor für die Kampfmotivation wird von einer neueren wissenschaftlichen Studie bestätigt. Heute sind für Soldaten aber – mindestens in westlichen Staaten – auch die Legitimität und die Sinnhaftigkeit des Krieges eine Voraussetzung.7
«Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.» Was Jeremias Gotthelf schon 1842 schrieb, dürfte auch heute noch gültig sein. Staatliche Propaganda verfängt in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nicht. Da helfen auch staatspolitischer Unterricht und nationalpädagogischer Geschichtsunterricht nicht.
Vielmehr sind Eltern gefragt, die den wirklichen Staatsaufgaben positiv gegenüberstehen. Zu diesen wenigen wirklichen Staatsaufgaben gehören die äussere und die innere Sicherheit und damit die Armee und die Polizeikorps. Gefragt sind zudem Eltern, die den umfassenden Versorgerstaat ablehnen und gleichzeitig bereit sind, staatsbürgerliche Verantwortung zu tragen und – auch unbezahlte – gemeinnützige Arbeit zu leisten. Und schliesslich müssen die Eltern fähig und willens sein, diese Überzeugungen und Werte ihren Kindern weiterzugeben.
Das Elternhaus allein kann aber den Wehr- und Dienstwillen nicht retten. Gefragt sind deshalb auch ein Parlament und ein Bundesrat, die ihre Verantwortung wahrnehmen und die notwendigen Mittel für eine finanziell und personell angemessen dotierte und damit glaubwürdige Armee bereitstellen. Gleichzeitig muss die Führung in der Armee dergestalt sein, dass sie positive Diensterlebnisse schafft: sinnvolle, intensive, einsatzorientierte Ausbildung bei menschenorientierter Führung.
Und letztlich muss die Wirtschaft auch wieder aktiv bereit sein, ihre Mitarbeitenden für eine militärische Kaderausbildung freizustellen und deren Führungserfahrung im eigenen Betrieb zu nutzen.
Die Realität in den Familien, in der Politik und in den Betrieben sieht heute oft anders aus. Die Geschichte lehrt, dass es eine handfeste Krise braucht, bis wir umzudenken beginnen – die Ukraine ist dafür offenbar zu weit weg. Bleibt nur die Hoffnung, dass es dann nicht zu spät ist.
http://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/2022060210414367
1194158159038_bsd076.aspx ↩Niels Stampfli und Hubert Annen: Die Beweggründe für den Übertritt in den Zivildienst. In: ASMZ 01-02/2020, S. 33–35.
↩leadershipcampus.ch/leadership/#testimonials. ↩
Marco Jorio: Geistige Landesverteidigung, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017426/2006-11-23/ ↩
Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung vom 9. Dezember 1938; http://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1938/2_985__/de ↩
Hervé de Weck: General Guisan. In: HLS: hls-dhs-dss.ch/de/articles/
019083/2020-02-10/ ↩Leonard Wong et al.: Why They Fight: Combat Motivation in the Iraq War. In: US Army War College Press, 2003. ↩