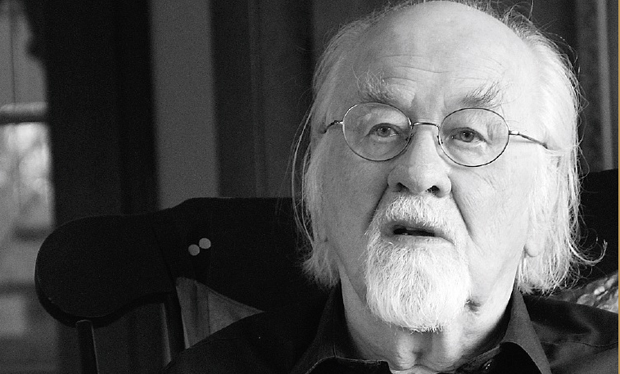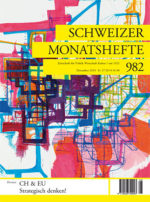(3) Worst Case als Planungsgrösse
Zu den Worst-Case-Szenarien, mit denen sich das «Labor Spiez» vor allem beschäftigt, gehört weder der atomare Vernichtungskrieg noch die Explosion
eines Atomkraftwerks. Das Institut für den Schutz vor ABC-Gefahren bereitet die Schweizer Bevölkerung vielmehr vor allem auf die Bedrohung durch terroristische Attacken mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen vor.
Im Konfliktfall gilt der Einsatz atomarer, biologischer oder chemischer Waffen – unter dem etwas unpräzisen Begriff der Massenvernichtungswaffen zusammengefasst – gemeinhin als worst case. Das Spektrum der möglichen Szenarien ist hierbei gross, und es stellt sich daher die Frage, was genau einen worst case darstellt.
Wird die technische Machbarkeit als Kriterium zugrundegelegt und werden die Auswirkungen auf die Menschen und ihre Lebensgrundlagen analysiert, dann ist zweifellos der globale Nuklearkrieg der worst case. Ein mit Atomwaffen geführter Krieg zwischen den grossen Machtblöcken würde zu einer völligen oder zumindest weitestgehenden Vernichtung des Lebens auf der Erde führen. Der «nukleare Holocaust» ist das dominante Schreckensszenario aus der Epoche des Kalten Kriegs.
Einige Zahlen genügen, um sich das Ausmass dieses worst case vorzustellen. Die euphemistisch «Little Boy» genannte Atombombe, die vom US-amerikanischen Bomber Enola Gay am 6. August 1945 um 08:16 Uhr Lokalzeit auf Hiroshima abgeworfen wurde, zerstörte die mittelgrosse japanische Küstenstadt nahezu vollständig. Rund 90’000 Menschen starben unmittelbar, weitere 50’000 Menschen erlagen Jahre bis Jahrzehnte später den Folgen der Strahlenbelastung. Die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen TNT, d.h. ihre Sprengkraft entsprach derjenigen von 13’000 Tonnen des konventionellen Sprengstoffs Trinitrotoluol (TNT). Man stelle sich das einmal vor: 1 Tonne Sprengstoff füllt einen kleinen Lieferwagen, 100 Tonnen einen Eisenbahnwagen, 1’000 Tonnen oder 1 Kilotonne einen ganzen Güterzug … – in diesem Bereich enden vorstellbare Vergleiche.
Und die technologische Entwicklung bei den A-Waffen ist seither weiter vorangeschritten. Als Folge des gegenseitigen Rüstungswettlaufs stellten die beiden Grossmächte während des Kalten Kriegs immer stärkere, immer wirkungsvollere Nuklearwaffen her; die Kaliber wurden bis in den Megatonnenbereich hinauf gesteigert. Am 30. Oktober 1961 um 11:32 Uhr Moskauer Zeit wurde von der UdSSR die sogenannte Zar-Bombe über dem Testgelände in der Mitjuschikabucht auf der Insel Nowaja Semlja gezündet. Sie war die stärkste jemals gezündete At ombombe. Ihre Sprengkraft erreichte – je nach Quelle – 50 bis 60 Megatonnen TNT; sie war damit mehr als 3’800mal stärker als die Hiroshima-Bombe. Auf dem Höhepunkt des Wettrüstens erhöhten sich die Nukleararsenale der beiden Grossmächte USA und UdSSR insgesamt auf gigantische 65’000 Sprengköpfe. Zu Recht sprach man von einem «Gleichgewicht des Schreckens». Die Bezeichnung der entsprechenden Doktrin als «Mutual Assured Destruction» hatte einen geradezu gespenstisch anmutenden Doppelsinn. Mittlerweile sind diese Arsenale zwar stark reduziert worden. Doch die USA und Russland verfügen noch immer über rund 20’000 Sprengköpfe, genug, um einen «nuklearen Holocaust» herbeizuführen. Die Depots der übrigen offiziellen Atommächte China, Frankreich und Grossbritannien sind, mit ca. 650 bis 800 Sprengköpfen, wesentlich kleiner.
Diese Zahlen sind eindrücklich – um nicht zu sagen schauderhaft. Sie umreissen den worst case der Menschheit. Helfen sie aber, diese Bedrohung zu bewältigen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der operativ tätigen Sicherheitsexperten. Wenn ein konkreter Beitrag zur Erhöhung der objektiven Sicherheit geleistet werden soll, dann ist das Worst-Case-Szenario des nuklearen Holocausts unbrauchbar. Wenn die Menschheit nicht überleben wird, gibt es auch nichts mehr zu planen.
Betrachten wir ein weiteres Szenario. Im Bereich der atomaren oder radiologischen Gefahren ist zweifellos ein schwerer Reaktorunfall der worst case. In der Umgangssprache spricht man hier auch vom «GAU», dem «Grössten Anzunehmenden Unfall». Mit Tschernobyl ist der GAU Realität geworden. Am 26. April 1986 kam es im Block 4 des Kernkraftwerks von Tschernobyl als Folge von Bedienungsfehlern und Konstruktionsmängeln zur Kernschmelze und Explosion im Reaktor. Der Unfall führte zu einer relativ geringen Zahl direkter Todesopfer, insbesondere unter den Kraftwerksbeschäftigten und Feuerwehrleuten. Von den 134 Personen, bei denen eine akute Strahlenkrankheit festgestellt wurde, sind 28 im Jahr 1986 und weitere 19 in den Jahren 1987 bis 2004 verstorben, einige davon möglicherweise auch aus anderer Ursache. Zudem sind in den stark belasteten Regionen mehrere tausend Menschen an Krebs erkrankt. Inwieweit aber diese und weitere zu erwartende Gesundheitsprobleme auf den Unfall von Tschernobyl zurückzuführen sind, ist unter Wissenschaftern heftig umstritten.
Aus technischer Perspektive war Tschernobyl tatsächlich ein worst case. Gravierendes menschliches Fehlverhalten und das gleichzeitige Versagen aller Sicherheitssysteme führe zum GAU. Inwiefern aber die Auswirkungen eine Kategorisierung als worst case rechtfertigen, bleibt zumindest umstritten. Der nukleare Holocaust und der Tschernobyl-Unfall zeigen die enorme Bandbreite dessen, was in der öffentlichen Wahrnehmung als worst case in Sicherheitsfragen gilt. Ob relativ wenige Todesopfer oder die vollständigen Vernichtung allen menschlichen Lebens – beides gilt als worst case. Hat das Sinn? Verblasst der «kleinere» worst case hinter dem noch schlimmeren?
Für den technisch orientierten Sicherheitsexperten sind derartige Differenzierungen nur bedingt relevant. Ihm geht es nicht um semantische Kategorien oder philosophische Erkenntnis. Er ist vielmehr dem Pragmatismus verpflichtet und möchte mit den vorhandenen Ressourcen einen möglichst effizienten Schutz vor realistischen Gefahren und Bedrohungen erzielen. So gesehen, ist die Arbeit mit Szenarien lediglich eine Methode, um mögliche Auswirkungen erkennen und Schutzmassnahmen planen zu können. Das Tschernobyl-Szenario ist daher signifikanter als das Worst-Case-Szenario des globalen Nuklearkriegs.
Die Auswirkungen des Tschernobyl-Unfalls sind in der Schweiz sehr genau untersucht worden. Während Wochen haben die Experten des «Labors Spiez», des Schweizerischen Instituts für den Schutz vor ABC-Bedrohungen, eine Vielzahl von Messungen unternommen, von denen einige bis heute weitergeführt werden. Unser Wissen über die Auswirkungen eines derartigen Ereignisses auf die Umwelt ist dadurch grösser geworden. Auch politisch und organisatorisch wurden aus Tschernobyl viele Lehren gezogen; so ist beispielsweise ein Netz von Messsonden für die permanente Überwachung der Radioaktivität aufgebaut und auf politisch-administrativer Ebene sind die Zuständigkeiten für die Bewältigung derartiger Ereignisse neu geregelt worden.
Es liegt auf der Hand, dass die richtigen Gegenmassnahmen nicht erst nach dem Ereignis, sondern bereits vorher ergriffen werden müssen. Mit der Prävention soll die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses reduziert werden; bei der «preparedness», der Bereitschaft, geht es darum, nach dem Eintritt des Ereignisses das Schadensausmass so klein wie möglich zu halten. Genau hier setzt die Arbeit der sicherheitstechnisch tätigen Experten im Umgang mit dem worst case an. Zur Optimierung des ABC-Schutzes werden fiktive Szenarien definiert, die ein möglichst breites Spektrum an denkbaren Gefährdungen abdecken.
Im Bereich des Schutzes vor atomaren und radiologischen Bedrohungen steht neben dem Einsatz von A-Waffen sowie einem Unfall in einer Nuklearanlage insbesondere der Terroranschlag mit einer «schmutzigen Bombe» im Vordergrund, einer mit radioaktivem Material versehenen konventionellen Bombe. Die Gefahr einer solchen Bombe wird weltweit als erheblich eingeschätzt.
Im Bereich der biologischen Bedrohung stehen Pandemieszenarien im Blickfeld. Die jüng-ste Diskussion um die Gefährdung des Menschen durch die Vogelgrippe hat dies auch einer breiteren Öffentlichkeit in Erinnerung gerufen. Daneben sind aber auch im B-Bereich terrori-stische Bedrohungen ernst zu nehmen. Mit den Anthrax-Anschlägen in den USA im Jahr 2001 gibt es auch in diesem Bereich ein reales Referenzereignis, das stark ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit gedrungen ist. Im Ausmass unvergleichlich schlimmer wäre ein gut geplanter Anschlag mit einer ansteckenden Krankheit, wie sie etwa die Pocken darstellen. Ein derartiges Szenario erreicht zwar nicht die Dimension eines «nuklearen Holocausts», Modellrechnungen zeigen aber, dass bei einem solchen worst case ebenfalls mit einer fast unvorstellbar hohen Zahl von Todesopfern gerechnet werden müsste. Auch bei militärischen Bedrohungen sind Pandemieszenarien von Bedeutung. Biologische Waffen können zur «Atombombe des armen Landes» werden. Ihr Einsatz in Konfliktregionen ist daher nie ausgeschlossen.
Im Bereich der C-Bedrohung sind es ebenfall in erster Linie Terrorszenarien, die als besonders bedeutsam eingestuft werden. Auch hier hat der worst case bereits einmal stattgefunden – das Sarin-Attentat in der Tokioter U-Bahn im Jahr 1995. Es verlief mit 13 Todesopfern relativ glimpflich, weil die Attentäter eine dilettantische Art gewählt hatten, um den hochgiftigen C-Kampfstoff zu verbreiten.
Für die Evaluation massgeblicher Szenarien werden im wesentlichen zwei Kriterien herangezogen: die technischen Möglichkeiten und die sicherheitspolitische Situation. Anhand dieser beiden Kriterien können zwar tendenzielle Aussagen über die Wahrscheinlichkeit eines Szenarios gemacht werden, in einem streng wissenschaftlichen Sinne jedoch lässt sich über die Eintretenswahrscheinlichkeit kaum etwas aussagen. Dazu gibt es zu wenige Referenzereignisse. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass innerhalb des nächsten Jahres in der Schweiz ein Zugunglück mit mehr als 10 Todesopfern zu beklagen sein wird, lässt sich anhand von Daten über reale Vergleichsereignisse in der Vergangenheit relativ präzis und zuverlässig berechnen, da sich solche Unfälle leider mit einer gewissen Regelmässigkeit ereignen. Für die meisten ABC-Szenarien fehlen uns hingegen derartige Erfahrungsdaten. Wenn dies auch rein wissenschaftlich gesehen bedauerlich sein mag – menschlich betrachtet kann man dazu nur sagen: Glücklicherweise!
Es ist Aufgabe der Schweizer Behörden, sich trotz allen Ungewissheiten adäquat auf ein allfälliges ABC-Ereignis vorzubereiten. Dazu gehört die Bereitstellung von Einsatzressourcen in der richtigen Menge und Qualität, die Schulung von Interventionskräften und die Überprüfung der getroffenen Massnahmen im Rahmen von Übungen. Da heute der Einsatz von ABC-Waffen durch Terroristen nicht mehr ausgeschlossen werden kann, müssen neben der Armee, die sich seit Jahrzehnten gegen diese Bedrohungen wappnet, auch die zivilen Behörden und Einsatzkräfte einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Schweizer Bevölkerung leisten. Diese Gewichtsverlagerung vom rein militärischen in den zivilen Bereich manifestiert sich etwa in der neuen Unterstellung des «Labors Spiez». Seit 2003 ist es Teil des neu gebildeten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Zudem hat der Bundesrat den Aufbau einer «Geschäftsstelle ABC» beschlossen, die die Kantone bei den Vorbereitungen unterstützen soll. Da es bei terroristischen Ereignissen keine Vorwarnzeit gibt, sind in jedem Falle die lokalen und kantonalen Ersteinsatzkräfte gefordert. Diese werden durch Spezialisten des Bundes unterstützt, trainiert und für die Bewältigung von C-Terrorereignissen ausgerüstet.
Ein Anschlag mit ABC-Mitteln führt auch bei bestmöglichen Schutzmassnahmen und effizienter Ereignisbewältigung zu einem hohen menschlichen wie auch wirtschaftlichen Schaden. Es gilt daher, einem solchen Anschlag möglichst vorzubauen. Dazu dienen primär internationale Übereinkommen und Initiativen, die die Herstellung, Lagerung und den Einsatz von ABC-Waffen verbieten. Wie die jüngere Geschichte zeigt, greifen Übereinkommen ohne wirkungsvolle Kontrollinstrumente allerdings wenig. Als grösster politischer Erfolg bei der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen kann deshalb das 1997 in Kraft getretene Chemiewaffenübereinkommen bezeichnet werden, da dieses die Vernichtung der bestehenden Arsenale nicht nur regelt, sondern auch durch regelmässige Inspektionen kontrolliert. Die Schweiz unterstützt die Umsetzung dieses Übereinkommens sowohl finanziell wie auch direkt. Das «Labor Spiez» ist ein Vertrauenslabor der «Organisation für das Verbot Chemischer Waffen» (OPCW) und hat den Aufbau dieser internationalen Behörde durch die Ausbildung von Inspektoren und die Übergabe von Methoden zum Nachweis von Kampfstoffen wesentlich unterstützt.
Eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen. Dies ist die Vision des «Labors Spiez». Wir hoffen, mit unserer Arbeit im Bereich Bedrohungsanalyse, Schutz, Ereignisbewältigung und Abrüstung etwas dazu beitragen zu können, dass keines der Worst-Case-Szenarien je traurige Realität wird.