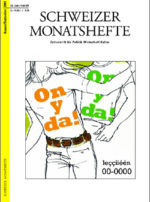Wir müssen offensiv
am Neuen bauen
Die Welt von morgen ist längst eine andere geworden. Liberale müssen Systemalternativen schaffen, statt den untauglichen Versuch zu unternehmen, Mehrheiten zu überzeugen.
Sehen wir der bitteren Wahrheit ins Auge: Der Liberalismus hat heute nur wenige überzeugte Verteidiger und Anhänger. Das liegt darin begründet, dass er seine eigenen Prinzipien verraten hat. Das wiederum ist eine notwendige Folge des politischen Betriebs in der Demokratie. Das wiederum ist eine Erkenntnis, der sich die meisten Liberalen lieber verschliessen. Stattdessen hören wir vonseiten derer, die den zunehmenden Freiheitsverlust durch den aktuellen Verbots- und Empörungsaktivismus erkannt haben: «Wir müssen um unsere Freiheit kämpfen! Wir müssen liberale Positionen wieder offensiver vertreten» usw.
Der Wähler bevorzugt Gratisleistungen
Das ist zwar aller Ehren wert, aber dieser Kampf ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Vorstellung, dass man Mehrheiten mit Vernunftargumenten von freiheitlichen Ideen überzeugen könnte, war und ist eine Selbsttäuschung. Faktisch hat das der real existierende Liberalismus erkannt und seine Parteien haben sich längst dem sozialdemokratischen Mainstream angeschlossen. Klassisch-liberale Regierungsparteien wurden hingegen beginnend Ende des 19. Jahrhunderts überall da abgewählt, wo die Massendemokratie eingeführt wurde, oder änderten ihr Programm (Beispiele sind England, Deutschland, die USA und letztlich auch die Schweiz). Es gibt eine eindeutige Korrelation zwischen der Ausweitung des Kreises der Wahlberechtigten und den Wahlerfolgen umverteilend-kollektivistischer Parteien. Ein ähnliches Phänomen hatten die alten Griechen in ihren Stadtstaaten schon beobachtet, von daher scheint es sich um eine menschliche Konstante zu handeln, nämlich in Form des «Minimalprinzips». Der Mensch möchte – evolutionär vernünftig – möglichst viel erhalten für möglichst geringen Einsatz.
Trifft diese Disposition nun auf politische Macht, ergibt sich ein Problem: Die Politik kann aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols Zuwendungen versprechen, welche die Zuwendungsempfänger scheinbar nichts kosten. Aus deren Sicht stellt sich dies vorteilhaft dar: keine Anstrengung, trotzdem Ertrag = gutes Geschäft. Darunter fallen nicht nur offensichtliche Wählerbestechungen wie die Gewährung von Kindergeld oder freier Heilsfürsorge, demnächst vermutlich das bedingungslose Grundeinkommen, sondern auch gesetzliche Regelungen, die eine Interessengruppe wünscht, z.B. Kündigungsschutzvorschriften oder das Verbot der Kernenergie. Alle kurzfristigen Vorteile, Zeitgeistmoden, gegenleistungslosen Versprechen und dergleichen «Gratis»-Angebote der Politik werden früher oder später von der Mehrheit nachgefragt. In der Theorie kann man dieses Problem mittels Einsatzes der Vernunft und Überzeugungsarbeit bewältigen, in der Praxis ist das Minimalprinzip stärker. Politiker oder Regenten, die Leistungskürzungen befürworten, werden über kurz oder lang abgewählt oder ausgetauscht. Otto von Bismarck, der Erfinder des Sozialstaates, bezeichnete diesen folgerichtig als «Staatssozialismus». Am Ende seines Lebens zog er folgendes Fazit: «Es ist möglich, dass unsere Politik einmal zugrunde geht, wenn ich tot bin. Aber der Staatssozialismus paukt sich durch. Jeder, der diesen Gedanken wieder aufnimmt, wird ans Ruder kommen.»
Gegen dieses evolutionär angelegte Anreizsystem mit Argumenten anzugehen, ist aussichtslos. Aufgrund dessen sind liberale Parteien praktisch immer in der Defensive, insbesondere wenn sie für weniger Staatseingriffe plädieren. Unser Dilemma lautet: Wollen liberale Parteien überleben, müssen sie sich letztlich zwangsläufig in Umverteilungsparteien wandeln. Insofern kann man den liberalen Mandatsträgern nicht einmal einen Vorwurf machen. Sie können nicht anders, oder sie sind bald keine Mandatsträger mehr.
Die Anpassungswilligen bleiben, die anderen gehen. Daher entwickelt sich jede Massendemokratie, egal ob direkte oder parlamentarische Demokratie, zwangsläufig über kurz oder lang zu einem Umverteilungsstaat. Auch die Staatsquote der Schweiz kennt seit über hundert Jahren trotz eines Knicks nach dem Zweiten Weltkrieg nur eine Richtung: nach oben (1910: 14 Prozent, heute: 33 Prozent).
Ich befürchte, dass viele «Liberale» heute schon so konditioniert sind, dass sie gar nicht bemerken, dass durch Umverteilungsgesetze und staatliche Meinungsverbote liberale Prinzipien mit Füssen getreten werden. Lassen Sie uns diese Prinzipien daher wieder in Erinnerung rufen.
«Unser Dilemma lautet:
Wollen liberale Parteien überleben,
müssen sie sich letztlich zwangsläufig
in Umverteilungsparteien wandeln.»
Zurück zu liberalen Grundprinzipien
Im Familienkreis ist es möglich, zwischenmenschliche Beziehungen nach dem Modell der liebenden Fürsorge zu gestalten. Dieses Modell eignet sich jedoch nur zur Gestaltung kleinster sozialer Räume unter Menschen, die sich gut kennen. Die Übertragung auf Beziehungen in anonymen Massengesellschaften ist eine eklatante Überforderung des Menschen und daher zum Scheitern verurteilt.
Klammert man also dieses eher private Modell des Zusammenlebens aus, dann bleiben in grösseren Gesellschaften nur noch zwei Möglichkeiten, die Beziehung zu anderen Menschen zu gestalten: entweder nach dem Modell der freiwilligen Zusammenarbeit oder nach dem Modell von Zwang und Gewalt. Da niemand gerne Zwang und Gewalt gegen sich angewandt sehen möchte, hat man sich im Laufe der Jahrhunderte darauf verständigt, Zwang und Gewalt grundsätzlich zu ächten. Allerdings verbleibt ein Problem: Nicht alle schliessen sich dieser Ächtung an. Einige bleiben gewaltbereit und ziehen die Beherrschung anderer einer gleichberechtigten Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis vor.
Das Problem lässt sich nur im Wege eines kleineren Übels beheben, nämlich dadurch, dass die Gewaltbefürworter unter Androhung von Gewalt gezwungen werden, von ihrer Gewaltbereitschaft Abstand zu nehmen. Das ist die Idee des klassisch-liberalen Rechtsstaats: Der Staat hat ein Gewaltmonopol, übt dieses aber nur dort aus, wo es absolut notwendig ist, nämlich zum Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum vor den Gewaltbereiten. Dadurch wird erreicht, dass das Modell der freiwilligen Zusammenarbeit sich auf allen anderen Gebieten möglichst breit entfalten kann. Dieser Schritt, mit dem die menschliche Kooperation den Bereich sozialer Nahbeziehungen und willkürlicher Gewaltherrschaft hinter sich liess, war ein entscheidender Meilenstein in unserer zivilisatorischen Entwicklung. Letztlich schuf er die Voraussetzungen für die industrielle Revolution, welche die Lebensqualität und Lebenserwartung für den Durchschnittsmenschen in vorher nie gekannte Höhen schraubte. Die von Karl Marx vorausgesagte Verelendung ist hingegen nicht eingetreten.
All das sind keine neuen Erkenntnisse, sie finden sich bereits bei klassischen Denkern wie John Locke, Wilhelm von Humboldt oder Ludwig von Mises. Oder auch beim Vater des deutschen Wirtschaftswunders, Ludwig Erhardt, demzufolge die Probleme beginnen, wenn der Staat aufhört, Schiedsrichter zu sein, und anfängt, selber mitzuspielen. Freilich wird diese Erkenntnis regelmässig missachtet, weil es im Sinne des Minimalprinzips so attraktiv ist, seine Probleme von der Politik lösen zu lassen.
Leider wird genau dieses Verhalten von der Mehrheit nachgefragt. Liberale Politik erschöpft sich daher zwangsläufig in Rückzugsgefechten. Ginge es nicht auch mit 10 Prozent weniger Wahnsinn beim Umwelt-, Klima- und Ernährungsfuror? Wäre es nicht besser, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, anstatt diese sofort abzuschalten oder gar zu sprengen, wie in Deutschland geschehen? Könnten wir die Verpflichtung zur Gendersprechweise auf öffentliche Stellen beschränken? Sollten wir die zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Internetzensur, Rassismus- und Antidiskriminierungsparagrafen nicht ein bisschen abschwächen? Schlimmeres zu verhindern ist aber kein Programm, mit dem man viele Anhänger mobilisieren kann. Die Rechtfertigung lautet meist, das wäre eine zeitgemässe Anpassung des Liberalismus. Politik sei die Kunst des Machbaren, mehr ginge eben nicht. Anpassung ist jedoch hier tatsächlich Verrat an den eigenen Grundideen.
Zwischen Freiwilligkeit und Zwang gibt es keinen dritten Weg, es gibt nur ein Entweder-oder: «Der Preis der Freiheit ist Freiwilligkeit» (Gottlieb Duttweiler). Das war schon vor tausend Jahren so und wird auch in weiteren tausend Jahren nicht anders sein. Wer also staatlichen Zwangsmassnahmen jenseits der klassisch-liberalen Staatsaufgaben das Wort redet, hat bereits liberale Positionen aufgegeben. Wurde das Grundprinzip aber einmal geräumt, dann gibt es kein Halten mehr. Wer als Liberaler in die Politik geht, ist bald keiner mehr. Ein jeder möge sich selbst fragen, was wahrscheinlicher ist: dass die Staatsquote der Schweiz wieder auf 14 Prozent sinkt oder dass sie auf über 50 Prozent steigt? Eben.
Bringen wir neue Angebote auf den Markt!
Stellen Sie sich vor, jedes neue Produkt bedürfte der Zustimmung der Mehrheit. Würden wir dann im Wohlstand leben? Gäbe es Elektrizität, Autos, das Feuer? Oder hätten Demagogen erfolgreich Abstimmungsmehrheiten verhindert, durch die Heraufbeschwörung von Gotteszorn, Vernichtung von Arbeitsplätzen oder Gefahren für Leib und Leben?
Wir kommen daher einer Lösung auf die Spur, indem wir den Marktgedanken einfach auf unser Zusammenleben übertragen. Statt einen aussichtslosen politischen Kampf um die Mehrheit zu führen, treten Liberale und Libertäre besser für neue «Produkte» auf dem «Markt des Zusammenlebens» ein, über die dann mit den Füssen abgestimmt werden kann. Das geschieht zunächst durch die Schaffung von Nischensystemen, an denen die Teilnahme freiwillig ist und die im Erfolgsfalle Nachahmung finden. Das ist kein leichtes Unterfangen, aber immer noch sehr viel einfacher, als eine Mehrheit von liberalen Ideen zu überzeugen.
So hatte Hayek bereits 1976 die Entkoppelung des Geldes vom staatlichen Monopol gefordert. Diese findet nun seit 2009 tatsächlich statt, nämlich durch Bitcoin und andere Kryptowährungen, und zwar ohne dass die Staaten eine ausdrückliche Genehmigung dafür erteilt hätten.
Gerade ein dezentralisiertes Gemeinwesen wie die Schweiz hat Möglichkeiten, im Rahmen der Gemeinde- und Kantonsautonomie neue Dinge zu versuchen. Auch ist es leichter, regionale Mehrheiten für solche Freiheitsexperimente zu gewinnen. Nötigenfalls müssen die entsprechenden Befürworter umziehen, um entsprechende Mehrheiten zu schaffen. Das klingt ungewohnt, aber eine derartige politische Segregation hat anderswo längst begonnen. Als die amerikanische Stadt Minneapolis kürzlich entschied, ihre Polizei abzuschaffen und durch etwas anderes zu ersetzen, wurde beiläufig bekannt, dass sich die zwölf Ratsmitglieder wie folgt zusammensetzen: elf Demokraten und ein Grüner. Mit anderen Worten: In dieser Stadt gibt es längst keine Republikaner mehr! Diese sind nämlich schon in Gegenden gezogen, die ihren Einstellungen eher entgegenkommen. Ist das schlecht? Keineswegs. Menschen sind verschieden und bevorzugen deshalb auch ein verschiedenes Umfeld. Besser eine Trennung beizeiten als ein andauernder versteckter oder offener Bürgerkrieg.
Liberale haben erkannt, dass nur eine freiheitliche Ordnung Frieden und Wohlstand schaffen kann. Sie müssen daher Systeme schaffen, in denen es nicht oder nur schwer möglich ist, sich mit Hilfe von Politikern das Geld der anderen in die Tasche zu wählen oder die Mitmenschen in ihrer Lebensgestaltung zu bevormunden. Gerade in Zeiten der Einschränkungen von Grundrechten und zunehmender Planwirtschaft erscheint das Ideal des grossen badischen Liberalen Roland Baader wieder attraktiv: «Lasst mich einen festen, eindeutigen und ein für alle Mal fixierten Steuersatz zahlen, und bezahlt damit angemessene Sicherheitskräfte und ein verlässliches Rechtswesen, aber haltet Euch ansonsten heraus aus meinem Leben. Dies ist mein Leben; ich habe nur eines, und dieses eine soll mir gehören.»
Wie kann ein solches System angesichts der aufgezeigten Tendenz zum Umverteilungsstaat Bestand haben? Dazu gibt es eine Fülle von Vorschlägen. Etwa die Idee von Markus Krall1, dass Empfänger staatlicher Gelder für die Dauer ihres Transferbezugs vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das betrifft etwa Politiker, Staatsangestellte, Subventionsempfänger und Sozialhilfebezieher. Die solchermassen Betroffenen können ihr Wahlrecht jederzeit wiedererlangen durch den Verzicht auf die entsprechenden staatlichen Leistungen.
Eine andere Idee des kalifornischen Rechtsprofessors Tom Bell2 geht dahin, das demokratische Verfahren in zwei Bereiche aufzuspalten. Der erste Bereich zur Schaffung neuer Regeln funktioniert wie eine Aktionärsdemokratie, d.h. die Stimmenanzahl richtet sich nach der Höhe des Steueraufkommens. Als Korrektiv besteht für die Gesamtbevölkerung aber die Möglichkeit, im Rahmen einer Volksabstimmung, in der jede Stimme gleich zählt, jedes neue Gesetz abzulehnen. Der Mehrheit kommt aber kein eigenes Gesetzesvorschlagsrecht zu.
Ich habe den Vorschlag eines Bürgervertrages gemacht3, der dem einzelnen einen echten Rechtsanspruch gegen den Staat als Dienstleister gibt und der nicht einseitig abgeändert werden kann, weder durch eine Regierung, ein Parlament noch die Mehrheit. Zudem stehen Leistung (Beitrags- bzw. Steuerpflicht) und Gegenleistung (Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum) in einem direkten Gegenseitigkeitsverhältnis, d.h. es bestehen konkrete Leistungs- und sogar Zurückbehaltungsansprüche gegen den Staat bei Schlechtleistung. Die Rechtsfortbildung erfolgt nach dem Common-Law-Prinzip durch richterliche Einzelfallentscheidungen, wie es Jahrhunderte lang im angelsächsischen Raum gut funktioniert hat. Die Idee eines Bürgervertrages ist unabhängig davon, ob man Gemeinwesen als Privatrechtsordnung oder wie bisher als öffentliche Ordnung betreibt.
Viele Bürger sehen dringenden Handlungsbedarf, das erfahre ich wöchentlich durch entsprechende Zuschriften. Auch wenn wir insgesamt eine kleine Minderheit sind: Eine kritische Masse bekäme man allemal zusammen. Wir sollten mit der Schaffung von freiwilligen Alternativsystemen freilich nicht zu lange warten, denn der Zug fährt derzeit mit zunehmender Geschwindigkeit genau in die entgegengesetzte Richtung.
Markus Krall: Die bürgerliche Revolution. Stuttgart: Langen Müller, 2020. ↩
Tom W. Bell: Your Next Government?: From the Nation State to Stateless Nations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ↩
Titus Gebel: Freie Privatstädte. Mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt. Walldorf: Aquila Urbis, 2018. ↩