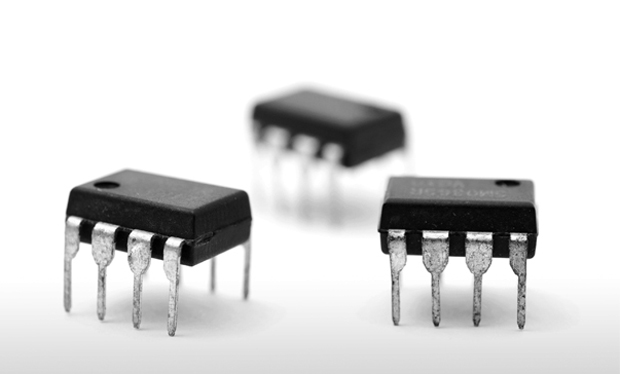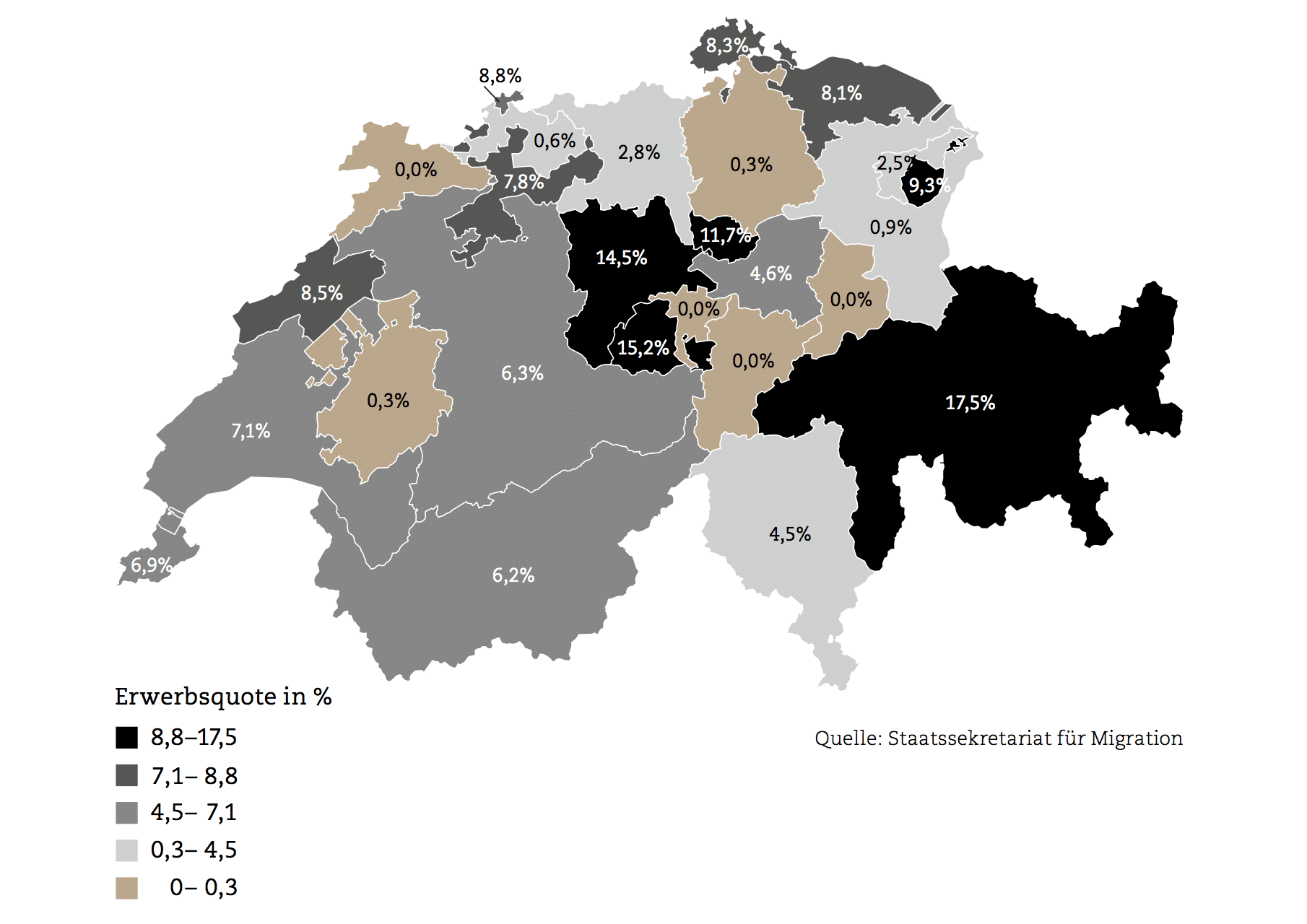Menschheitsgeschichtlicher Quantensprung
Milliarden von kleinen Computern wirken im Hintergrund. Sie erleichtern das Leben selbst des grössten Technikskeptikers, ohne dass dieser etwas davon merkt. Und sie werden unser Zusammenleben weiter revolutionieren. Bleibt der Mensch Herr der Technik?

Herr Gunzinger, Sie haben 1992 den schnellsten Computer der Schweiz gebaut und sind mit diesem Gerät an der Schnellcomputer-WM auf dem zweiten Platz gelandet. Welchen Rang würde das damalige Modell heute erreichen?
Der Computer würde es gar nicht mehr ins Klassement schaffen! Als Faustregel gilt: Nach 10 Jahren findet sich ein einstiges Siegermodell im hintersten Bereich der Top-500. Und dort endet dann auch die Statistik; was langsamer ist, fällt raus. Nach weiteren 10 Jahren aber taucht das Gerät wieder auf, und zwar auf Ihrem Schreibtisch. Denn was wir vor 20 Jahren als Supercomputer gebaut haben, kaufen Sie heute für ein paar hundert Franken im Mediamarkt.
Das heisst: Die Technologie entwickelt sich zwar rasend schnell, wir Endnutzer arbeiten aber gewissermassen mit vorgestrigem Material. Weshalb dieser Rückstand?
Das ist vornehmlich eine Frage des Preises. Nehmen Sie zum Beispiel die Kamerasysteme in den Handys. Diese Technologie hat es schon vor Jahrzehnten gegeben. Nur wäre es damals, wo die zugehörigen Sensoren noch 10 000 Franken kosteten, nicht möglich gewesen, sie zu verbreiten. Jetzt, da der Preis eines Sensors auf 5 Franken gesunken ist, kann man sie der Masse anbieten. Ich sehe das bei der Entwicklung von Fahrassistenzsystemen gerade auch an einem eigenen Projekt. Die Idee für einen Computer, der Hindernisse erkennt und Autos bremsen oder ausweichen lässt, hatten wir an der ETH. Und jetzt, 20 Jahre später, kommt die Sache auf den Markt – weil sich der Preis seit meiner Studienzeit um Faktor 1000 reduziert hat, während die Qualität um Faktor 100 gestiegen ist.
Die Informatikinnovationen, die wir als revolutionäre Erscheinungen wahrnehmen, sind für Sie als Fachmann also nichts als absehbare Weiterentwicklungen. Gibt es im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte dennoch Neuerungen, die selbst den Experten überrascht haben?
Rein technologisch gesehen war da tatsächlich nichts, was nicht erwartbar gewesen wäre. Niemals vorausgesehen hätte ich aber die Massenverbreitung des Internets, das ja auf einer Kommunikationstechnologie des US-Militärs basierte und als internes Arbeitswerkzeug der European Organization for Nuclear Research (CERN) in Genf konzipiert worden war. Geradezu revolutionär ist in meinen Augen sodann die Linux-Bewegung: Dass Tausende von Leuten ohne Koordination gemeinsam an der Entwicklung von Systemen arbeiten, ist ein menschheitsgeschichtlicher Quantensprung! Und zuletzt haben mich vor allem die Möglichkeiten auf dem Gebiet der Sensorik überrascht. Hier hat der erwähnte Preissturz die Türe für eine Unzahl früher unvorstellbarer Anwendungen geöffnet.
Auf diesem Feld der ungeahnten Anwendungen spielt heute auch Ihre Firma. Als Sie ins Informatikgeschäft eingestiegen sind, haben Sie auf etwas vergleichsweise Unspektakuläres gesetzt und Computer gebaut. Weshalb sind Sie von der Hardwarefabrikation abgekommen?
Ich muss vorausschicken, dass ich von Unternehmertum keine Ahnung hatte, als ich meine Firma gründete. Ich dachte, Technologie sei alles… Dass das Geschäft unter diesen Voraussetzungen überhaupt überlebt hat, ist reiner Zufall. Wäre ich beim Computerbau geblieben, wäre aus dem Zufall bestimmt ein Zusammenfall geworden. Eine Firma erfordert enorm viel unternehmerisches Wissen, und mir wurde schnell klar, dass mich das Verkaufen von Computern – und darauf läuft das Bauen letztlich hinaus – zu wenig interessiert. Sei es der beste Computer der Welt: Ich will den nicht verkaufen. Ich will Lösungen heraustüfteln.
Eigentlich schade: Wären Sie drangeblieben, hiesse Hewlett Packard heute vielleicht Gunzinger Super und die Schweiz verfügte über eine eigene Computerindustrie. Das hatten Sie sich in den 1990er Jahren doch selber gewünscht?
Ja, aber heute ist mir klar, dass das nicht hätte klappen können. Erstens ist die Schweiz keine Marketingnation, und Marketing ist für den Verkauf von Computern das A und O. Apple oder HP sind ja vor allem Marketingmaschinen, die Allerweltstechnologien verkaufen. Und zweitens ist die Schweiz keine visionäre Nation. Unsere Kernkompetenz ist die Perfektionierung. Während die Amerikaner grosse Visionen haben und freche Versuche wagen, sind die Schweizer darauf spezialisiert, solche visionären Prototypen zu verfeinern und auf höchsten Qualitätsstandard zu bringen.
Wie hat denn die visionslose Schweiz zu einem weltweit führenden IT-Forschungsplatz werden können? An der ETH sind doch immer wieder grosse Ideen entstanden, nur wurden die dann anderswo kommerzialisiert. Mangelt es den hiesigen Informatikern nicht eher an Wagemut als an Visionen?
Das klingt jetzt so, als entstünde in der Schweiz gar nichts. Das Gegenteil ist der Fall: Gerade rund um Zürich passiert extrem viel IT-Innovation, wir befinden uns hier mitten im Eldorado, im Herzen der europäischen Wertschöpfung! Sie glauben gar nicht, was hier, im Umkreis von rund 100 Kilometern, alles an innovativen kleineren und mittleren Unternehmen siedelt; da reiht sich Perle an Perle! Nur: wir sprechen hier ausschliesslich von Nischen. Es werden keine Smartphones entwickelt, über die die Medien dann berichten, sondern es werden Spezialchips für Billighandys oder Papierfalzmaschinen konzipiert, für die sich keine Öffentlichkeit interessiert. In diesen Nischen aber sind die Schweizer nicht nur visionär, sondern häufig auch marktbeherrschend.
Man besetzt die Nischen, etwas Grosses, wie Google, bringt man aber nicht hervor – obwohl doch gerade hierfür an den Hochschulen Forschungen bereitgestanden hätten.
Natürlich waren grosse Ideen da, wir können ja auch denken. Wir tun das aber nicht in grossspurigen Formaten. Das ist einerseits eine Frage der Dimensionen – der Schweizer Markt ist mit seinen sieben bis acht Millionen Leuten nun mal sehr klein. Andererseits ist es aber auch eine Frage des Interesses. Die Technologie, die hinter Google steckt, brächte jeder einigermassen vernünftige ETH-Absolvent zustande, und solche konkreten Anwendungen machen nur einen kleinen und verhältnismässig banalen Teil dessen aus, was wir in der Branche unter Informatik verstehen. Die allermeisten Computer arbeiten unsichtbar im Hintergrund.
Wo denn zum Beispiel?
Überall, in der Küchenwaage genauso wie im Bancomaten. Ein Auto etwa ist eigentlich ein fahrender Multicomputer, es besteht zu 30 bis 40 Prozent aus Automatik und Elektronik; Hunderte von Computern sorgen dafür, dass von ABS bis Zentralverriegelung alles so funktioniert, wie wir es uns gewohnt sind. Kurzum, es gibt heute fast kein Produkt mehr, das ohne Informatik auskommt. Während es weltweit etwa eine Milliarde PC gibt, wirken rund 20 Milliarden Computer im Verborgenen – Tendenz steigend.
Indem sie auf diesen Hintergrundmarkt setzt, scheint die Schweizer Informatik also für die Zukunft nicht schlecht aufgestellt zu sein. Wo sonst orten Sie wirtschaftliches Potential?
Das Thema der Zukunft lautet Ressourceneffizienz. Das Land, das sich in diesem Bereich entwickelt, wird bald gut dastehen. Mit Hilfe computergesteuerter Regelungen lässt sich beispielsweise an gewissen Gebäuden bis zu 40 Prozent Wärmeenergie sparen. Ähnliches gilt für die Nahrungsmittel, wo sich mit geeigneten Messtechniken die Transportverluste um einen schönen Teil reduzieren liessen. Hier liegen phänomenale Potentiale, und hier werden sich riesige Märkte öffnen, auf denen die Informatik die entscheidende Rolle spielen wird.
Dehnen wir den Blick auf die Zukunft etwas aus: Was wird die Informatik uns Nutzern bringen? Wo steht die Welt informationstechnologisch in 100 Jahren? Wagen Sie als voraussehender Fachmann eine Prognose!
Das kann ich nun wirklich nicht. Was sich im Laufe der Zeit gesellschaftsweit durchsetzen wird, ist unmöglich abzuschätzen. Persönlich bin ich ein überzeugter Anhänger des altmodischen Gesprächs und hoffe, dass diese Kommunikationsform in 100 Jahren noch besteht und der Austausch von Mensch zu Mensch auch im 22. Jahrhundert die Basis des Zusammenlebens bildet.
Die Frage wäre dann, über welche Medien dieser Austausch stattfindet. Die Entwicklungen scheinen in Richtung einer Verschmelzung des Menschen mit der Technik zu gehen; seit längerem schon ist etwa die Rede von Retinaldisplays, die Informationen direkt ins menschliche Auge projizieren. Werden wir 2112 via eingepflanzte Chips direkt von Hirn zu Hirn kommunizieren?
Dass es zunehmend zu einer Verschmelzung kommt, ist tatsächlich möglich. Es gibt bestimmt Leute, die für so etwas zu haben sind – ich aber sicher nicht. Meiner Meinung nach soll die Informatik dem Menschen nützen, und wozu die Hirnkommunikation dem Menschen dienen sollte, sehe ich nun wirklich nicht. Hingegen sehe ich sehr wohl, dass ein Sensor, der Schizophrenie bekämpft, das Leben eines Menschen erleichtert. An so etwas würde ich sofort arbeiten, denn das entspräche meiner tiefsten Überzeugung, ja meinem Mantra, das da lautet: Die Informatik muss im Dienste des Menschen stehen.
An die Dienste der Informatik gewöhnt sich der Mensch immer stärker, das heisst, wir lagern immer mehr Lebensbereiche auf uns immer weniger verständliche Diener aus. Das steigert nicht nur unsere Abhängigkeit, sondern lässt uns die Welt geradezu zur Blackbox werden.
War sie denn jemals etwas anderes? Ich glaube nicht. Durch die Konfrontation mit offensichtlich Unverständlichem verstehen wir letztlich einfach besser, dass wir sehr wenig verstehen von all den Dingen, von denen wir dauernd und ganz selbstverständlich abhängen: Jede Sekunde, die Sie zu Hause sitzen, hängt Ihr Leben vom rätselhaften Wissen des Ingenieurs ab, der Ihre Wohnung – hoffentlich – stabil konstruiert hat. Und wenn Sie den Kühlschrank öffnen, wissen Sie weder etwas über dessen Funktionsweise noch haben Sie eine Ahnung von den zahllosen automatisierten Prozessen, die hinter der Milchtüte stehen, die Sie darin aufbewahren.
Einverstanden. Nur verhalten sich Kühlschrank und Milch in der Regel recht zurückhaltend. Weder kommunizieren die beiden mit mir noch tun sie das untereinander, weder der eine noch die andere hat also bisher den Anspruch erhoben, smart zu sein. Mit dem Vormarsch «intelligenter» Systeme jedoch erhält das alltägliche Unverständnis eine neue, leicht unheimliche Qualität: Wird uns die Technik dereinst überflügeln?
Nein. Man darf sich ihr nur nicht unterwerfen! Alles hängt davon ab, wie wir uns der Technik gegenüberstellen. Folglich gibt es eine ganz einfache Lösung, das Unbehagen auszuräumen: Benutzen Sie jene Technologien, die Ihnen dienlich sind, und lassen Sie den Rest beiseite. Das ist im Umgang mit der Informatik überhaupt das Allerwichtigste: Wir Menschen müssen Meister über unsere Entscheidungen bleiben.