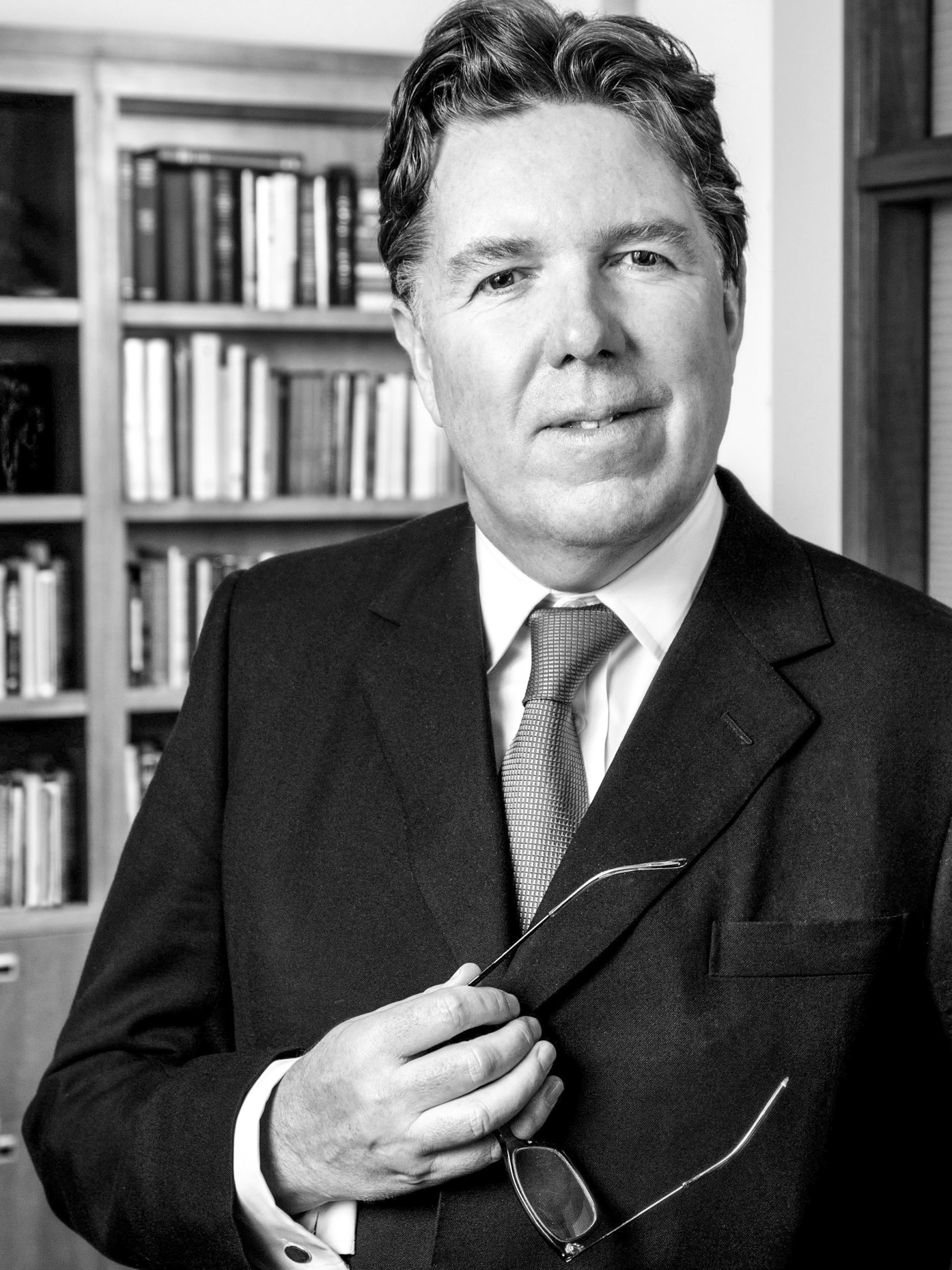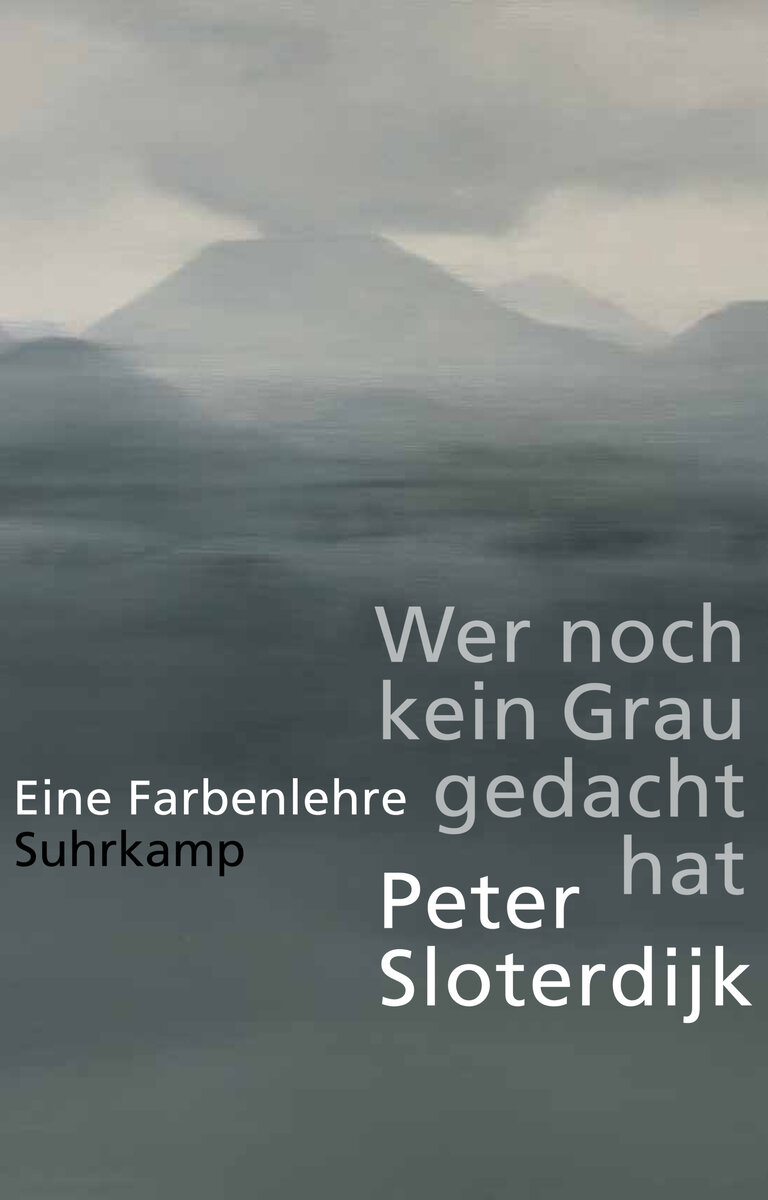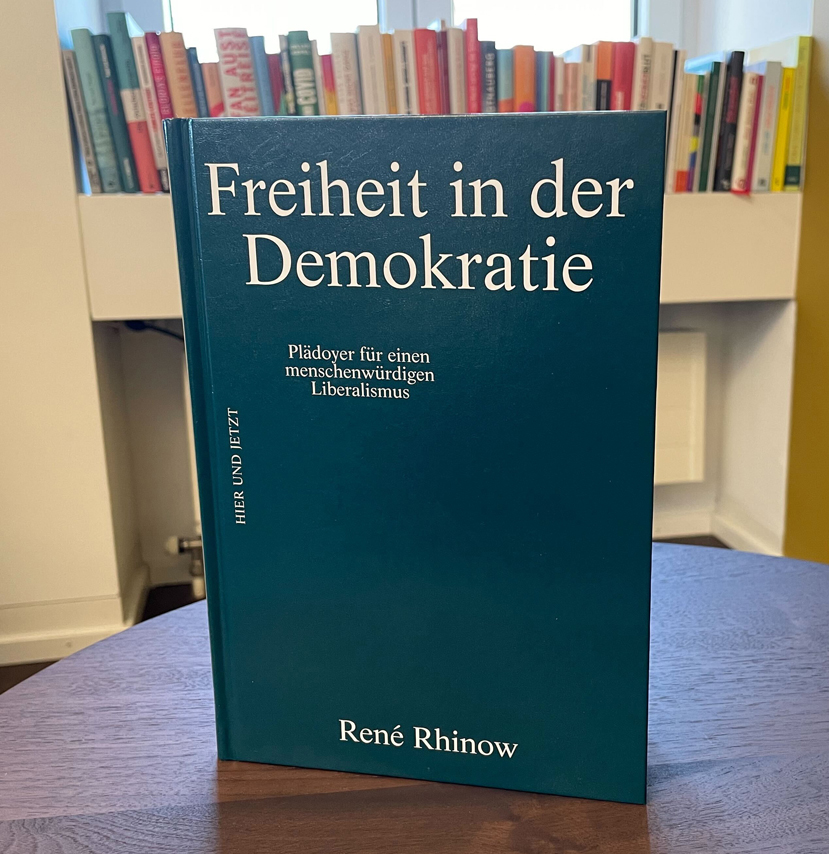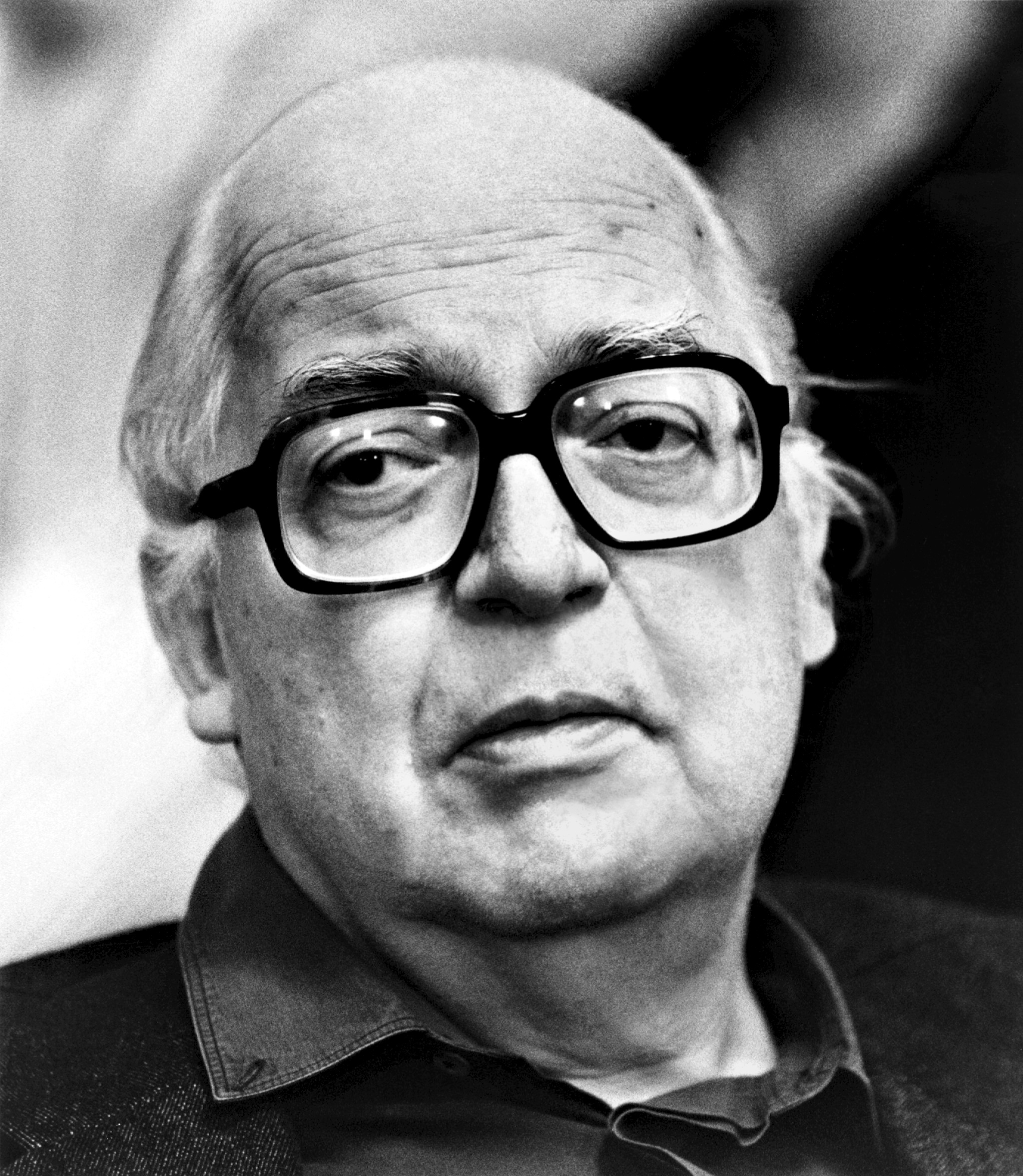Das Schwierigste kommt erst
Interventionen am Devisenmarkt gehören in den ständigen Werkzeugkasten der Schweizerischen Nationalbank. Wichtig ist aber auch, dass sie ihre Überlegungen offener erklärt.
Der durchschlagende Erfolg der Schweizer Wirtschaftspolitik lässt sich am Schweizer Franken ablesen: Es ist hierzulande möglich, mit einem 142jährigen 10-Rappen-Stück nach wie vor eine Süssigkeit am Kiosk zu kaufen. Die Glaubwürdigkeit des Frankens ist einmalig und beruht auf der Kombination von stabilen Institutionen, dem Ausbleiben von Kriegen, der innovativen und damit sehr wettbewerbsfähigen Wirtschaft, einem sparsamen Staat und einer langfristig orientierten Geldpolitik.
Auch ohne Beteiligung an Kriegen war das Umfeld für die Schweiz zu gewissen Zeitpunkten alles andere als einfach. Drei heikle Phasen stechen hervor: Die Zwischenkriegszeit war durch eine ausgeprägte Instabilität der Weltwirtschaft gekennzeichnet. Dies führte in der Schweiz aber nicht wie in anderen Ländern zu vermehrten Staatseingriffen, sondern schuf gemäss den Wirtschaftshistorikern Michael Bordo und Harold James die Grundlage für eine Stabilitätskultur, konkret eine Präferenz für eine zurückhaltende Wirtschaftspolitik und einen starken Franken. Die nächste stürmische Periode folgte in den frühen 1970ern: Nach Aufhebung des fixen Wechselkurssystems wertete der Schweizer Franken deutlich auf – um jährlich etwa 10 Prozent. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) begleitete diese turbulente Periode mit eher zahnlosen Massnahmen zur Bekämpfung der Aufwertung. Mit der Finanzkrise von 2007 und 2008 trat die SNB in die nächste schwierige Phase ein: Globale Unsicherheiten und massive Stützungsprogramme liessen die Nachfrage nach Franken markant ansteigen – stärker noch als in den 1970er-Jahren. Dies veranlasste die SNB, ihre Zurückhaltung aufzugeben und mit massiven Deviseninterventionen für die aus ihrer Sicht richtigen geldpolitischen Bedingungen zu sorgen. Unter anderem verhinderte ein von ihr gesetzter Mindestkurs eine zu schnelle Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro.
Coronakrise verändert Ausgangslage
Die anspruchsvollsten Jahre stehen aber erst noch an – es zeichnet sich nämlich eine vierte brenzlige Phase ab. Die Coronakrise hat in den Industrieländern zu einer nie dagewesenen Flut fiskal- und geldpolitischer Unterstützung geführt. Staaten verschuldeten sich enorm, verteilten das Geld an die Bevölkerung und liessen sich dies durch die Zentralbanken finanzieren. Die Inflationsraten im Ausland sind jüngst stark angestiegen. Bleiben sie hoch – was durchaus ein realistisches Szenario darstellt –, so werden die Zentralbanken weltweit in die Zwickmühle geraten.
Mit höheren Zinsen lässt sich eine hohe Inflation zwar glaubwürdig bekämpfen, gleichzeitig werden damit aber auch viele Ungleichgewichte ans Licht gebracht. So kann die US-Zentralbank bei Turbulenzen nicht mehr wie bisher die Finanzmärkte zuverlässig stützen. Im Gegenteil: Die nötigen Zinsanstiege führen sogar zu tieferen Bewertungen vieler Anlageklassen. In der Eurozone könnten die Märkte erneut an der Zahlungsfähigkeit einiger Staaten zweifeln. Die Europäische Zentralbank wird nicht mehr mit Anleihekäufen in Milliardenhöhe einspringen können, weil diese bezüglich Inflation eben nicht mehr «gratis» sind. In solchen Situationen wird der Druck auf den Franken erneut stark zunehmen.
Damit beginnt die nächste heisse Phase für die Schweiz und die SNB als Währungshüterin, die direkt von den Entwicklungen im Ausland betroffen ist. Wie kann sich die SNB wappnen, damit sie die Erfolgsgeschichte der Schweizer Wirtschaftspolitik auch in dieser Phase weiterführen kann?
In eigene Glaubwürdigkeit investieren
Erstens wird es für die SNB eine Herausforderung sein, das eigene Mandat der Preisstabilität zu erfüllen. Inflation hat viel mit psychologischen Prozessen, spezifisch mit Vertrauen und Erwartungen, zu tun. Eine glaubwürdige Ausrichtung auf tiefe Inflation ist daher entscheidend. Die SNB profitiert diesbezüglich von ihrer eigenen Geschichte: Die aktuell in der Schweiz deutlich tiefere Inflation hat – neben spezifischen Sonderfaktoren wie dem geringeren Einfluss der Energiepreise – auch stark damit zu tun, dass die Inflationserwartungen hierzulande sehr tief sind. Mit dem massiven Anstieg der Bilanz der SNB seit Ausbruch der Finanzkrise besteht aber die Gefahr, dass die glaubwürdige Ausrichtung auf tiefe Inflation zu bröckeln beginnt. Wenn die SNB die nicht tragfähige Politik anderer Zentralbanken imitieren muss, darf es nicht verwundern, wenn auch ihre Glaubwürdigkeit unter Beschuss kommt.
Die SNB wird darum in die eigene Glaubwürdigkeit investieren müssen. Dies gelingt zum Beispiel, indem sie dem Ruf aus akademischen Kreisen nach einem höheren Inflationsziel eine klare Absage erteilt. Wichtig ist aber auch, den Exportsektor darauf vorzubereiten, dass die SNB bei erneutem Aufwertungsdruck nicht mehr wie zuletzt einen Grossteil der Währungsrisiken auffängt. Die Effekte einer Aufwertung wurden auch von der SNB regelmässig überschätzt. Der Schweizer Wirtschaft dürfen Aufwertungen ruhig zugemutet werden, hat die Schweizer Exportwirtschaft doch trotz des starken Frankens seit 2009 immer wieder neue Höchstwerte erreicht.
«Die Effekte einer Frankenaufwertung wurden
auch von der SNB regelmässig überschätzt.»
Bezüglich des Immobilienmarkts ist es entscheidend, dass alle Akteure Vorkehrungen für deutlich höhere Zinsen treffen. Nur so kann die SNB sich wirklich auf ihren Auftrag der Preisstabilität konzentrieren, ohne um die Stabilität des Bankensystems zu fürchten. Schliesslich muss sich die Politik mit Forderungen nach höheren oder zweckgebundenen Ausschüttungen zurückhalten. Die SNB soll ihr Eigenkapital stärken, so dass auch grössere Verluste, die bei weiteren Aufwertungen zu erwarten sind, die geldpolitische Glaubwürdigkeit der SNB nicht in Frage stellen.
Deviseninterventionen normalisieren
Zweitens wird die Schweiz mit dem Aufwertungsdruck auf den Franken leben müssen. Im aktuellen geldpolitischen Konzept – geschrieben zur Jahrtausendwende – hat die SNB den Deviseninterventionen nur ein geringes Gewicht gegeben. Nur in aussergewöhnlichen Situationen sollte die SNB im Devisenmarkt eingreifen. Seit 2009 ist die gelebte Realität jedoch eine andere: Deviseninterventionen wurden zum Alltag, und nichts deutet darauf hin, dass sich dies im laufenden Jahrzehnt wieder ändern wird. Das schmerzt die Seele jedes SNB-Vertreters – Deviseninterventionen passen eigentlich nicht zur DNA einer zurückhaltenden, den Markt möglichst wenig beeinflussenden Zentralbank. Doch mit reiner Lehre ist der Bevölkerung nicht gedient – Kompromisse müssen eingegangen werden.
Weil Deviseninterventionen in ihrem aktuellen geldpolitischen Konzept nur in aussergewöhnlichen Zeiten vorgesehen sind, muss die SNB ihre Fremdwährungskäufe derzeit stets damit begründen, dass der Franken «hoch bewertet» sei. So gesehen argumentiert die SNB also, sie befinde sich in einem ständigen Ausnahmezustand. Für die Glaubwürdigkeit der SNB wäre es besser, sie würde deutlich machen, dass Deviseninterventionen andauernd zum Arsenal gehören. Die SNB müsste die Interventionen nicht mehr mit einer aussergewöhnlichen Situation begründen. Damit könnte die SNB ihre Strategie flexibler an die Umstände anpassen. Gleichzeitig hat dies zum Vorteil, dass die SNB damit die Erwartungen an den Finanzmärkten klar dahingehend steuert, dass sie zu starke und schnelle Aufwertungen unter keinen Umständen toleriert.
Agile Kommunikation aufbauen
Drittens wird die SNB in zu erwartenden turbulenten Zeiten viel Flexibilität brauchen. Wichtig ist darum, dass die SNB zukünftig kommunikative Sackgassen vermeidet. Wie gefährlich eine wachsende Bilanz für die Preisstabilität ist, wie stark die Zinsdifferenz den Wechselkurs beeinflusst, wie wichtig der Wechselkurs für die Inflation ist – das sind Fragen ohne einfache Antworten. Die SNB darf ruhig vermehrt dazu stehen, dass es in diesen Fragen gute Argumente in unterschiedliche Richtungen gibt. Dies eröffnet Möglichkeiten, in späteren Situationen einen Kurswechsel zu vollziehen, ohne die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Eine etwas offenere, transparentere Kommunikation zu den Überlegungen und Abwägungen hinter den Entscheiden ermöglicht, dass Türen nicht unnötig verschlossen werden und die SNB sich so mehr Entscheidungsfreiheit vorbehält.
Vieles deutet darauf hin, dass die Schweiz in den nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen stehen wird. Die SNB ist gut aufgestellt – sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen, wird aber nicht reichen. Um trotz schwierigen Umfeldes agieren zu können und nicht nur reagieren zu müssen, werden Investitionen in die eigene Glaubwürdigkeit, eine Anpassung des geldpolitischen Konzepts hinsichtlich der Bedeutung von Deviseninterventionen und eine agilere Kommunikation zentral sein.