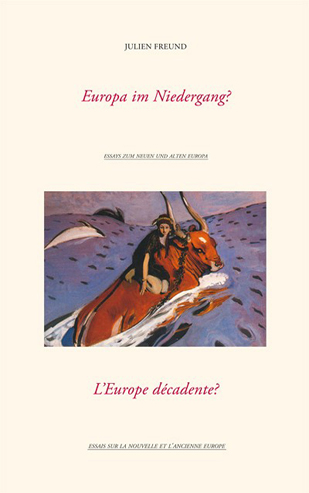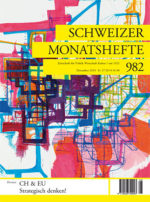Verfassungsform des Zweifels
Unumstössliche Wahrheit oder ergebnisoffener Suchprozess? Eine Demokratie kann sich als beides verstehen. Aber sie kann nicht beides sein. So oder so: die Entscheidung obliegt den Bürgern – und die können sich täuschen.
«We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty and the pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed.»
Es lohnt sich, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung in jener klangvollen Sprache zu lesen, in der sie 1776 niedergeschrieben wurde. In der Stunde ihrer Geburt tritt die neuzeitliche, von Menschenrechten hergeleitete Demokratie mit dem Anspruch in die Geschichte ein, ganz einfach einer Wahrheit zu entsprechen – einer Wahrheit, die weder der Erläuterung noch der Rechtfertigung bedarf. Zur Wahrheit gibt es keine vernünftige Alternative.
Der bewusst proklamierte Anspruch auf selbst-evidente Unumstösslichkeit erklärt sich nicht zuletzt aus dem Umstand, dass er in eine Welt hinausgetragen wurde, die überwiegend anders dachte. Im Zuge der Französischen Revolution wurde er aufgenommen und verstärkt. «Wenn doch diese heilbringenden Wahrheiten nicht auf unseren engen Raum beschränkt blieben!», rief Robespierre im November 1793 dem Nationalkonvent zu – und stellte die offizielle Zeitrechnung auf null: ein neues Zeitalter sollte beginnen.
Heute mag das Wahrheitspathos weniger geworden sein. Der demokratische Anspruch aber – «truth, self-evident» – wird weniger in Frage gestellt als damals, vor zweihundert Jahren. Im Gegenteil: die von Menschenrechten hergeleitete Demokratie ist zum dominierenden politischen Glaubensbekenntnis unserer Zeit geworden. Kein anderes Verfahren, kein anderes Prinzip spendet so viel Legitimität. Menschenrechte und Demokratie sind normative Wahrheiten schlechthin – als solche automatisch «gut» und dem Druck entwachsen, ihren Wahrheitsanspruch zu begründen. Eine vernünftige Alternative gibt es nicht.
Ein auf Wahrheit und Wahrheiten gründendes Demokratieverständnis bleibt nicht ohne Folgen. Ihm entspricht unter anderem ein Politikverständnis, das die Festschreibung konkreter Ziele in der Verfassung auch dann als legitim betrachtet, wenn solche Festschreibungen eine graduelle Schliessung des demokratischen Prozesses bedeuten. Problematisch wird es, wenn geteilte normative Gewissheiten im Inneren einer demokratischen Gesellschaft jenen Zwang zur Konformität erzeugen, den Alexis de Tocqueville als «geistigen Despotismus» beschrieb – als ebenso sanfte wie druckvolle Form der Tyrannis. Auch hier stehen wir mitten in der Gegenwart. Die unerbittliche Praxis der political correctness wird sich nur dort entwickeln können, wo Demokratie als Ordnung der Wahrheit verstanden und umgesetzt wird. Alle Sprachgebote, alle Sprachverbote sind letztlich einem Normbestand verpflichtet, der nicht mehr zu bestreiten ist. Die Implikationen sind gravierend. Wer nicht spurt, wird geächtet.
Im Verhältnis einer Gesellschaft nach aussen mündet demokratische Selbstgewissheit nicht ungern ins Bewusstsein, «dass wir nicht nur für ein Volk, sondern für die Welt (kämpfen) und nicht nur für die Menschen, die heute leben, sondern für die ganze kommende Menschheit». Auch dies sind Worte Robespierres vor dem Konvent, November 1793. Nicht nur Jakobiner und Franzosen, nicht nur Woodrow Wilson und Amerikaner wollten die Welt sicher machen für Menschenrechte und Demokratie. In unserer Zeit spielt nun auch die Europäische Union mit in der Champions League jener Vereine, die das Schicksal auserwählt hat, dem Rest der Welt den Weg zu weisen. Die bei jeder sich bietenden Gelegenheit beschworene Forderung nach Demokratie braucht nicht als These behauptet, nicht mit Argumenten untermauert zu werden. In welchem Ausmass demokratische Gesinnungsethik und Wertefixierung interessenblind machen können, zeigt die noch junge Aussenpolitik der EU mit schöner Regelmässigkeit.
Demokratie als verfasste Wahrheit? – Dass eine völlig andere, gewissermassen agnostische Begründung von Demokratie zumindest eine Denktradition für sich reklamieren darf: diese Alternative hat Peter Graf Kielmansegg im Rahmen soeben erschienener Versuche zur Grammatik der Freiheit mit grosser Sorgfalt belegt. Demokratie wird – alternativ – als Verfassungsform des Zweifels gedacht. Klassische Autoren auf diesem Feld wären Hans Kelsen, Karl Popper, Ralf Dahrendorf.
Die Argumentation dieser Gruppe lässt sich am Beispiel Poppers verdeutlichen. Wenn uns kognitiv begrenzten Menschen keine Gewissheiten, sondern nur Vermutungen zugänglich sind, die überdies nur so lange Gültigkeit beanspruchen dürfen, als sie nicht widerlegt sind – dann lautet die angemessene Entsprechung für den politischen Raum: Teilung von Macht horizontal wie vertikal, sodann Befristung aller Übertragung von Macht. Weil niemand wissen kann, ob die Mehrheit recht hat, muss die Aussicht der Minderheit, selbst Mehrheit zu werden, immer offengehalten werden. Politische Institutionen müssen dafür sorgen, dass kein einzelner Lebensentwurf, keine spezifische Idee des Gerechten dauerhaft auf Kosten Dritter durchgesetzt wird.
Wahrheit oder Zweifel?
Ein prinzipiell dem Zweifel verpflichtetes Demokratieverständnis begreift Demokratie als einen ergebnisoffenen Suchprozess. In Entsprechung dazu wird die Aufgabe der Verfassung darin gesehen, unter Verzicht auf inhaltliche Zielbestimmungen den politischen Prozess als solchen zu regulieren. Nach innen wird ein so orientiertes Kollektiv aus Überzeugung bis an die Grenzen der Freizügigkeit gehen, wird es den Markt der Meinungen so offen und so weit wie möglich halten. Radikal zu Ende gedacht, scheint hier selbst die Aufhebung der Demokratie möglich, solange sie nach den Regeln der Demokratie erfolgt – ein heikler Gedanke mit heiklen Implikationen.
Wahrheit oder Zweifel: in welcher Prämisse findet Demokratie ihren angemessenen Grund? Für beide Seiten finden sich gewichtige Argumente. Ein auf Wahrheit gegründetes Demokratieverständnis wird dem Orientierungsbedürfnis des Menschen unzweifelhaft weiter entgegenkommen. Dafür steht und lebt es – über political correctness hinaus – im Schatten einer Möglichkeit, die erstmals unter Robespierre politische Gestalt annahm. Gemeint ist jakobinische, moderner ausgedrückt: totalitäre Politik, umfassender Herrschaftsanspruch aus der Kenntnis absoluter Wahrheit.
Anderseits bleibt eine der Offenheit und dem Zweifel verpflichtete Demokratiebegründung ebenfalls nicht ohne Schwierigkeiten. Eine davon ergibt sich aus der Erfahrungstatsache, dass menschliche Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit vor dem Horizont prinzipieller Ungewissheit schlicht und einfach versagt. Ohne Wahrheit, so scheint es, können wir nicht leben. Wichtig wäre von daher die ergänzende Relativierung, dass ein offenes Demokratieverständnis durchaus Raum lässt für Gewissheiten weltanschaulicher oder auch religiöser Art – aber konsequent im vorpolitischen Raum.
Wahrheit oder Zweifel? – Tatsache ist, dass keine demokratisch verfasste Gesellschaft solche Alternativen systematisch reflektiert; aus vielen Gründen sind sie im öffentlichen Bewusstsein gar nicht gegenwärtig. Tatsache ist weiterhin, dass empirische Demokratieverständnisse – im demokratisch gefestigten Westen stets das Resultat langer Geschichte – dem reinen Typus der einen oder anderen Version kaum je entsprechen. Ein Entweder-Oder wird es in der Wirklichkeit nicht geben.
Dennoch lohnt sich die gedankliche Auseinandersetzung mit beiden Varianten. Nicht zuletzt kann sie uns dabei helfen, das eigene Haus um ein Quentchen wacher zu bestellen – dort etwa, wo wir helvetisches Demokratieverständnis bewusster als auch schon auf institutionelle Bestände abtasten, die sich – irgendwann unter spezifischen Umständen entstanden – im Zuge langer Übung zu Wahrheiten haben verfestigen können, die nicht länger hinterfragt wurden. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen.
Direkt oder repräsentativ?
«Truth, self-evident» in der Schweizerischen Eidgenossenschaft: direkte Demokratie ist besser als repräsentative Demokratie. Je häufiger das souveräne Stimmvolk selbst entscheide, so das landläufige Argument, desto näher komme es dem wahren Ideal von Demokratie. Die repräsentative Demokratie erscheint dagegen als schwacher Ersatz, als unterlegener Notbehelf für Flächenstaaten, «a sorry substitute for the real thing» in den Worten des amerikanischen Demokratiewissenschafters Robert Dahl.
Es bleibt uns freigestellt, solche Gewissheit auch weiterhin mit Herzblut zu pflegen. Nur ändert das nichts an der Tatsache, dass ein hohes Mass an Fremdbestimmung immer und überall und notwendig mit im Spiel ist, wo Kollektive verbindliche Entscheidungen treffen. Die Technik der direkten Demokratie besteht darin, dieses Mass an Fremdbestimmung durch Einschluss je einzelner Bürgerstimmen eher symbolisch als tatsächlich zu minimieren. Die Verantwortlichkeit der einzelnen Stimmberechtigten lässt sich dabei zwar denken, nicht aber institutionalisieren.
Die alternative Technik der repräsentativen Demokratie besteht darin, unvermeidliche Fremdbestimmung offenzulegen, um sie als in Ämtern und Mandaten verantwortete Fremdbestimmung zu organisieren. Wer für andere entscheiden darf, der soll (in welchen Verfahren auch immer) den anderen antworten müssen. Diese repräsentative Form der Demokratie, so viel wissen wir heute gewiss, ist keineswegs als second-best solution entstanden. Sie hat ihre eigene Geschichte, und fraglos hat sie auch ihre eigene Würde.