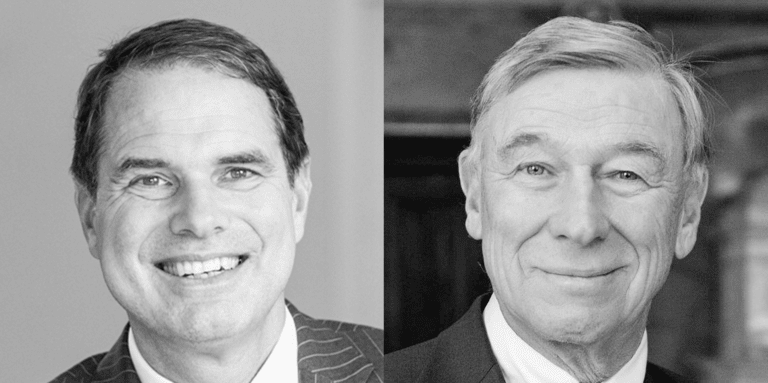Die Liberalen sollten sich auf ihre populistischen Wurzeln besinnen
Der Liberalismus war in der Schweiz einst eine Volksbewegung – heute wird er von oben verwaltet. Höchste Zeit, bewährte Tugenden wiederzuentdecken.

«Die Liebe zur Freiheit sowie der Hass gegen alle Arten des Despotismus ist der Menschheit eigen.»
Mit diesen Worten richtete sich eine Gruppe von Männern aus Stäfa 1794 an die Zürcher Obrigkeit. Sie forderten von den «teuersten Landesvätern» die politische Gleichbehandlung der Landschaft gegenüber der Stadt. Erstaunlich an dem Memorial ist nicht das Begehren an sich. Forderungen nach rechtlicher und wirtschaftlicher Besserstellung gab es in der Alten Eidgenossenschaft immer wieder.
Neu war die Begründung: Die Stäfner appellierten nicht (nur) an die Gnade ihrer Herren, sondern beriefen sich explizit auf die Rechte des Individuums. «Ein jeder Mensch ist frei geboren, und es gibt keine Ungleichheit vor dem Gesetz», heisst es im Memorial – ein damals unerhörtes Postulat. Der Einfluss der Aufklärung und der Französischen Revolution ist unverkennbar. Vielleicht deshalb reagierten die «teuersten Landesväter» in Zürich unzimperlich: Sie verurteilten die Urheber zu drakonischen Strafen, und als das den Unmut der Stäfner erst recht entfachte, besetzten sie die Gemeinde militärisch.
Doch die Saat war gepflanzt. Die neuen Ideen liessen sich nicht aufhalten. In den folgenden Jahrzehnten verbreiteten sie sich immer weiter, nicht nur in den gebildeten Schichten, sondern auch in der breiten Bevölkerung. Nachdem im Juli 1830 in Paris der autoritäre König Karl X. gestürzt worden war – erneut kam der Anstoss von aussen –, entstanden in vielen Kantonen Volksbewegungen. In Weinfelden versammelten sich die unzufriedenen Bürger an zwei «Volkstagen» im Oktober und November 1830 und verlangten eine neue, liberal-demokratische Verfassung (die schliesslich auch eingeführt wurde). Es war der Auftakt zu einer Reihe von Versammlungen mit ähnlichen Stossrichtungen.
Auch in der Zürcher Landschaft regte sich der Widerstandsgeist von Neuem. In Uster kamen am 30. November rund 10 000 Landbürger zusammen und forderten eine Verfassungsrevision. Diesmal gab die konservative Regierung nach, der Kanton Zürich erhielt eine liberale Verfassung. In einem Kanton nach dem anderen setzte sich die Regenerationsbewegung durch. Sie war eine Volksbewegung im wahrsten Sinn des Wortes. Sie stellte die Rechte und Bedürfnisse der Bürger konsequent ins Zentrum. Und sie legte den Grundstein für die Gründung des Bundesstaats 1848.
Rückzugsgefecht seit 150 Jahren
Der bürgerlich-liberale Staat in der Schweiz ist das Ergebnis einer Bewegung von unten. Auch der Ausbau der direkten Demokratie ist massgeblich eine (links)liberale Errungenschaft. Doch nach dem Sieg haben sich die Bürgerlichen auf die Bewahrung des Erreichten verlagert. Die freisinnige Politik der letzten anderthalb Jahrhunderte ist geprägt von Abwehrkampf – vor allem aber von einem elitären Zirkel, der sich vom Volk abgrenzt. Das politische Personal der FDP wie auch der anderen bürgerlichen Parteien im Bundeshaus besteht heute zu grossen Teilen aus Verbandsfunktionären, Berufspolitikern und Mandatesammlern ohne Verständnis für die Herausforderungen privater Unternehmen oder die Probleme normaler Bürger.
Man betrachte nur, wofür die Freisinnigen in den letzten Jahren Energie und politisches Kapital eingesetzt haben: mehrere erfolglose Vorlagen für steuerliche Entlastungen für Firmen, eine erfolgreiche Vorlage für steuerliche Mehrbelastung für Firmen und eine engere Anbindung an die EU. Natürlich sollen Firmen in der Schweiz gute Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit haben. Bloss: Wenn eine zunehmend etatistische Politik Preise, Mieten und Krankenkassenprämien in die Höhe treibt, sollte man als liberale Partei nicht die eigenen Prioritäten etwas hinterfragen und stärker für die Entlastung des Mittelstands kämpfen? Wenn es die Liberalen nicht tun, müssen sie sich nicht wundern, wenn unliberale Lösungen wie eine 13. AHV-Rente oder Prämiendeckel Mehrheiten finden.
Auch in der Klimapolitik irrlichtern die Liberalen. Die Energiestrategie 2050 versprach, die Subventionen zu überwinden; stattdessen wurden diese mit dem vergangenes Jahr angenommenen Klimagesetz noch ausgebaut, und im gleichen Stil geht es mit dem Mantelerlass weiter. Ob bei Energie, Gesundheit oder Altersvorsorge: Die Probleme werden mit Geld zugedeckt, und die Kosten sollen die (künftigen) Steuerzahler berappen. Mitte- und sogar FDP-Politiker denken bereits über eine Aufweichung der Schuldenbremse nach, um die vielfältigen politischen Wünsche unter der Bundeshauskuppel zu befriedigen. Höhere Steuern, höhere Schulden – das soll bürgerliche Politik sein?
Die populistischen Liberalen
Die liberalen Eliten fassen Debatten mit den Fingerspitzen an. Statt sich mit überzeugenden Argumenten in die Debatte zu werfen, beklagen sie sich über «Polarisierung» und «Populisten». Dabei kann man auch die Liberalen des frühen 19. Jahrhunderts als Populisten bezeichnen.
Der Vorwurf des Populismus ist das Totschlagargument, mit dem man Gegner attackiert, wenn man sonst keine Argumente hat. Dabei war der Begriff früher durchaus nicht negativ konnotiert. So gab es in den USA die Populist Party, die sich die Entlastung der Landbevölkerung, die Entmachtung monopolistischer Wirtschaftsinteressen und die direkte Wahl von Senatoren auf die Fahnen schrieb.
Die Regenerationsbewegung in den Schweizer Kantonen wollte die demokratische Mitsprache verbessern durch freie und faire Repräsentation. Auch Frühformen der modernen direkten Demokratie wurden eingeführt, etwa das Volksveto im Kanton St. Gallen 1831.
Wenn man die Verfolgung von Interessen der einfachen Leute und Kritik am Establishment als populistisch bezeichnet, war die Regenerationsbewegung durchaus populistisch. Das zeigte sich schon an der Reaktion der konservativen Machthaber – und selbst gemässigter städtischer Liberaler. «In den Schenken wird schändlich raisonniert», empörte sich der liberal-konservative Staatsrechtler Johann Caspar Bluntschli über die Mobilisierung in der Zürcher Landschaft im Herbst 1830. Auch Paul Usteri, der Grandseigneur des Zürcher Liberalismus, stand der Volksbewegung kritisch gegenüber, die ihm nur ein halbes Jahr später zum Bürgermeisterposten verhelfen sollte. Er und seine Getreuen versuchten, die Versammlung in Uster bis zuletzt zu verhindern. Liberale stehen sich gegenseitig im Weg – ein Schelm, wer Parallelen zur Gegenwart erkennt.
«‹In den Schenken wird schändlich raisonniert›, empörte sich der
liberal-konservative Staatsrechtler Johann Caspar Bluntschli über
die Mobilisierung in der Zürcher Landschaft 1830.»
Zugang zu Markt und Macht
Was es braucht, ist eine Rückbesinnung auf bürgerliche Tugenden. Die Volksbewegung des 19. Jahrhunderts kann dabei als Inspiration dienen.
Die Liberalen stellten damals das Individuum, den einzelnen Bürger, seine Rechte und Interessen ins Zentrum. Die äusserst zahlreichen Petitionen zur Verfassungsrevision in Zürich 1831 sind aufschlussreich: In vielen wird eine Reduktion der Belastung der Bürger durch Abgaben, eine sparsamere Staatstätigkeit und eine Liberalisierung der Wirtschaft gefordert. (Wobei zugleich staatliche Eingriffe verlangt wurden, wo sie den Petitionären materiellen Nutzen versprachen, namentlich ein Verbot von mechanischen Webstühlen.)
Eine wichtige Rolle spielte zudem die Stärkung der Kompetenzen der Gemeinden. Auch das ist eine grundlegende Idee des Liberalismus: die Beschränkung der Macht. Dazu gehören dezentrale Institutionen – also ein starker Föderalismus. Aufgaben sollten möglichst nahe bei den Bürgern erledigt werden: wenn möglich auf kommunaler, sonst auf kantonaler, wenn es nicht anders geht, auf nationaler und erst als Ultima Ratio auf internationaler Ebene.
Aus dem Respekt für den Bürger ergibt sich auch der Respekt für die Demokratie. Die Volksrechte ermöglichen den Bürgern in der Schweiz eine einzigartige Mitsprache. Doch die zunehmende Internationalisierung bringt die Demokratie unter Druck. Exemplarisch zeigt sich das beim «Rahmenabkommen 2.0», über das die Schweiz und die EU derzeit verhandeln. Es sieht vor, dass im Streitfall der Europäische Gerichtshof, also das Gericht der Gegenpartei, über die Auslegung der Verträge entscheidet. Es wäre eine weitere Machtverschiebung nach Brüssel. Sie wird von den liberalen Eliten mehrheitlich begrüsst, während sie von der liberalen Basis mehrheitlich abgelehnt wird.
Die bürgerlich-liberale Tradition in der Schweiz lässt sich in dem Credo zusammenfassen: Der Bürger soll möglichst freien Zugang zum Markt und zur Macht haben. An dieses Credo sollten sich die Liberalen erinnern – und es endlich mutiger vertreten.