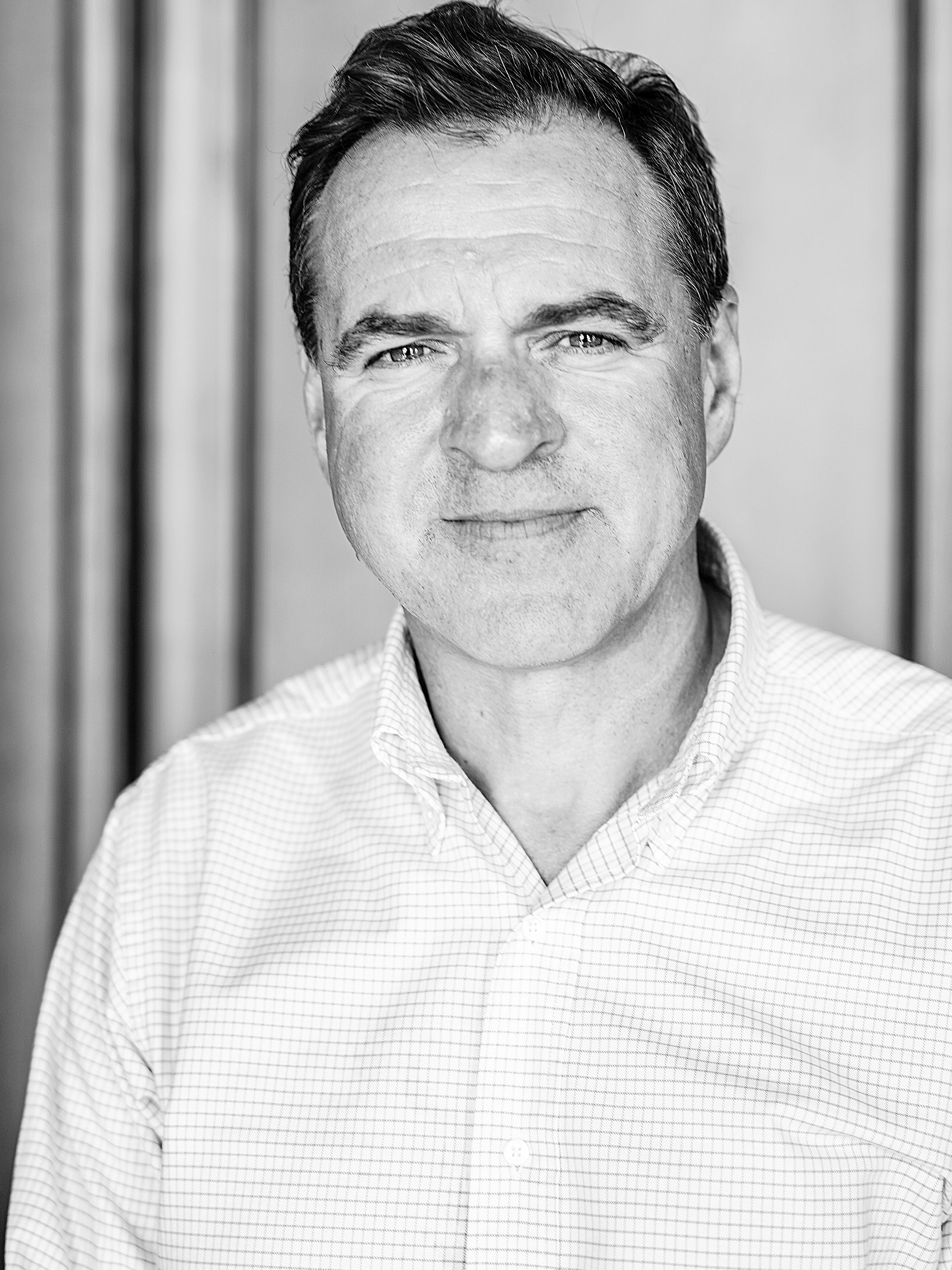«Entweder wir adressieren die Probleme selbst – oder andere übernehmen das für uns»
Die gesellschaftliche Skepsis gegenüber Stifterinnen und Stiftern ist eine Skepsis gegenüber grossen Vermögen – und diese wiederum eine Begleiterscheinung der liberalen Erfolgsgeschichte. Damit aus Skepsis aber in Kombination mit Unwissen kein Generalverdacht wird, müssen Stiftungswelt und Politik nun aktiv werden.

Herr Walti, es ist noch keine zwei Monate her, da stand die Kathedrale Notre-Dame de Paris in Flammen. Es gelang, das Feuer zu löschen, der Wiederaufbau des zerstörten Dachstocks soll bald beginnen. Mitverantwortlich dafür sind grosszügige private Spender: Schon am Tag nach dem Brand waren 900 Millionen Euro für den Wiederaufbau zugesagt. Aber die Welt, die bis eben um das Bauwerk gebangt hatte, freute sich nicht nur – im Gegenteil: Man warf den Spendern postwendend vor, die Brandkatastrophe als PR-Stunt zu missbrauchen. Was sagt uns das im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Philanthropie?
Das ist wohl Ausdruck einer ganz grundsätzlichen, gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich einer verbreiteten Skepsis gegenüber Besitz und Vermögen. Neue Kommunikationsmittel machen grossen Privatbesitz sichtbarer, und immer öfter geht es auch um die Fragen nach seinem Zustandekommen. Das betrifft sicher besonders die sogenannten Industriellenfamilien wie in diesem Fall in Frankreich, es betrifft aber auch alle anderen. Es ist vielleicht auch eine Begleiterscheinung einer durchaus positiven gesellschaftlichen Öffnung.
Inwiefern?
Noch vor einigen Jahrzehnten, mehr noch vor einigen Jahrhunderten, wurden enorme Vermögen als quasi «gottgegeben» hingenommen – wie die Stände, in denen sie ausschliesslich existierten: Sehr wenige kontrollierten praktisch alles, egal ob unter Macht- oder Vermögensgesichtspunkten. Das haben wir zum Glück hinter uns: Prinzipiell gilt heute das Leistungsprinzip mit dem Leitmotiv der Chancengerechtigkeit, und die Kombination aus beidem öffnet zunächst einmal den allermeisten Menschen grundsätzlich die Tore zu materiellem Wohlstand. Nur schon diese Möglichkeit schafft grosse Perspektiven und Erwartungen, die sich allerdings mitunter auch nicht erfüllen – und ganz selbstverständlich stellen sich dann Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und der Solidarität in der Gesellschaft. Das ist die logische Konsequenz des breit akzeptierten Leistungsprinzips, eine Begleiterscheinung der Erfolgsgeschichte des politischen Liberalismus sozusagen.
Sie meinen: Die Skepsis gegenüber grossen Vermögen hat nichts mit Neid oder Missgunst zu tun?
Zumindest weniger, als viele meinen. Eher hat sie mit fehlendem Verständnis zu tun, worauf z.B. die Werthaltigkeit von Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten beruht. Und da ist es legitim zu fragen: Spielen Unternehmen im Wettbewerb nach den Regeln, die für alle gelten?
Ihre Antwort darauf?
Ja! Ein Beispiel dafür ist die Rechnungslegung und auch die Kontrolle derselben durch die Revisionsstellen. Oder denken Sie an die Submissionsregeln bei Geschäften im öffentlichen Sektor, an das Korruptions- oder Insiderstrafrecht oder an die Kapitalmarktregeln im allgemeinen, die sicherstellen, dass mit gleichlangen Spiessen gekämpft wird. Bei all diesen Regulatorien – und solange nichts Gegenteiliges erwiesen ist – darf man davon ausgehen, dass das erwirtschaftete Kapital, das investiert oder gespendet wird, regelkonform aufgebaut wurde. Das sollte Vertrauen schaffen.
Aber offenbar nicht genug, wie das Beispiel aus Frankreich zeigt. Wie weit soll es mit der vielzitierten «Transparenz» gehen?
Oft reicht schon ein wenig mehr Transparenz und es wird klar, wie Wirtschaft im Wettbewerb funktioniert: von vielen zehntausend Unternehmerinnen und Unternehmern schaffen es vielleicht eine Handvoll, ein so grosses Vermögen wie die Familien Pinault oder Arnault in Frankreich zu erarbeiten, alle anderen schaffen es nicht – das ist Wettbewerb, das Wechselspiel von Chancen und Risiken. Die Philanthropie profitiert dann regelmässig von denjenigen, die Erfolg hatten: Private Vermögen, die schon einmal, oft sogar mehrfach, regelkonform versteuert wurden, kommen erneut der Gesellschaft zugute. Stiftungen täten vor allem gut daran, diesen Nutzen breiter zu kommunizieren.
«Insbesondere im angelsächsischen Raum gibt es wenig Verständnis für Stiftungen schweizerischen Zuschnitts. Und daraus resultiert rasch der generelle Verdacht, dass diese Struktur missbraucht wird, um verbotene wirtschaftliche Tätigkeiten abzuwickeln.»
Wie könnten sie das konkret tun?
Es gibt meines Erachtens ein gesellschaftliches Bedürfnis, das Wirken und den Nutzen von Stiftungen zu verstehen, nicht im Detail, aber im Grundsatz. Vielleicht könnten sie sich ein Vorbild nehmen an den erfolgreichsten Sportlern: Über das Zustandekommen von Roger Federers Vermögen z.B. redet kaum jemand, und auch bei den Fussballern hat man sich – nach einem Aufschrei in den 1990er Jahren – an grosse Transfersummen und Gehälter gewöhnt. Der Grund dürfte darin liegen, dass sich Federer- und Fussballfans überzeugen können, dass ihre Idole bei dem, was sie machen, zu den Besten gehören. Sie haben die Gelegenheit, sich von den Leistungen der Sportler zu überzeugen, sie sind ja am Fernsehen oder im Stadion live dabei. Wer hier liefert, könnte man sagen, darf auch etwas dafür bekommen. Hinzu kommt eine weitere Entwicklung: Die Ausdehnung des Staates in früher private und philanthropische Bereiche schafft eine Art latente Konkurrenzsituation. Viele Mitbürger haben heute den Eindruck, dass es richtig ist, dass mehr Dinge über öffentliche – also: vermeintlich transparentere, weil von allen getragene – Strukturen abgewickelt und sichergestellt werden als durch private, bei denen kein durchsetzbarer Leistungsanspruch besteht.
Man glaubt: Bürokratische Stellen mögen ineffizienter sein, aber sie sind «objektiver», da sie von Konjunkturen usw. unabhängig agieren können?
Genau. Meine Haltung, mein Ideal ist das deshalb nicht, ich nehme aber wahr, dass viele Bürgerinnen und Bürger so denken. Und natürlich: Innerhalb ausgedehnter staatlicher Strukturen bestehen Anreize, die dem privaten Engagement auch im Wege stehen können. Die Verantwortlichen haben naturgemäss wenig Interesse daran, an privater Konkurrenz gemessen oder gar «überflüssig» zu werden – egal wie gut der Output für die Gesellschaft ist.
Das Understatement beim Geben in Europa und gerade in der Schweiz unterscheidet sich stark von der Herangehensweise im angelsächsischen Raum. In den USA etwa gilt, leicht überspitzt: Erfolgreiche Industrielle, die mit 40 noch keinen Konzertsaal gesponsert und nach sich benannt haben, sind suspekt!
Sie sagen es: In den USA ist das philanthropische Schaffen für die Menschen viel präsenter, bei jedem Konzertbesuch, bei Buchpublikationen, bei Museumsnachmittagen. Aber was unter Transparenzgesichtspunkten gut ist, muss nicht immer gut ankommen: Wer Philanthropie vornehmlich zur Eigen-PR nutzt, handelt sich mitunter auch berechtigte Kritik ein. Allzu viel Selbstdarstellung ist dann eben vielleicht kein privates Geben mehr, sondern fast schon wieder ein öffentliches «Nehmen». Für eine gewisse Diskretion gibt es also gute Gründe, das muss allerdings nicht Unsichtbarkeit bedeuten. Sichtbarkeit ist oft auch eine wesentliche Voraussetzung für Vertrauen.
Sie haben aktuell sechs Stiftungsratsmandate, sind u.a. Präsident einer der grössten und wichtigsten Unternehmens- und Förderstiftungen der Schweiz, der Ernst Göhner Stiftung. Was interessiert Sie an solchen Tätigkeiten?
Das Engagement in unserem unglaublich heterogenen Stiftungssektor hat seinen ganz eigenen Reiz: Man kann mit spannenden, engagierten Menschen enorm viel bewegen. Anders als in Wirtschaft und Politik geht es hier eben nicht vornehmlich um bereits bestehende Kunden- oder Wählerwünsche, sondern um das «Möglichmachen von Wünschen», die noch nicht im Denkgefüge jedes Alltags angekommen sind. Hier kann man gemeinsam mit Vordenkerinnen und Vordenkern vorausschauen, Experimente ermöglichen, ausprobieren, neue Anreize setzen.
Gibt es den «Stiftungssektor» aus Sicht der Politik überhaupt? Oder nimmt sie ihn eher als Stimmen von Einzelinteressen und unterschiedlichen Themen wahr?
Ich würde nicht von einem «Sektor» reden. Stiftungsbasierte Philanthropie hat so viele Ausprägungen, dass sie sich im Finden von gemeinsamen Positionen, im Vermarkten und Erklären des Sektors verständlicherweise schwertut – auch gegenüber der Politik. Leider kommuniziert sie auch deshalb die enorm wichtige und auch gute Rolle, die die Philanthropie in der Schweiz spielt, zu wenig. In die Öffentlichkeit drängt hingegen vielmehr der staatliche Umverteilungsmechanismus – er ist dem privaten Engagement unter Effizienzgesichtspunkten aber häufig unterlegen und auch viel stärker reglementiert. Hier können Sie v.a. weniger Projekte fördern, die vielleicht etwas Neues, Grosses anstossen – und deshalb eben auch ein entsprechend grösseres Risiko bergen.
Wie vernetzt sind denn die Stiftungen, in denen Sie tätig sind?
Der Stiftungssektor ist nach meiner Beobachtung eher strukturkonservativ. Das Pooling von Fördermitteln z.B., die neuen Plattformen zur Vernetzung, die grössere Schlagkraft, die hier nun mit neuen technischen Möglichkeiten zu erreichen wäre – das alles ist in vielen Stiftungen bis heute kein Thema. Es ist auch legitim, dass Stifterinnen und Stifter in erster Linie ihre eigenen Vorstellungen verwirklicht sehen wollen. Vielleicht wird eine gewisse Wende von der nächsten Generation der jüngeren Stifterinnen und Stifter eingeleitet: Für sie ist es bereits jetzt völlig normal, keine Papierdossiers mehr einzufordern und aktiv auf neuen Förderportalen nach interessanten Projekten zu suchen, oder auch nicht zwingend, den «ewigwährenden statischen Stiftungszweck» ins Leben zu rufen. Auf Seiten der möglichen Destinatäre ist das Wissen um die neuen Möglichkeiten und ihre Nutzung auch schon viel ausgeprägter.
«Bei vielen Fragen haben wir es zudem nicht in erster Linie mit Schweizer, sondern mit internationalen Problemen zu tun: Es gibt einen Kulturunterschied und jenseits der Schweiz oft auch ein fehlendes Verständnis für das, was eine Schweizer Stiftung ist und was nicht.»
Müsste nicht gerade die FDP, die auf schlanke staatliche Strukturen «abonniert» ist, versuchen, eine Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements politisch produktiv zu machen?
Durchaus. Aber gerade die FDP steckt hier in einem liberalen Dilemma: Das Instrumentarium der institutionellen Politik ist die Regulierung, d.h. der Erlass neuer Vorschriften. Und jeder, der einen zurückhaltenden Regulierungsansatz vertritt, kann sich mit «mehr Lobbyarbeit» nicht direkt anfreunden – denn das Schweizer Stiftungswesen ist bereits sehr liberal, und mehr Regulierung könnte es rasch auch unfreier und wirkungsloser machen. Klar ist aber auch: Ändern sich die Rahmenbedingungen, muss man damit bewusst umgehen und allenfalls nachjustieren – wie z.B. in Fragen der Finanzmarktregulierung. Bei vielen Fragen haben wir es zudem nicht in erster Linie mit Schweizer, sondern mit internationalen Problemen zu tun: Es gibt einen Kulturunterschied und jenseits der Schweiz oft auch ein fehlendes Verständnis für das, was eine Schweizer Stiftung ist und was nicht. Insbesondere im angelsächsischen Raum gibt es wenig Verständnis für Stiftungen schweizerischen Zuschnitts. Dort gibt es Trusts oder Foundations, aber das «definitiv verselbständigte Sondervermögen» mit eigener Rechtspersönlichkeit, eigener Aufsicht und eigenem Zweck ist halt nicht dasselbe. Und daraus resultiert rasch der generelle Verdacht, dass diese Struktur missbraucht wird, um verbotene wirtschaftliche Tätigkeiten wie Geldwäscherei und Steuerhinterziehung abzuwickeln.
Für Liberale gibt es trotzdem einiges zu tun: Haftungs- und Transparenzvorgaben justieren – etwa die Unzulässigkeit von Stiftungsratshonoraren oder Impact Investing bei steuerbefreiten Stiftungen…
Aktuell ist «Impact Investing» für steuerbefreite Stiftungen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, aber gegebenenfalls ändert sich das auch wieder. Gerade in solchen Fragen braucht es einen aktiven Dialog der interessierten Kreise mit den «Regulatoren», in diesem Falle der Aufsicht und den Steuerbehörden. Dasselbe gilt für die Honorierung von Stiftungsratsmandaten: Auch Stiftungsratsmitglieder von steuerbefreiten Stiftungen stehen voll in der Verantwortung, und es wird – verständlicherweise – auch von ihnen zunehmend ein Handeln nach professionellen Massstäben verlangt. Eine angemessene Abgeltung solcher Leistungen scheint mir da doch vertretbar.
Und wie steht es um die Ausdehnung des automatischen Informationsaustauschs auf Stiftungen? Kaum auszudenken, was hier – angesichts des Wissensstandes um Schweizer Stiftungen im Ausland – an Anfragen bei den Behörden anstünde, wenn der Stiftungssektor ihm unterstellt würde.
Hier findet eine Art internationaler «Kulturkampf» statt, der im Falle des AIA natürlich für enorm viel Bürokratie sorgen kann. Natürlich gilt aber das, was wir eben im Hinblick auf Stiftungen und ihr Bild in der Öffentlichkeit besprochen haben, auch für das Zusammenspiel zwischen internationaler und nationaler Regulierung. Da ist die Schweiz gut beraten, Allianzen mit jenen – v.a. europäischen – Staaten einzugehen, die dieselbe oder eine ähnliche Ausgangslage haben. Im Rahmen der OECD muss man dann sicherstellen, dass wenn immer möglich nicht alles über einen Kamm geschoren wird. Die Chancen stehen dafür nicht schlecht, man muss aber schon auch rechtzeitig aktiv werden. Entweder wir adressieren die Probleme selbst – oder andere übernehmen es für uns.