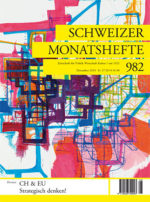Krise, Krisenbekämpfung und Staatsbankrott
Die Staaten der EU haben sich im Zuge der Finanzkrise in historischer Höhe verschuldet. Sie haben damit die Krisenherde vorerst eingedämmt. Doch der Preis ist hoch. Die Frage ist, wer ihn am Ende bezahlt.
Grössere Wirtschaftskrisen treten nach langfristiger historischer Erfahrung etwa alle zehn Jahre einmal auf.* Dabei ist jede Krise anders. Die gegenwärtige Krise unterscheidet sich darin, dass die Regierenden weltweit wesentlich weniger auf die Selbstheilungskräfte des Marktes vertrauen, sondern mit Staatshilfen in exorbitanter Höhe einspringen. Zu nennen sind zunächst die weltweit 4 bis 5 Billionen Dollar für Banken zur Aufrechterhaltung ihrer Liquidität, zur Rekapitalisierung und zur Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs, dann die 2,5 Billionen Dollar zur Ankurbelung der Realwirtschaft und schliesslich die Zusagen von etwa 1,1 Billionen Dollar für Entwicklungsländer über den Internationalen Währungsfonds.**
Die Staatsausgaben zur Ankurbelung der Realwirtschaft laufen über verschiedene Transmissionskanäle. Einmal werden direkte Staatsausgaben getätigt, zum Beispiel in Form von Infrastrukturinvestitionen. Zum anderen werden Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuern gesenkt, um Kaufkraft zu aktivieren. Doch schon bevor all diese beschlossenen Massnahmen wirksam wurden, setzten, ohne dass es eines Beschlusses bedurfte, die automatischen Stabilisatoren auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite des Staatshaushalts ein und milderten einen grossen Teil des Konjunkturrückgangs ab.
Da sich Staatsausgaben in solcher Höhe nicht aus den laufenden Einnahmen finanzieren lassen, kam es zu einer nie dagewesenen Staatsverschuldung, was die Frage aufwirft: Können sich Staaten eine solche Verschuldung überhaupt leisten, ohne sich der Gefahr der Zahlungsunfähigkeit auszusetzen?
In der Vergangenheit haben sich Regierungen häufig finanziell übernommen, wurden zahlungsunfähig und erlitten Staatsbankrott. König Philipp II. von Spanien erklärte zwischen 1557 und 1596 viermal den offenen Staatsbankrott. Er verweigerte Zahlungen, leistete keinen Schuldendienst, verschob oder verminderte diesen. Anders als die meisten anderen Regierungen, liess er die Währung, den Peso de Ocho, unangetastet, weil er so sicherstellen konnte, dass sich seine persönliche Zahlungsunfähigkeit nicht über die Währung negativ auf den Welthandel auswirkte. Dadurch wäre das spanische Weltreich weit stärker getroffen worden. Philipp war in dieser Hinsicht ein weiser Herrscher.
Die Form des offenen Staatsbankrotts stellt jedoch eine Ausnahme unter den Staatsbankrotten dar. Meist ziehen souveräne Herrscher in Finanznot den Weg des verdeckten Staatsbankrotts vor, indem sie ihre Zahlungsunfähigkeit durch Münzverschlechterung und das Drucken von Papiergeld hinauszögern, um dann erst später, wenn die Geldillusion dahinfällt, zugeben zu müssen, dass sie zahlungsunfähig sind. Zu Schaden kommen beim verdeckten Staatsbankrott nicht nur einzelne Gläubiger, sondern die breite Bevölkerung, deren Ersparnisse vernichtet werden. Frühe Beispiele hierfür sind in China die Papiergeldinflation mit nachfolgendem Staatsbankrott von 1425 während der Ming-Dynastie, in Frankreich die Inflation mit Staatsbankrott durch den schottischen Bankier John Law 1718, der im Auftrag der französischen Krone Papiergeld einführte und damit scheiterte, schliesslich die Assignatenwährung der französischen Revolutionäre, die sieben Jahre, von 1790 bis 1796, dauerte.
Für das 19. Jahrhundert zählt der deutsche Finanzhistoriker Alfred Manes in seinem Buch «Staatsbankrotte. Wirtschaftliche und rechtliche Betrachtungen» (1919) nicht weniger als 23 Staatsbankrotte in Europa. Die spektakulärsten waren diejenigen von Preussen 1807 und 1813 sowie von Österreich 1805 und 1814, die alle mit den Napoleonischen Kriegen zusammenhingen. Dann folgte eine ganze Reihe von Staatsbankrotten in Südamerika und in den amerikanischen Bundesstaaten. Im 20. Jahrhundert erlitt Deutschland zweimal einen Staatsbankrott, nämlich 1923 und 1948, die beide zur Entwertung der Staatsschulden und in der Folge zu einer Währungsreform führten. In Argentinien kam es 2002 zu einem Staatsbankrott, weil infolge interner Inflation der Wechselkurs zum Dollar nicht mehr gehalten werden und die in Dollar denominierten Staatschulden daher nicht mehr bedient werden konnten.
In all diesen Fällen war es die Neigung der Regierungen, über ihre Verhältnisse zu leben, die zu Staatsbankrotten führte. In der aktuellen Krise sind es aber in erster Linie notleidende Banken, die Staaten in den Ruin treiben. In Island hatte der Staat den in Bedrängnis geratenen Banken im Jahr 2008 Garantien gegeben, die er nicht einlösen konnte, weshalb er Insolvenz erklären musste. Infolgedessen sank der Wechselkurs der isländischen Krone gegenüber dem Euro um fast 30 Prozent und dies, obwohl die Zentralbank den Diskontsatz – den Zinssatz, zu dem eine Bank Wechsel an die Zentralbank verkaufen kann – auf über 15 Prozent anhob. Der Internationale Währungsfonds musste einspringen und Geld gegen ein wirtschaftliches Restrukturierungsprogramm leihen. Etwa gleichzeitig gerieten auch Lettland, Ungarn und Rumänien in die Nähe von Staatsbankrotten. Ihnen wurde durch gemischte Kredite der Europäischen Union (EU) und des Internationalen Währungsfonds geholfen.
Doch wie steht es mit den Euro-Staaten? Für sie verbietet der EG-Vertrag explizit Auslösungszahlungen durch andere Mitgliedstaaten und die Union (Art. 103 EG). Dies erklärt sich daraus, dass die EU-Mitgliedstaaten dem Vorhaben der Währungsunion nur unter der Bedingung zustimmen wollten, dass sie sicher sein konnten, nicht dereinst in die Pflicht genommen zu werden, falls ein Staat durch Fehlentscheidungen in finanzielle Bedrängnis kommen sollte. Dieser Fall wurde aktuell, als Anfang des Jahres 2009 die Zahlungsfähigkeit von Portugal, Italien, Griechenland, Spanien, Irland und auch Österreich von den Finanzmärkten in Frage gestellt wurde. Für diese Staaten stiegen die Finanzierungskosten der 10jährigen Staatsanleihen gegenüber denjenigen Deutschlands von 0,05 Prozent vor der Krise auf über 2 Prozentpunkte Anfang 2009. Ebenso schnellten die Versicherungsprämien gegen Ausfälle von Staatsanleihen (Credit Default Swaps) in die Höhe.
Damit wurde weitere Verschuldung für diese Staaten sehr kostspielig und eine Umkehr der Politik eigentlich lebensnotwendig, wollten sie nicht Bankrott erklären. Der Fall Österreichs ist besonders anschaulich. Die österreichischen Banken hatten in der Folge der Öffnung Osteuropas eine wirtschaftliche Vormachtstellung auf den Kreditmärkten der osteuropäischen Volkswirtschaften erlangt, für die sie von vielen Wettbewerbern beneidet wurden. Das schnelle Wachstum ihrer Geschäfte bescherte ihnen ansehnliche Renditen. Allerdings übersahen sie, dass sie sich in ein Klumpenrisiko begaben und dass sie mit einer Kreditsumme von 277 Milliarden Euro Ende 2008 ein potentiell explosives Gemisch etwa in der Höhe des österreichischen Bruttoinlandsprodukts akkumuliert hatten. Als dann mit der Krise die Risiken in Osteuropa stiegen, mussten sie Abschreibungen vornehmen, die ihre Kapazität überstiegen.
In ihrer Not riefen sie nach dem Staat, der ihnen (ähnlich wie in Island) beistand und ihnen Schuldenauslösung als lender of last resort versprach; dies führte dazu, dass auch er an Kreditwürdigkeit einbüsste und in Österreich den erwähnten Anstieg der Renditen von Staatsanleihen auslöste. Dadurch fühlte sich die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Am 3. März 2009 verkündete der Währungskommissar Joaquín Almunia: «Wenn eine solche Krise in einem Euro-Staat auftritt, gibt es dafür eine Lösung, bevor dieses Land beim Internationalen Währungsfonds um Hilfe bitten muss.» Wie diese Lösung aussehen solle, liess er jedoch im dunkeln. Eine solche solle nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden, meinte er.
Diese Äusserung war durchaus gezielt plaziert. Den Gläubigern wurde Sicherheit suggeriert. Sie konnten sich jetzt sagen: im Ernstfall wird es doch eine Auslösung durch die EU geben. Interessanterweise begannen kurz darauf die eben betrachteten Finanzierungskostendifferenzen gegenüber Deutschland wieder zu sinken. Ob noch andere Faktoren in diese Richtung wirkten, sei dahingestellt; für Almunia war ein Problem jedenfalls vom Tisch. Doch für die Mitgliedstaaten ist diese Art Politik höchst problematisch. Für sie wirkt sie als Signal, sich wegen der Finanzen keine Sorgen zu machen. Überschuldung lässt sich durch EU-Hilfe lösen. Sie wird zum Kavaliersdelikt. Wenn alle diesem Signal folgen, werden die Finanzen der EU-Staaten bald zerrüttet sein.
Offensichtlich hat der Staatsbankrott heute eine neue Form angenommen. Es kommt nicht mehr zum Kollaps mit anschliessender Reform wie zu Zeiten Philipps II., sondern der Bankrott wird auf eine supranationale Ebene verschoben. Dort gilt der Grundsatz: alle Staaten haften für aller Schulden und kein Staat haftet für seine Schulden. Jetzt, wo alle überschuldet sind, ist Inflation ein noch attraktiverer Ausweg als im Zeitalter des Nationalstaates.
Die Nachsicht, die die EU-Kommission überschuldeten Mitgliedstaaten zukommen lässt, hindert sie nicht daran, von diesen eine nachhaltige Politik der Rückkehr in die Maastrichtschranken zu fordern. Die Mitgliedstaaten sollen Exit-Strategien aus der Schuldenpolitik zurück zum ausgeglichenen Haushalt vorlegen, verkündete die Kommission im September 2009. Die massiven Interventionen zugunsten des Bankensektors, die ausfallenden Steuereinnahmen und die Konjunkturprogramme haben zu Verschuldungsniveaus geführt, die lange als unvorstellbar galten. Die Europäische Kommission prognostiziert schon für 2010 einen Schuldenstand im Euroraum von 83,3 Prozent des BIP, mehr als 20 Prozent entfernt vom im Stabilitäts- und Wachstumspakt vereinbarten Maximalwert.***
Eine solche Politik ist nicht nachhaltig. Vielmehr sollten die Staatshaushalte in konjunkturell normalen Zeiten ausgeglichen oder sogar im positiven Bereich gehalten und lang anhaltende Defizite vermieden werden, die zu höheren Zinsen führen, private Investitionen verdrängen und die Wachstumsaussichten senken. Dies ist bei den gegenwärtigen Defiziten eine Herkulesaufgabe. Selbst wenn ab sofort der vom Pakt vorgesehene Defizitabbaupfad von 0,5 Prozentpunkten pro Jahr eingehalten wird, lässt sich im nächsten Aufschwung ein ausgeglichener Haushalt voraussichtlich noch nicht erreichen, sodass noch stärkere Anstrengungen notwendig sind.
Darüberhinaus ist darauf zu achten, dass die Defizitrückführung nicht die gerade anspringende Konjunktur wieder abwürgt und es somit zu einem erneuten Konjunktureinbruch kommt. Um das zu erreichen, muss die Exit-Strategie kalkulierbar sein. Die Konsumenten müssen darauf vertrauen können, dass der gegenwärtige Ausgabenboom wieder zurückgeführt wird. Andernfalls müssten sie langfristig mit Steuererhöhungen und/oder steigenden Zinssätzen rechnen. Dies antizipierend, würden sie schon heute ihre Konsumausgaben einschränken, und der Ausgabenstoss würde seine stimulierende Wirkung verfehlen.
Ein Ausweg aus den Massnahmen, die den Konjunkturverlauf aktiv zu beeinflussen suchen, ist je nach Land nicht mit allzugrossen Mühen verbunden. In der Schweiz hatten die Konjunkturprogramme einen bescheidenen Umfang, sodass keine massiven Probleme zu erwarten sind. Hingegen wurden in Deutschland auch strukturelle Ausgaben angeschoben, die nur schwer reversibel sind, wie beispielsweise Ausgaben für den Gesundheitsfonds und für die Renten. Auch Umweltschutzausgaben, die oft einen sehr geringen Wirkungsgrad haben, müssten überprüft werden. Meist geht es um massive Sonderinteressen. Es ist daher an der Zeit, mit offenen Karten zu spielen und den Bürgern reinen Wein einzuschenken.
Noch schwieriger dürfte die Situation in den Vereinigten Staaten sein, wo die Defizite noch grössere Dimensionen angenommen haben. Die beiden Ökonomen Auerbach und Gale von der Brookings Institution sind in ihrem Aufsatz «The Economic Crisis and the Financial Crisis» (2009) skeptisch, dass dem amerikanischen Kongress eine Exit-Politik gelingen wird. Sie schätzen, dass die Defizitquote (das fiscal gap zwischen Staatsausgaben und Staatseinnahmen) bei etwa 7 bis 9 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) verharren wird.
Angesichts solcher Perspektiven wird es zunehmend verlockender für den Staat, sich der Schuldenlast zu entledigen. So ist in den USA geplant, eine Erbschaftsteuer auf amerikanischen Staatsanleihen exterritorial anzuwenden. Dies würde weltweit die Altgläubiger treffen, soweit sie natürliche Personen sind. Ihnen würde ein Teil der Verzinsung der Staatsanleihen, mit der sie gerechnet haben, vorenthalten. Diese Steuer ist vergleichbar mit einem Zinsschnitt, zu dem Staaten im Falle eines Staatsbankrotts oftmals greifen. Eine ähnliche Wirkung ginge von einer allgemeinen Inflation in den USA aus. Zur Ankurbelung der Wirtschaft ist sie zwar wenig geeignet, weil die durch sie erzeugte Geldillusion von den Wirtschaftssubjekten rasch durchschaut und wohl auch antizipiert wird und daher keine realen Effekte auslöst. Aber es könnten dadurch wiederum die Altgläubiger enteignet werden.
Derzeit sind die Inflationserwartungen jedoch noch gering. Die Differenz zwischen inflationsungeschützten und inflationsgeschützten Staatsanleihen liegt in der Euro-Zone und in den Vereinigten Staaten bei etwa 2 Prozent. Der Markt erwartet also für die nächsten 5 bis 10 Jahre – unter Einschluss wirtschaftlicher und politischer Variablen – eine Inflation etwa in dieser Höhe. Unter veränderten politischen Vorzeichen können sich Erwartungen jedoch auch ändern und eine Inflation wahrscheinlicher machen.
Es bleibt spannend zu beobachten, wer in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten die Kosten der Verschuldung tragen wird – die Steuerzahler durch eine Beschneidung ihres verfügbaren Einkommens, die kommenden Generationen im Falle einer revolvierenden Schuld, die Gläubiger im Falle eines ordentlichen Staatsbankrotts oder die Geldeinkommenssparer allgemein im Falle einer Inflation. Nur eines scheint unwahrscheinlich: dass wir auf mysteriöse Weise mit einem blauen Auge davonkommen werden.
* Vgl. Peter Bernholz, «Zins ist auch reale Grösse», «Finanz und Wirtschaft» vom 16. September 2009, S. 1 und 6; er stützt sich dabei auf das Buch «Manias, Panics and Crashes» (1978) von Charles P. Kindleberger, wo Krisen seit dem Anfang des 16. Jh. untersucht werden.
** «The State of Public Finances: Outlook and Medium-Term Policies after the 2008 Crisis», IMF Fiscal Affairs Departement 2009.
*** «Economic Forecast», European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Spring 2009.
Charles B. Blankart, geboren 1942 in Luzern, ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Erik R. Fasten, geboren 1981, studierte Volkswirtschaft und Management an der Humboldt-Universität zu Berlin und der University of Toronto (Kanada).