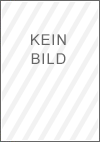Der Niedergang des Zürcher Wirtschaftsfreisinns
Die Credit Suisse steht für eine Elite, die der Schweiz zu Reichtum verhalf. Bevor ihr das Land zu klein wurde. Die heilige Dreifaltigkeit Kreditanstalt, FDP und Grasshopper Club ist am Boden.
Als am 19. März 2023 an einer Medienkonferenz in Bern das Ende des einstigen Stolzes des Zürcher Finanzplatzes verkündet wurde, fehlte Zürich. Es waren die Bundesräte Alain Berset (Freiburg) und Karin Keller-Sutter (St. Gallen), die der Welt auf Englisch zu erklären versuchten, dass nach der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS alles in bester Ordnung sei. Der irische UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher verbreitete routiniert Zuversicht, und der Berner CS-Präsident Axel Lehmann betonte, man müsse nun nach vorne schauen.

Bild: Keystone/Photopress-Archiv/Viktor Dammann.
An diesem Sonntag wurde nicht nur das Ende der CS besiegelt. Das Datum steht auch sinnbildlich für das Ende der goldenen Ära des Zürcher Wirtschaftsfreisinns – jenes Netzes, das Wirtschaft und Politik in der Schweiz seit 1848 über weite Strecken dominiert hatte. Nichts symbolisierte dieses Netz mehr als die CS.
Ein Kind des Aufbruchs
Die Schweizerische Kreditanstalt (SKA), aus der später die CS werden sollte, wurde 1856 in der Aufbruchstimmung nach der Gründung des Bundesstaats ins Leben gerufen. Massgeblicher Treiber war Alfred Escher. Der Unternehmer und Politiker brauchte Geld für den Ausbau des Schienennetzes, an dessen Höhepunkt der Bau des Gotthardtunnels stehen sollte.
Die SKA war Teil des Netzwerks, das Eschers Gegner als «System» bezeichneten: ein Geflecht von wirtschaftlichem und politischem Einfluss, zu dem etwa auch die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt gehörte, die heutige Swiss Life. Die Macht Eschers löste schon bald Argwohn aus. 1869 wurden seine Freisinnigen im Kanton Zürich von der demokratischen Bewegung aus der Regierung verdrängt; und nach Rückschlägen beim Bau des Gotthardtunnels wandten sich selbst seine Freunde von ihm ab.
Liberale Klientelwirtschaft
Eschers Machtverlust bedeutete aber nicht das Ende seines Imperiums, im Gegenteil. Die Kreditanstalt stieg im 20. Jahrhundert zu einer der wichtigsten Schweizer Banken auf.
Obwohl die moderne Schweiz von Liberalen gegründet worden war, war sie lange von Kartellen, Klientelwirtschaft und Hinterzimmergeschäften geprägt. In der Nachkriegszeit waren allein die Banken in 16 Kartellen organisiert. Wirtschaft und Politik pflegten eine intime Nähe, die sich im Zürcher Wirtschaftsfreisinn exemplarisch zeigte. Dieser sass trotz Wählerrückgang der FDP an den Schalthebeln der Politik und schuf gute Bedingungen für die Unternehmen, bei denen er ebenfalls am Drücker war. Schwergewichte wie Ulrich Bremi oder Peter Spälti übten in Bern ihren Einfluss aus und sassen zugleich in den Verwaltungsräten grosser Firmen.
Heute würde dieses System keiner Prüfung durch die Wettbewerbskommission oder eines Compliance-Verantwortlichen standhalten. Doch die persönliche Nähe hatte ihre Vorteile. Gesetze wurden von jenen geschrieben, die sich in der Privatwirtschaft auskannten – nicht wie heute von der Verwaltung und Berufspolitikern. Probleme konnten mit einem Telefonat aus dem Weg geräumt werden – und wurden nicht wie heute in den Medien verhandelt. Kurze Wege als Erfolgsrezept.
Kehrseite der Expansion
Mit dem wirtschaftlichen Erfolg gewann der internationale Austausch an Bedeutung. Nicht nur die Kunden von Schweizer Unternehmen wurden internationaler, auch ihre Besitzer und Führungskräfte. Heute werden Grossbanken und Industriekonzerne von ausländischen Aktionären und Managern dominiert. Der Heimmarkt spielt nur noch eine untergeordnete Rolle.
Bei der SKA läutete Rainer E. Gut, der 1973 Generaldirektor und 1983 Verwaltungsratspräsident wurde, den Ausbruch aus den bekannten Gefilden ein. Das bewährte, aber langweilige Vermögensverwaltungsgeschäft war der Bank nicht mehr genug. Die SKA sollte auch im US-amerikanisch dominierten Investmentbanking in der obersten Liga mitspielen. Sie stieg bei der First Boston ein und übernahm sie später ganz. Sie gab sich mit Credit Suisse einen modernen Namen mit internationaler Ausstrahlung. Aus der Hausbank des Freisinns vom Zürichberg wurde ein austauschbarer Weltkonzern. Der CS wurde zum Verhängnis, dass die Schweizer Elite aus der Schweiz ausbrechen wollte.
Mit den Expansionen grosser Schweizer Unternehmen wuchsen indes auch die Risiken – gerade im vermeintlich lukrativen Investmentbanking. Die ultraexpansive Geldpolitik der Zentralbanken und die faktische Staatsgarantie durch den Bund befeuerten die Risikofreudigkeit noch. Solche Risiken bleiben auch in einer globalisierten Wirtschaft nach wie vor in der Schweiz hängen. Sie taten es beim Swissair-Grounding 2001, bei der UBS-Rettung 2008 – und nun auch beim Untergang der CS. Der Schweizer Staat (und damit letztlich die Steuerzahler) steht bei diesem Deal mit 259 Milliarden Franken im Risiko.
Derweil hat die freisinnige Wirtschaftselite, die Risiken und Verantwortung früher bereitwillig getragen hatte, das Interesse an ihren einstigen Steckenpferden verloren. An den Generalversammlungen der SKA, den Parteiversammlungen der FDP und den Fussballspielen des Grasshopper Club (GC) trafen sich zu ihren besten Zeiten die Granden des Zürcher Freisinns und pflegten ihr Netzwerk. Die Entwicklung der drei Institutionen dokumentiert den Niedergang dieser alten Elite. Die CS, längst dominiert von einer neuen, international ausgerichteten Generation von Konzernlenkern, verschwindet unter den Fittichen der einstigen Rivalin UBS. Die FDP hat sich von der totalen Dominanz in der Regierung mit sieben Bundesräten zu einer Partei gewandelt, die bald nur noch einen Bundesratssitz haben könnte. Und der Rekordmeister GC stieg zwischenzeitlich in die zweithöchste Liga ab, bevor er von chinesischen Investoren übernommen wurde.
Der Zusammenbruch als Chance
Vielleicht ist das Ende des Zürcher Wirtschaftsfreisinns unvermeidlich, weil er in einer Welt blühte, die es nicht mehr gibt. Die Frage ist, was ihn ersetzt. In der Wirtschaft gibt es eine wachsende Diskrepanz zwischen kleinen und mittleren Firmen, bei denen Unternehmer Verantwortung übernehmen, und global ausgerichteten Grosskonzernen, wo gutbezahlte Manager den Ton angeben. Diese schreiben sich gerne unternehmerische Verantwortung für das Klima, Afroamerikaner und Transsexuelle auf die Fahne, wo es ihnen gelegen kommt, und stehlen sich mit gefüllten Taschen aus der Verantwortung, sobald der Wind dreht.
«Vielleicht ist das Ende des Zürcher Wirtschaftsfreisinns unvermeidlich, weil er in einer Welt blühte, die es nicht mehr gibt.»
Auch die Politik ist fragmentiert, die SVP als stärkste Kraft schwankt zwischen Liberalismus und Buurezmorge-Protektionismus. Die Einigkeit des Bürgerblocks ist passé. Die Macht (und das Geld) wandert vermehrt zu Kampagnenorganisationen, die sich auf bestimmte Themen beschränken, in der Europafrage etwa Autonomiesuisse und Operation Libero oder in der Klimapolitik Renovate Switzerland.
Aber vielleicht ist der Niedergang auch eine Chance für den Freisinn. Die FDP war traditionell eine breit aufgestellte Partei. Sie war in allen Landesteilen fest verankert, in der Stadt wie auf dem Land, in katholischen wie reformierten Kreisen, unter Vermögenden ebenso wie in der Mittel- und Unterschicht. Der Charakter der Volkspartei hat im Zuge der Wählerverluste der vergangenen Jahrzehnte Schaden genommen. Der Freisinn fokussierte sich zu stark darauf, eine Wirtschaftselite zu vertreten, die das Land immer weniger repräsentiert. Eine Elite, welche die Wirtschaftsbeziehungen zur EU im Zweifel über die Souveränität stellt, die bereitwillig Milliardensubventionen für die AHV unterstützt, wenn sie dafür Steuersenkungen erhält, und die auch in der Klimapolitik neue Subventionen in Kauf nimmt im Wissen darum, dass die Kosten dafür KMU überproportional belasten.
Mit dem Ende der CS kann sich auch der Freisinn endgültig von einem Klumpenrisiko befreien. Und es wieder einmal mit Liberalismus für das Volk probieren.
«Mit dem Ende der CS kann sich auch der Freisinn endgültig von einem Klumpenrisiko befreien.»