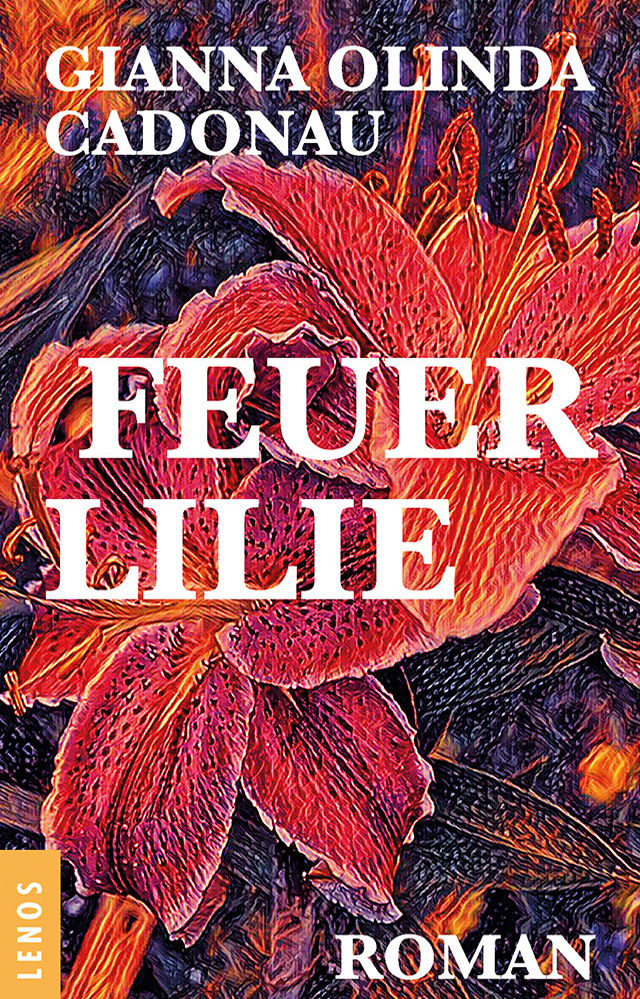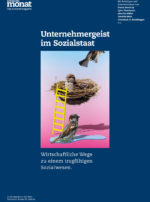Auf die Gemeindefinanzen kommen ungemütliche Zeiten zu
Die Gemeinde ist die Staatsebene, wo der Bürger am direktesten Einfluss auf die Finanzen nehmen kann. Mit den steigenden Zinsen wird das Schuldenmanagement wieder wichtiger.
Die Gemeinde ist jene Staatsebene, die dem Schweizer Bürger am nächsten ist und bei der er Einnahmen und Ausgaben am besten nachvollziehen kann. Entsprechend sollten die Finanzierungsfragen, die sich in jeder der 2136 Gemeinden stellen, Einwohnerinnen und Einwohner besonders interessieren. Zudem entfallen auf diese Körperschaften gemäss Finanzstatistik immerhin 21 Prozent der öffentlichen Schulden; auch wenn das weniger ist als der Anteil der Kantone und des Bundes, handelt es sich doch nicht um eine Quantité négligeable. Und dass Gemeinden geräuschlos zu Geld kommen, ist zwar die Regel, aber auch nicht selbstverständlich, wie vor einem Vierteljahrhundert der Fall Leukerbad gezeigt hat. Die Walliser Gemeinde hatte sich damals mit grossen Investitionen insbesondere in die touristische Infrastruktur finanziell übernommen, konnte ihren Schuldenberg nicht mehr bedienen und wurde in der Folge vom Kanton mehrere Jahre unter Zwangsverwaltung (Beiratschaft) gestellt.
Eine Gemeinde ist dann finanziell gesund, wenn sie mittelfristig eine ausgeglichene Erfolgsrechnung hat, genügend Cashflow für die Finanzierung der Investitionen erzielt und sich pro Kopf der Bevölkerung nur massvoll verschulden muss. Ein gesunder Finanzhaushalt und ein möglichst tiefer Steuerfuss sind zentrale Elemente der Finanzstrategie von Gemeinden. Die nach einer langen Tiefzinsperiode steigenden Zinsen stellen nun auch die Gemeinden vor neue Herausforderungen.
Mehr Schulden kosten weniger
In den letzten Jahren haben die Gemeinden von der Entwicklung der Zinsen profitiert. Von 2008 bis 2020 sind zwar die Finanzverbindlichkeiten aller Gemeinden um 26 Prozent auf 45 Milliarden Franken gestiegen, der Zinsaufwand ist hingegen um 59 Prozent auf 0,5 Milliarden Franken gesunken. Dies hat dazu geführt, dass der durchschnittliche Zinsaufwand der Gemeinden im Verhältnis zu den Finanzverbindlichkeiten von 3,7 auf 1,1 Prozent und im Verhältnis zum Personal- und Sachaufwand von 6,1 auf 1,9 Prozent gesunken ist. Die Zinsentwicklung hat somit die Schweizer Gemeinden finanziell entlastet. Das relativiert auch die Folgen des jüngsten Zinsanstiegs.
Wie Studien der Hochschule Luzern für die Jahre 2003 bis 2019 zeigen, finanzieren sich (zumindest die untersuchten mittelgrossen) Gemeinden vorwiegend durch festverzinsliche Darlehen, die durchschnittlich eine Laufzeit von etwas mehr als acht Jahren haben. Rund 50 bis 60 Prozent der Darlehen werden von Banken gewährt, wobei die PostFinance mit 20 bis 25 Prozent vor den Kantonalbanken mit 15 bis 20 Prozent den grössten Marktanteil hat. Die weiteren 40 bis 50 Prozent des Kreditvolumens werden durch institutionelle Anleger finanziert, die Gemeindekredite als solide Anlageklasse nutzen. In der Gemeindefinanzierung engagieren sich zum Beispiel die Suva, grössere Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds, Versicherungen und grössere Privatinvestoren. Das Spektrum der Anbieter hat sich in den letzten Jahren relativ stark gewandelt, so haben sich etwa die Grossbanken, gewisse Auslandbanken oder die Swiss Life aus dem Markt zurückgezogen, dafür hat das Treasury der PostFinance vermehrt Mittel in Gemeindedarlehen angelegt. Die aktuell steigenden Zinsen könnten bei einzelnen institutionellen Investoren möglicherweise wiederum eine Neubeurteilung dieser Anlageklasse zur Folge haben, d.h. sie zum (Wieder-)Einstieg oder Rückzug aus dem Geschäft bewegen.
«In der Gemeindefinanzierung engagieren sich zum Beispiel die Suva, grössere Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds, Versicherungen und grössere Privatinvestoren.»
Gemeinden gelten als solide Schuldner, und sie können ihre Darlehen meist zu sehr günstigen Bedingungen aufnehmen. Die Margen lagen zum Beispiel bei 238 mittelgrossen Schweizer Gemeinden Ende 2019 im Median und Durchschnitt bei 40 Basispunkten über den Swapsätzen, also den Sätzen, die am Interbankenmarkt für den Tausch der Verzinsung eines Kredites von fix in variabel (Geldmarktsatz) verrechnet werden und die als Referenzwerte für den ganzen Kapitalmarkt gelten.
«Gemeinden gelten als solide Schuldner, und sie können ihre Darlehen meist zu sehr günstigen Bedingungen aufnehmen.»
Die als gut eingeschätzte Bonität von Gemeindekrediten, die entsprechend tiefen Margen und das grosse verfügbare Angebot an individuellen Finanzierungsmöglichkeiten dürften auch die Gründe dafür sein, dass es in der Schweiz heute keine speziellen Finanzierungsvehikel für Gemeinden mehr gibt. Ideen für kostengünstigere Gemeindefinanzierungen wie z.B. die Aufnahme von Anleihen durch den Kanton zwecks Refinanzierung der Gemeinden, Clubdeals von mehreren Gemeinden, Liquiditätsausgleich unter den Gemeinden oder die Verbriefung von Gemeindekrediten über Special Purpose Vehikel konnten nicht umgesetzt werden. Und die 1971 gegründete Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (ESG) hat ihre früher sehr erfolgreiche Tätigkeit im Jahre 2011 eingestellt, wofür die «Nachwehen» des Zahlungsausfalls der erwähnten Walliser Gemeinde Leukerbad Ende der Neunzigerjahre hauptverantwortlich waren. Damals hatte sich gezeigt, dass die Kantone für die Schulden ihrer Gemeinden nicht haften, dass Gemeindekredite ausfallen können und dass Gemeinden Risiken eingehen, wenn sie gegenseitig für ihre Schulden bürgen, wie dies bei den ESG-Anleihen der Fall war.
Anbieter und Instrumente haben sich gewandelt
Die Gemeinden lassen heute den Markt spielen und holen direkt oder über Geldmarktbroker jeweils mehrere Offerten für die benötigten Darlehen ein. Sie nutzen aber vermehrt auch automatisierte Vermittlungsplattformen für Gemeindekredite, insbesondere Loanboox und Cosmofunding. Diese ermöglichen Banken und institutionellen Investoren, mit vertretbarem Aufwand an Gemeindefinanzierungen heranzukommen und Angebote zu unterbreiten. Für die Gemeinden eröffnen sie ein grösseres Spektrum an potentiellen Geldgebern und marktgerechte Konditionen.
Die meisten Gemeinden haben somit problemlos Zugang zu günstigen Finanzierungen von Banken und – bei einem ausreichenden Rating durch eine anerkannte Ratingagentur (hier steht die Schweizer Fedafin im Vordergrund, die 98 Prozent aller Gemeinden bewertet) – auch von institutionellen Investoren. Stimmt das Rating, können somit Darlehen direkt bei diesen Finanzierungspartnern aufgenommen werden. Die Analysen der Hochschule Luzern haben auch ergeben, dass die Finanzsituation (beispielsweise die Nettoschuld pro Einwohner) bei vielen Gemeinden keinen starken Einfluss auf die Finanzierungskonditionen hat. Für Gemeinden mit angespannter Finanzsituation (und ungenügendem Rating) kann sich jedoch der Investorenkreis auf wenige Anbieter verengen, und sie müssen mit Finanzierungsengpässen und höheren Kosten rechnen.
Seit Herbst 2022 sind die Zinsen um rund zwei Prozentpunkte gestiegen. Angesichts der Finanzierungsstruktur der Gemeinden mit längerfristigen und auf der Zeitachse gestaffelten Darlehen wirkt sich der Zinsanstieg zeitlich verzögert aus. Der Zinsaufwand steigt mit jedem neu abgeschlossenen oder verlängerten Darlehen leicht an. Bleibt das höhere Zinsniveau bestehen, muss im Laufe der Jahre mit Mehrkosten von jährlich mehreren 100 Millionen Franken gerechnet werden. Allerdings müssen diese auch in den Kontext des heute tiefen Anteils des Zinsaufwands am Gesamtaufwand der Gemeinden gesetzt werden. Ausserdem wirken sich der Zinsanstieg und die Teuerung auch auf andere Positionen in der Rechnung aus, namentlich die Steuereinnahmen.
Zusätzlich gilt es zu beachten, dass sich die Finanzierungssituation je nach Kanton und auch innerhalb eines Kantons je nach Gemeinde stark unterscheiden kann. So lag zum Beispiel gemäss Finanzstatistik der Eidgenössischen Finanzverwaltung Ende 2020 die Bruttoverschuldung der Gemeinden pro Einwohner im Durchschnitt aller Kantone bei 6420 Franken; die Bandbreite reicht jedoch von 941 Franken im Kanton Appenzell Innerrhoden bis 9939 Franken im Kanton Neuenburg. Und die Nettoschulden (Bruttoschulden abzüglich Finanzvermögen) der Gemeinden liegen im Durchschnitt aller Kantone bei 631 Franken pro Einwohner; das Spektrum reicht jedoch von einem Nettovermögen von 7026 Franken im Kanton Genf bis zu Nettoschulden von 5715 Franken im Kanton Waadt. Diese grossen Bandbreiten der Gemeindeverschuldung sind unter anderem eine Folge davon, dass die Aufgabenteilung und die Finanzströme zwischen den Kantonen und ihren Gemeinden in unserem föderalistischen System stark unterschiedlich geregelt sind.
Für die Gemeinden stellt sich die Frage, welche Neuverschuldung zu erwarten ist und wie die Fälligkeiten der bestehenden Darlehen auf der Zeitachse verteilt sind. Die Gemeinden müssen in einer umsichtigen Finanzplanung diese und weitere Einflussfaktoren analysieren. Zudem sollten sie sich mit einer Finanzstrategie Grenzen für die Verschuldung setzen und mit entsprechenden Massnahmen bei den laufenden Kosten, den Investitionen und den Einnahmen sicherstellen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden.
Im heutigen Zinsumfeld lohnt es sich für die einzelne Gemeinde besonders, folgende Grundsätze für das Schuldenmanagement zu beachten:
- Brutto- und Nettoschulden begrenzen;
- Kapital- und Zinsbindung der Kredite regelmässig analysieren und gezielt steuern;
- in der Finanzplanung auch die Auswirkungen eines Zinsanstiegs simulieren;
- Flexibilität wahren (zum Beispiel Rückzahlung Schulden, Nutzung offener Kreditlimiten);
- Laufzeiten von neuen Finanzierungen planen (bei hohem Zinsniveau allenfalls kürzere);
- Fälligkeit der Festzinsdarlehen auf der Zeitachse staffeln;
- überschüssige Liquidität zinsbringend anlegen;
- bei Finanzierungen mehrere Offerten von Banken und Nichtbanken einholen.
Das sind auch Punkte, auf welche die Stimmberechtigten achten sollten und die beispielsweise in einer Gemeindeversammlung beim Traktandum Rechnung/Budget gegebenenfalls zur Sprache gebracht werden können.