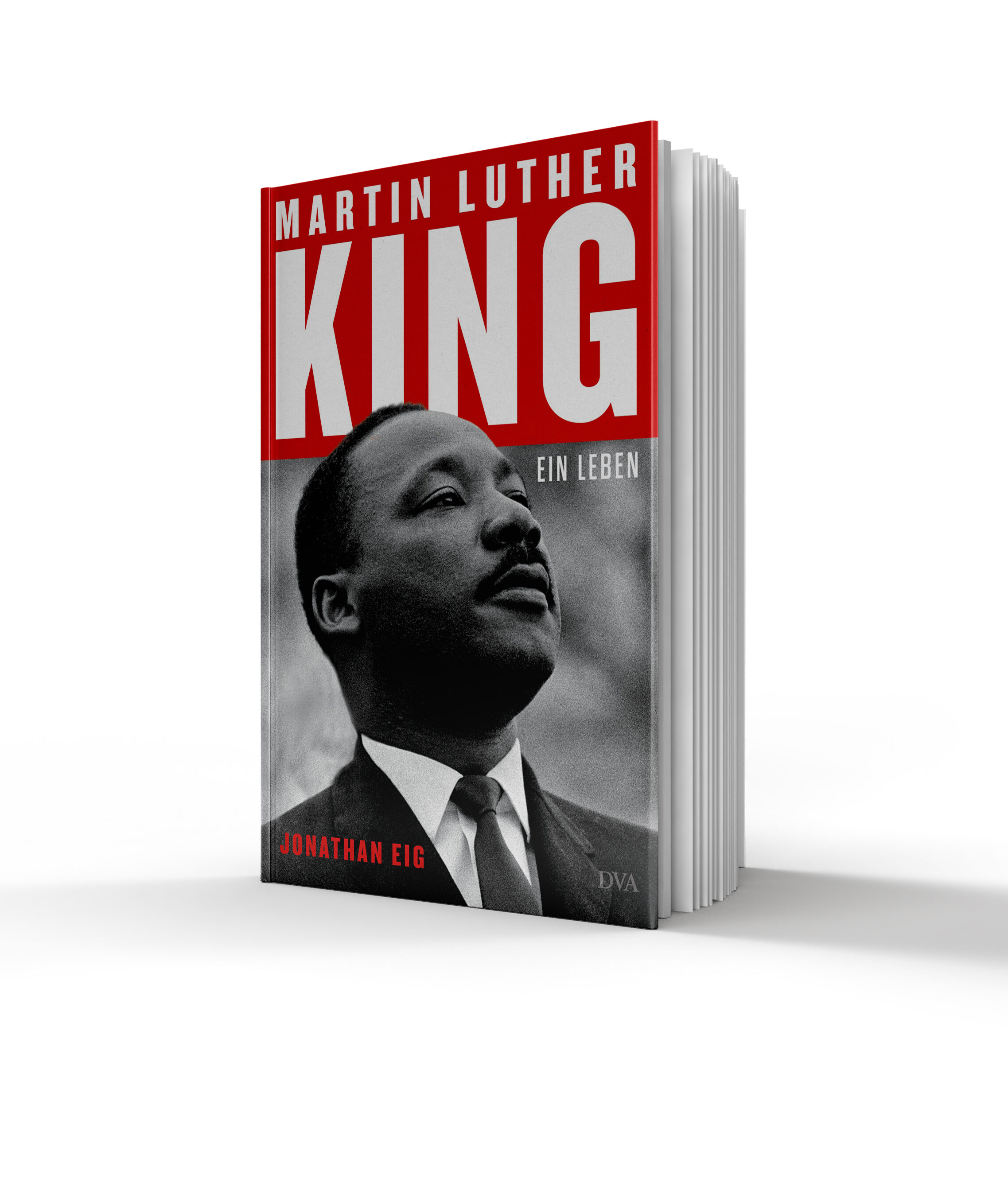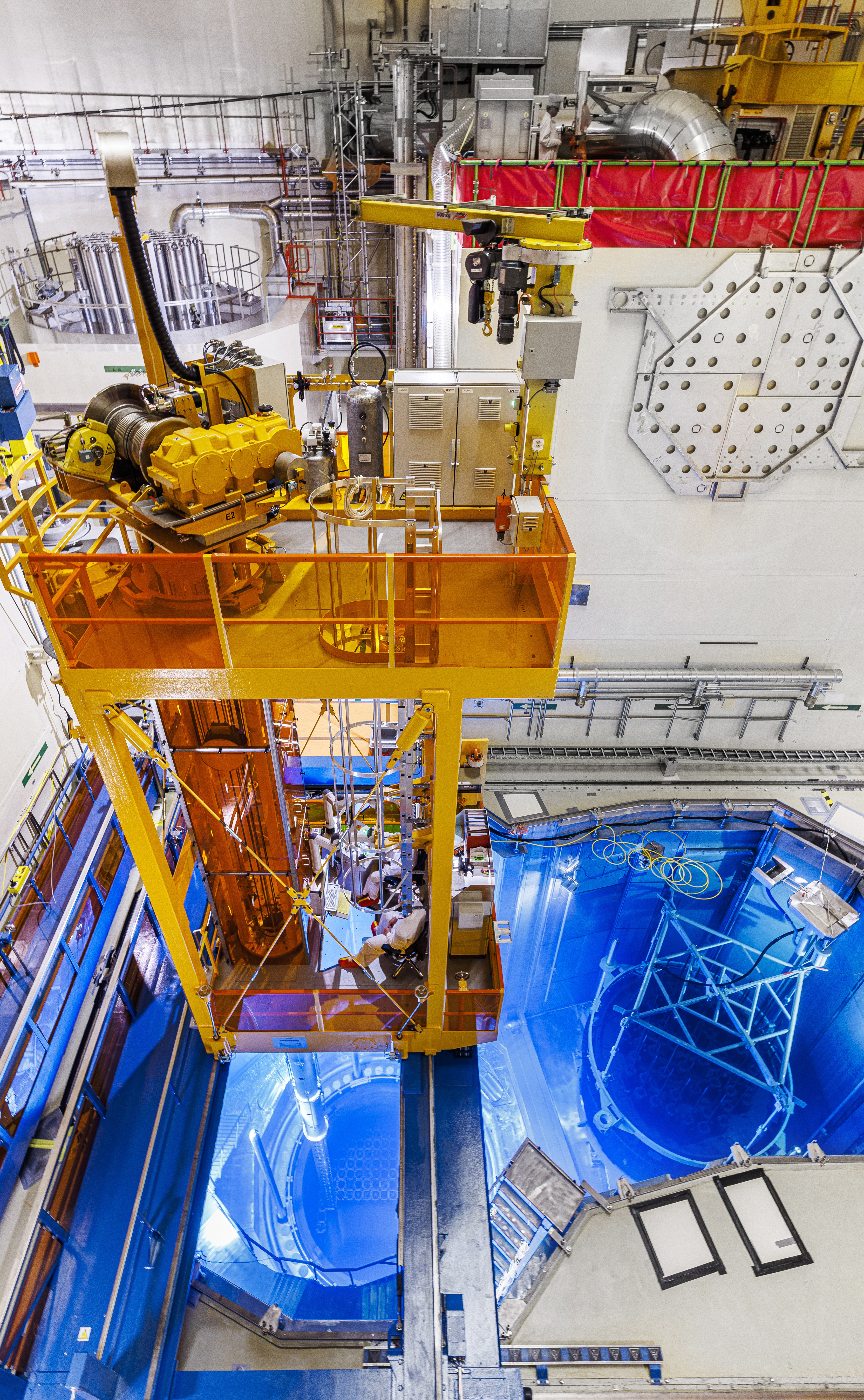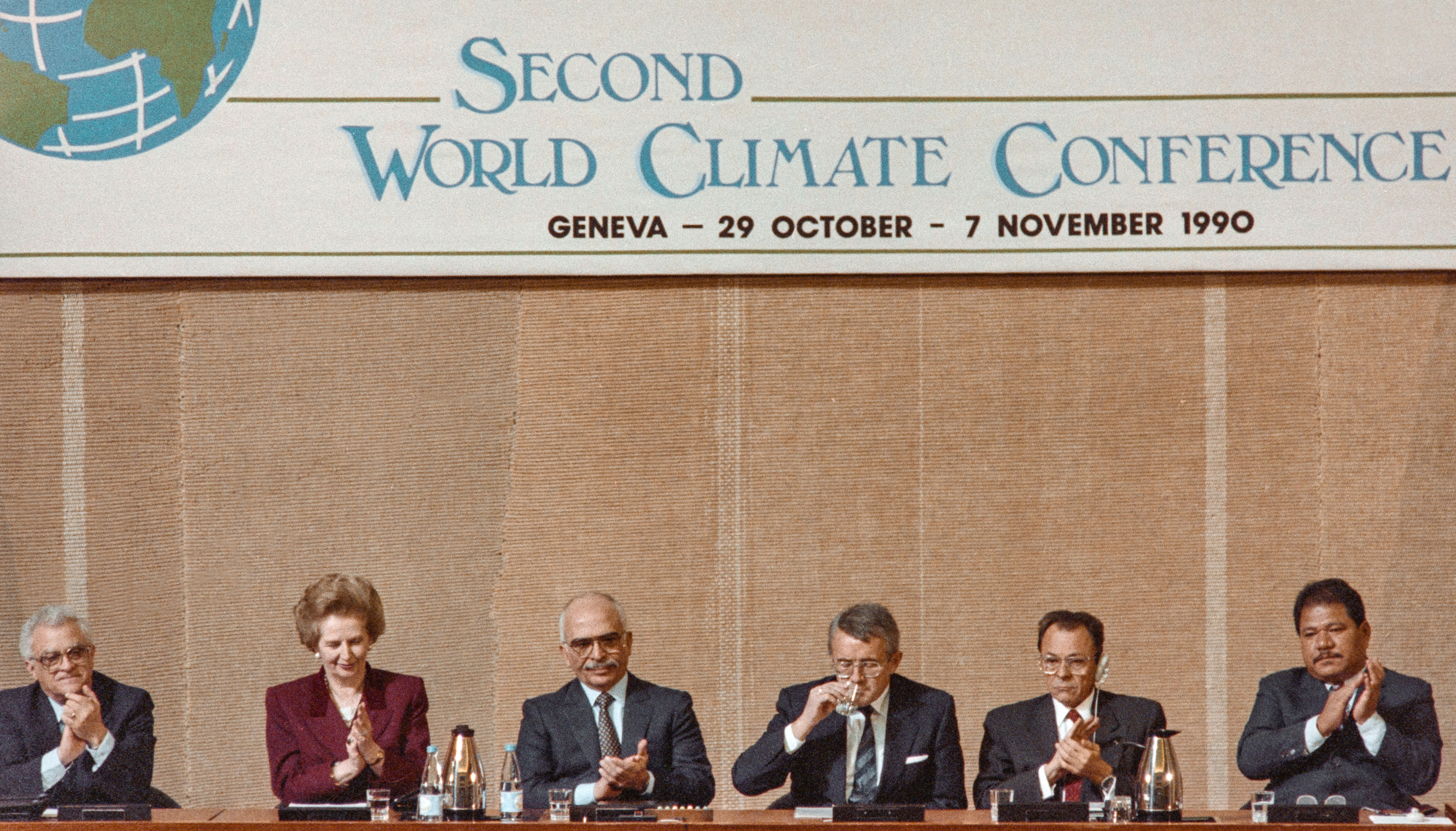Netto-Null ist eine Mogelpackung
Die CO2-Emissionen bis 2050 auf null zu reduzieren, ist unerreichbar, wenn man sachgerecht und ehrlich rechnet. Die einzige Lösung wäre ein sofortiger Ausbau der Kernenergie.

Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens hat sich die Schweiz zu «netto null» CO2-Emissionen bis 2050 verpflichtet. Dieses Ziel wurde mit dem Klima- und Innovationsgesetz, welches das Volk vergangenes Jahr angenommen hat, auch gesetzlich verankert.
Im Kern erfordert Netto-Null einen Totalumbau der Energieversorgung. Es geht um den vollständigen Verzicht auf fossile Brenn- und Treibstoffe und den Umstieg auf eine nahezu vollständige Energieversorgung mit Strom. Voraussetzung dafür ist, dass Strom Tag und Nacht, jeden Bruchteil einer Sekunde zuverlässig zur Verfügung steht.
«Im Kern erfordert Netto-Null einen Totalumbau der Energieversorgung.»
Doch Netto-Null ist eine Mogelpackung. Denn die CO2-Emissionen, welche bei der Produktion der benötigten Materialien und Systeme für Photovoltaik (PV) und Windkraft (WK) anfallen, werden nicht berücksichtigt; sowohl Sonnen- als auch Windenergie sind Lösungsansätze mit sehr geringer Energiedichte und erfordern grossen Aufwand an Material und damit «grauer» Energie und folglich CO2-Emissionen. Setzt man den anrechenbaren «grauen» CO2-Ausstoss von Nuklearanlagen auf 100 Prozent, so liegen die entsprechenden Werte für Hydroanlagen bei 570 Prozent für Solarkraft und bei 1070 Prozent für Windkraft – beide Werte inklusive des CO2-Aufwands der notwendigen Pumpspeicherung.
Wichtig in der Analyse verschiedener Produktionsmethoden ist zudem die Unterscheidung zwischen Bandstrom und Flatterstrom. Um Flatterstrom aus Wind und Sonne verbrauchergerecht aufzuarbeiten, müssen bis zu 90 Prozent der Energie über eine Zwischenspeicherung geleitet werden, was mit erheblichen Verlusten verbunden ist. Das bedeutet, dass die Speicherkapazitäten und auch das Stromnetz deutlich ausgebaut werden müssen. In unseren Breitengraden produzieren PV-Anlagen nämlich rund zwei Drittel des Stroms im Sommerhalbjahr. Der Stromverbrauch dagegen verhält sich reziprok, ist also im Winterhalbjahr deutlich höher.
Unrealistische Wasserstoffstrategie
Unverzichtbare Verbrennungsprozesse müssten mit Wasserstoff erfolgen, und dieser müsste seinerseits CO2-frei hergestellt werden. Die bisherige Diskussion geht von der simplen Vorstellung aus, Wasserstoff könne jederzeit in ausreichender Menge importiert werden, so wie gegenwärtig das Naturgas. Man glaubt, man könne den Wasserstoff über die bestehenden Erdgaspipelines transportieren und auf ähnliche Weise in Speichern lagern. Auch wird oft angenommen, mittels einer Wasserstoffstrategie liesse sich der Ausbau grosser, saisonaler Hydropumpspeicheranlagen umgehen.
Doch auf eine Wasserstoffimportstrategie kann die Schweiz nicht aufbauen. Denn die EU-Mitgliedstaaten werden, um den eigenen Netto-Null-Zeitrahmen bis 2050 einzuhalten, selbst grosse Mengen Wasserstoff benötigen; sie werden deshalb keine Kapazitäten für Exporte haben. Eine Wasserstoffstrategie unter Berücksichtigung des vorgegebenen Zeithorizonts ist nicht realistisch, wie eine kürzlich durchgeführte Studie1 aufzeigt; für den kompletten Umbau der Schweizer Energieversorgung bleiben nämlich nur gerade 26 Jahre. Was über eine Zeitperiode von über 150 Jahren aufgebaut wurde und zuverlässig funktioniert, wäre in kürzester Zeit zu ersetzen. Wir betreten hier Neuland, Erfahrungen für die notwendigen Grössenordnungen fehlen.
Wasserstoffgas ist auch bekannt unter der Bezeichnung «Knallgas», was auf dessen sehr leichte Entzündlichkeit hinweist. Wasserstoff ist in der Atmosphäre sehr flüchtig, leicht entzündbar und hat eine extrem hohe Flammenausbreitungsgeschwindigkeit. Bestehende Anlagen wie Pipelines, Speicherbehälter, Ventile, die auf den Transport von Naturgas ausgelegt sind, können nicht oder nur beschränkt verwendet werden. Ein grosser Teil des verwendeten Materials wäre nicht dicht oder würde nach kurzer Zeit spröde und Rissbildung zeigen.
Option 1: Elektrolyse mit Solar- oder Windstrom
Welche weiteren Optionen gibt es? Gemäss den geltenden politischen Vorgaben (Energiegesetz, Verbot von Kernkraft) nehmen wir an, dass die Stromproduktion mittels Solar- oder Windanlagen erfolgt. Mit den getroffenen Annahmen2 und den gegebenen Voraussetzungen müssten im Falle der Basisproduktion durch Solar- oder Windkraft pro Jahr 5,1 Millionen Tonnen Wasserstoff produziert werden, was nominal eine Leistung von 380 Gigawatt (GW) aus Photovoltaik oder nominal 153 GW aus Windkraft erforderlich macht. Der Landverschleiss der PV-Variante läge bei rund 12 200 km2 und derjenige der WK-Variante3 bei rund 105 200 km2.
Option 2: Kernenergie
Würde man die Nuklearoption in Betracht ziehen, so reicht die Installation von 19 GW Leistung, die etwa eine Fläche von 3 km2 beanspruchen würden. Diese gegenüber PV und WK drastische Reduktion von Leistungs- und Flächenbedarf rührt unter anderem auch daher, dass nur noch der Nutzverkehr mit Wasserstoff versorgt werden müsste. Konsequenterweise werden mit diesem Schritt auch die Lagerungs- und Transportkosten wesentlich reduziert. Zudem entfällt der Bedarf für saisonale Speicher vollständig.
Option 3: synthetische Brenn- und Treibstoffe («Synfuel»)
Aus Wasserstoff und CO2 kann man synthetische Treib- und Brennstoffe herstellen. Der zusätzliche Energieaufwand4 hätte zur Folge, dass die zu installierende Leistung für PV auf 623 GW und für WK auf 251 GW erhöht werden müsste. Dies selbstverständlich mit der proportional einhergehenden Landbeanspruchung von 20 000 km2 für die PV- und 172 500 km2 für die WK-Variante. Im Fall der Nuklearoption müsste die Kraftwerksleistung lediglich auf 21,5 GW erhöht werden.
Die globale Perspektive
Die drei grössten Emittenten von CO2 mit insgesamt 19,4 Milliarden Tonnen pro Jahr5 sind China, USA und Indien. Unter der Annahme, dass die Schweiz ihren Ausstoss ab 2024 linear bis 2050 auf Netto-Null verringert, würde sie jährlich insgesamt 500 Millionen Tonnen CO2 emittieren. So viel wird von China, USA und Indien heute in 9,5 Tagen ausgestossen.
Der Fortschritt zur Erreichung der globalen Netto-Null-Ziele wird in den aufstrebenden Ländern Südostasiens entschieden, wo die Mehrheit der Menschen lebt:
– China nimmt trotz kontinuierlichem Ausbau von Kernkraftwerken immer noch laufend neue Kohlekraftwerke in Betrieb: Rund 90 Prozent der aktiven Teile von PV-Anlagen kommen aus China, produziert mit Kohlestrom.
– Die indische Regierung hat über die Jahre mehrfach klargemacht, dass die Reduktion von Armut vor Netto-Null komme, ergo billiger Kohlestrom zum Einsatz komme.
– Indonesien ist heute global der grösste Produzent von Nickel, einem Element, das für die Batterieherstellung gebraucht wird. Zum Ausbau der Produktionskapazitäten setzt auch Indonesien auf mehr Kohlekraftwerke.
– Europa setzt auf PV- und E-Mobilitäts-Technik, deren Produktion zu grossen Teilen auf Kohlestrom aus Südostasien beruht. Und das wird noch bis weit über das Jahr 2050 hinaus so sein.
Immense Kosten
Um Netto-Null bis 2050 zu erreichen, ergeben sich folgende Kosten:
– Photovoltaik: 571 200 Milliarden Franken
– Windkraft: 344 200 Milliarden Franken
– Nuklearenergie: 125 500 Milliarden Franken.
Berechnet wurden nur die Anlagekosten für die Stromproduktion, ohne den zusätzlichen Leistungsbedarf für die «Synfuel»-Option. Trotz den ursprünglichen Versprechen der Politik, Solar und Wind seien ab 2022 selbsttragend und bedürften keinerlei Subventionen mehr, wissen wir heute, dass dies bei Weitem nicht der Fall ist. Besonders die etablierten Unternehmungen der Strombranche rufen nach weiterer staatlicher Förderung zum Ausbau dieser Systeme, was eine zusätzliche Belastung des Steuerzahlers respektive des Energiekonsumenten bedeutet. Die Nuklearoption liesse sich dagegen wie bisher üblich über den Finanzmarkt finanzieren.
Fazit: Der Umbau des Energiesystems auf der Basis PV oder WK ist bis 2050 nicht umsetzbar. Dieser Ansatz wird bereits an der notwendigen Landfläche scheitern. Ein weiterer limitierender Faktor sind die Arbeitskräfte und die Verfügbarkeit von Material.
Es stellt sich die Frage, ob uns eher das Klima oder eher undurchdachte technische und ökonomische Kraftakte in den Abgrund führen werden. Setzt man die Priorität auf den Klimaschutz, so wird die Schweizer Volkswirtschaft sicherlich derart ruiniert, dass sie die angeordneten Massnahmen nicht mehr stemmen kann.

Die politische Schweiz muss dringend umdenken. Der eingeschlagene Weg ist nicht wie geplant umsetzbar. Möglich werden kann Netto-Null 2050 nur, wenn Kernkraftwerke gebaut werden. Und zwar so schnell wie möglich.
«Wasserstoff – Heilmittel zur Sicherung der schweizerischen Energieversorgung?», CCN Blog http://www.c-c-netzwerk.ch ↩
E-Mobilität (PW) wird auch in Zukunft auf Basis Batterie beibehalten und löst Verbrenner vollständig ab. Der Schwerverkehr wird mit Wasserstoff als Treibstoff betrieben. Strom für den Betrieb von Wärmepumpen wird durch Gas-Kombikraftwerke, welche mit Wasserstoff betrieben werden, generiert. Ebenso für Strom für weitere Verbraucher, besonders für die Wasserstoffinfrastruktur. ↩
Die Berechnung beruht auf dem Mittelwert der Abstandsregeln für Hessen und Bayern. ↩
Energieaufwand: 33,8 kWh/kg. ↩
Hochgerechnet auf das Jahr 2023. ↩