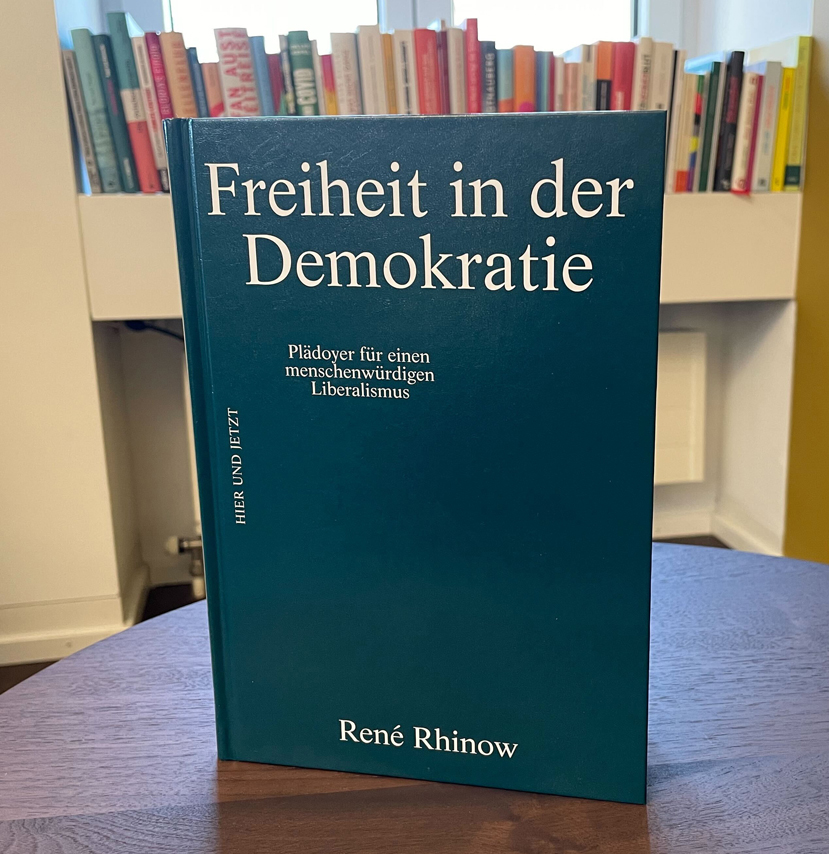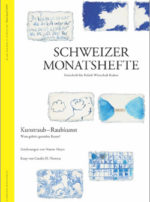Gruppentherapien gegen die Apokalypse
Der Klimawandel steht bei Hochschulen ganz oben auf der Agenda. Auf einem Streifzug durch Workshops und Seminare haben wir uns in Verzicht geübt, für die Umwelt gerappt und gelernt, wie man Schüler zum Klimaschutz erzieht.

Durch Verzicht zum «guten Leben»
Suffizienz-Workshop, Kulturpark Zürich, 17. Februar 2024.
Wir stehen im Kreis, verbunden durch ein rotes Seil. Dieses hat sich zuvor von einer Person zur nächsten entsponnen, wobei jede erklärt hat, was sich als «roter Faden» durch ihr Leben ziehe. Gerechtigkeit, sagt jemand; jemand anderes nennt die Moral; ein dritter Neugier. So stehen wir, durch unsere Geschichten vernetzt, zusammen. Schnell wird mir klar: Der Workshop, zu dem ich mich angemeldet habe, ist vor allem eine Gruppentherapie.
«Suffizienz» ist das Thema des Workshops, der schon mehrmals stattgefunden hat und vom Zurich Knowledge Center for Sustainable Development organisiert wird. Das Zentrum wird von der Universität Zürich (UZH), der Pädagogischen Hochschule (PH), der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) getragen. Ein Vortrag eines Mitarbeiters setzt den Ton: Wir übernutzen die Ressourcen unseres Planeten – «wir», das sind primär die reichen Länder, welche die armen ausbeuten. Treiber sei das Wachstum, das sich «in unserem Denken» festsetze. Effizienz sei keine Lösung, was es brauche, sei weniger. «Weniger Auto fahren ist besser!», lehrt uns der Mitarbeiter auf einer Folie.
Auf diese Denkweise eingeschworen, sollen die rund ein Dutzend Teilnehmer zunächst aufschreiben, wo sich der Wachstumsgedanke in unser eigenes Denken eingeschlichen hat. (Ich bin versucht, das Budget von aktivistischen Forschungsstellen an der Universität zu erwähnen, lasse es dann aber.)
Anschliessend sollen wir Lösungen für mehr Suffizienz in verschiedenen Bereichen entwickeln. Die Stimmung schwankt zwischen Verzweiflung über den Zustand der Welt und Hoffnung für die Zukunft. Was mich erstaunt, ist, wie einig sich offenbar alle sind. Alle scheinen die Ausgangsthese anzunehmen, gemäss welcher der Mensch vor allem schadet, Wachstum des Teufels ist und die Welt kurz vor dem Untergang steht. Das Einzige, was uns noch retten kann, so die Idee, ist Verzicht.
«Die Stimmung schwankt zwischen Verzweiflung über den Zustand der Welt und Hoffnung für die Zukunft.»
Das Ziel der Organisatoren des Workshops ist die Suche nach «Formen des Wohlergehens, die nicht auf Wachstum des materiellen Konsums beruhen», wie es auf ihrer Website heisst. Weil viele Menschen verachtenswerterweise dennoch gerne Strandferien machen und ein Smartphone benutzen, verfolgen die Workshops auch das Ziel, «kollektiv-strukturelle Veränderungen in Richtung Suffizienz anzustossen». Sprich: Wenn die Menschen das «gute Leben» ohne Wachstum nicht von selbst für sich entdecken, müssen sie «kollektiv» – also vom Staat – darauf gebracht werden.
So wird der Workshop von der Gruppentherapie zur Therapie für die ganze Gesellschaft. Mit freundlicher Unterstützung staatlicher Hochschulen. (lz)
Rappen über Bioseife
Environmental Rap Battle, ETH Zürich, 11. März 2024.
Das Ziel der «Environmental Rap Battle» im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche ist es, «improvisierten Rap als kreatives Ventil zu nutzen, um unsere Gefühle auszudrücken und Gespräche für positive Umweltveränderungen anzustossen» – um den Planeten zu schützen.
Sechs junge Frauen, dem Anschein nach allesamt Studentinnen unter dreissig, stehen in einem Kreis und spielen ein Wortassoziationsspiel. Ich sitze abseits und mache mir Notizen. Sie werfen sich gegenseitig abwechselnd Wörter zu, von denen sie glauben, dass sie in irgendeiner Weise zusammenhängen. Von «Kleidung, Kosten und Konsum» geht es über zu «Wachstum, Wachs, Insektizide, Bauer, Biodiversität» und hin zu «ausgestorben, Friedhof, Tod, Leiche, Geburt, Neuanfang, Gegenwart, Jetzt».
Dann beginnt der musikalische Teil der Veranstaltung. Rhythmische Musik spielt im Hintergrund. Wir werden angewiesen, passend zum Beat unseren eigenen Rap auf ein Blatt Papier zu schreiben. Eine Teilnehmerin kommt auf diese Zeilen: «I wash my hands with organic soap, while wishing for a world full of hope, planting organic trees, that’s how we pay our fees…» Eine andere geht auf den Fleischkonsum ein: «If you eat everyday your steak, don’t say climate change is fake (…) I’m riding on my bike, going to the next strike.» Eine weitere hat ihren Laptop mitgebracht, mit Aufklebern, die «No plane, no gain», «make love, not CO2» und «Klimademo Bern» verkünden.
Von seinen Wurzeln her ist Rap subversiv, gesellschaftskritisch und unbequem. Die an der ETH vorgebrachten Reime liegen dagegen voll auf Linie des Zeitgeists. Bleibt abzuwarten, ob sich Snoop Dogg überzeugen lässt, seinen Ferrari 458 gegen ein E-Bike einzutauschen und sich nur noch mit Bioseife zu waschen. (as)
Mit veganen Apéros zu Netto-Null
«Deliberation for More Sustainability at IPZ», Universität Zürich, 12. März 2024.
Studenten des Zürcher Instituts für Politikwissenschaft (IPZ) veranstalteten im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche einen Workshop, um darüber zu sinnieren, wie das Institut noch klimafreundlicher werden könne.
Wir sitzen im Kreis in einem kleinen Seminarraum des Uni-Campus in Oerlikon. Bevor es richtig losgeht, werden alle aufgefordert, aufzustehen, um «Aufwärmübungen» zu machen. Jeder Teilnehmer soll seinen Namen vorstellen und dazu eine erfundene Bewegung machen. Ein unorthodoxer Beginn des Workshops.
Anschliessend hält Leonard Creutzburg, Projektleiter des UZH-Nachhaltigkeitsteams, einen kurzen Inputvortrag. Die Universität Zürich habe sich, orientiert an der UNO-Agenda 2030, dem Ziel verschrieben, bis 2030 klimaneutral zu werden. Die Fakultäten der Uni Zürich hätten die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Massnahmen zu ergreifen seien, um das Ziel zu erreichen. Eingeschränkt werde die Freiheit nur von einer Vorgabe: Die Massnahmen müssten mit der «Diversity»- und «Gender»-Policy der Uni im Einklang stehen.
Als grosse Herausforderung stellt sich die Reduktion von Flugreisen von UZH-Mitarbeitern heraus. Creutzburg schlägt vor, dass für Mitarbeiter ein CO2-Budget für Flugreisen eingeführt werde.
Nach dem Referat folgt ein langes Brainstorming unter den anwesenden Studenten, welche weiteren nachhaltigen Massnahmen für das IPZ zu ergreifen seien. Ein Student schlägt die Reduktion der Gebäudeheiztemperatur um 2 Grad vor, ein anderer die Installation von Solarzellen auf den Dächern.
Ganz zum Schluss erarbeiten die Studenten in zwei grossen Gruppen jeweils ein schriftliches Proposal. Während die eine Gruppe fordert, dass die IPZ-Apéros künftig 100 Prozent vegan sein sollen, plädiert die andere Gruppe für mehr Nachhaltigkeitskurse an den Universitäten. (ms)
Kindgerechter Klimaalarm
WWF-Workshop zu Schulbesuchen, Pädagogische Hochschule Zürich, 13. März 2024.
Es ist halb elf vormittags. In einem Seminarraum der PH Zürich präsentiert eine Mitarbeiterin des WWF, was die Umweltschutzorganisation bei Schulbesuchen den Kindern beibringt. Das Ziel der Schulbesuche sei, Kinder durch Spiele und Experimente auf die Gefahren des Klimawandels hinzuweisen. Am Workshop nehmen 15 junge Lehrer teil.
Zu Beginn müssen sie ein Puzzle mit Fakten über Eisbären lösen. Der Eisbär sei durch das Abschmelzen der Nordpolkappe vom Aussterben bedroht, so die WWF-Mitarbeiterin. Er steht als pars pro toto für die Gefährdung von Fauna und Flora durch den Klimawandel.

Alle im Workshop durchgeführten Spiele und Experimente werden auch bei den Schulbesuchen zusammen mit den Kindern gemacht. Nachdem der Eisbär abgehandelt ist, füllt die WWF-Vertreterin zwei Miniaturgloben in der Grösse eines Bleistiftspitzers jeweils zu zwei Dritteln mit Wasser. Von diesen Globen wird einer mit einer Glasschale zugedeckt, welche die Erdatmosphäre simulieren soll. Anschliessend werden die beiden Miniaturgloben mit einer Wärmelampe erhitzt. Dann misst die Mitarbeiterin die Wassertemperatur der Globen. Jener, der zugedeckt worden ist, weist eine höhere Temperatur auf – wegen des Treibhauseffekts. Beweisführung abgeschlossen.
Die Leiterin des Workshops stellt danach Bilder vom Aletschgletscher aus den Jahren 1990 und 2004 einander gegenüber. Die Aufnahmen zeigen einen enormen Rückgang, der auf den Klimawandel zurückzuführen sei.
Gegen Ende des Workshops müssen die Teilnehmer klimaschützende Massnahmen und klimaschädliche Massnahmen jeweils einer lachenden oder schwitzenden Sonne zuordnen. Windräder und Photovoltaikanlagen gelten als klimafreundlich. Über die Schattenseiten der erneuerbaren Energien fällt kein Wort.
«Die Teilnehmer müssen klimaschützende Massnahmen und
klimaschädliche Massnahmen jeweils einer lachenden
oder schwitzenden Sonne zuordnen.»
Als ich die Veranstaltung verlasse, weiss ich nicht, worüber ich als Schüler mehr besorgt wäre: über den Klimawandel oder das einseitige Bild, das der WWF zeichnet. (ms)
Willkommene Häresie
Seminar zu Marxismus und Nachhaltigkeit, ETH Zürich, 13. März 2024.
Als ich im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche an der ETH von einem Seminar mit dem Titel «Erforschung der Verbindung zwischen Marxismus und ökologischer Nachhaltigkeit» höre, erwarte ich eine marxistische Indoktrinierung, bei der Dissens aus dem Publikum mit aggressivem verbalem Widerstand beantwortet wird. Doch es kommt anders.
Denn Alex Buxeda, der spanische Host des Podcasts «Escaping Mediocrity» und einziger Redner an diesem Seminar, ist ein Libertärer. In seiner Eröffnungsrede verurteilt er sowohl den Marxismus als auch den Ökologismus. Deren Gemeinsamkeit? Beide würden staatliche Interventionen in den freien Markt befürworten.
Weitere Referate gibt es nicht, obwohl auf der Webseite der Veranstaltung versprochen worden ist, dass Wissenschafter aus den entsprechenden Fachgebieten anwesend sein würden. Denn keiner derjenigen, die er als Experten eingeladen hat, ist seiner Einladung gefolgt. Buxeda erklärt diesen Umstand mit «Cancel Culture» innerhalb der akademischen Welt.
Buxedas Hauptthese lautet: Der Grund für die Staatsgläubigkeit der beiden Ideologien Marxismus und Ökologismus sei, dass beide der Menschheit nicht vertrauten, ihre Probleme durch Innovation und Kreativität ohne katastrophale Folgen zu lösen. Dieses Misstrauen sei ungerechtfertigt, denn die Entwicklung der menschlichen Geschichte seit dem Beginn des Kapitalismus zeige deutlich, dass die vermeintlich natürlichen Grenzen des Wohlstands immer wieder überwunden worden seien. Aus dieser Argumentation treten Buxedas Sympathien für den freien Markt, in dem sich der menschliche Erfindungsgeist frei entfalten könne, klar hervor. «Der menschliche Einfallsreichtum ist die Lösung für jeden Engpass», sagt er.
Anschliessend wird das Publikum einbezogen, und es beginnt eine zivilisierte Diskussion über die Definition des Marxismus und die Gegensätze zwischen grünem Denken und Marxismus. Statt Indoktrination erlebe ich an dem Seminar eine Debatte ganz im Sinne der wissenschaftlichen Tradition. (as)
«Statt Indoktrination erlebe ich an dem Seminar eine Debatte ganz im Sinne der wissenschaftlichen Tradition.»
«Are we fucked?»
Workshop «I Want a Better Catastrophe», Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Winterthur, 13. März 2024.
In einem Nachhaltigkeitsworkshop befassten sich ZHAW-Studenten mit der Frage, wie sie mit der Angst vor der drohenden Klimakatastrophe besser umgehen können.
«Ich möchte nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid, ich möchte, dass ihr in Panik geratet», sagte Greta Thunberg 2019 am Weltwirtschaftsforum in Davos. Aus Thunbergs Sicht soll die Panik die Menschen dazu bewegen, die Klimakatastrophe zu stoppen. Viele spüren allerdings angesichts der Herausforderung eine grosse Ohnmacht.
Die beiden ZHAW-Studenten Marion und Nico wollen diese Ohnmacht mit einem Workshop angehen. Die Fragestellung lautet: «Wie können wir damit umgehen, dass wir möglicherweise das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen? Wie können wir trotzdem weitermachen?»
Zu Beginn des Workshops werden wir dazu aufgefordert, uns zu bestimmten Fragen von 1 bis 10 zu positionieren; die Wände des Seminarraums stellen die Enden des Spektrums dar. Bei der Frage, ob noch Hoffnung bestehe, dass wir den Klimawandel aufhalten können, stehen die meisten Studenten in der pessimistischen Hälfte. Auch bei der Frage, ob die Klimakrise Angst mache, ist die Mehrheit auf der ängstlicheren Seite.
Nach zahlreichen Fragen erklären Marion und Nico, dass grundsätzlich drei Ebenen des Engagements gegen den Klimawandel existierten: Wer «Business as usual» betreibe, sei passiv und nehme keine Änderungen in seinem Leben vor. Leute auf der «Do not harm»-Ebene würden versuchen, schädliche Dinge zu vermeiden. Wer sich auf der «Make the world better»-Ebene bewege, setze sich aktiv für eine bessere Welt ein.
Anschliessend sollen wir auf Post-its aufschreiben, was wir bereits persönlich für das Klima tun und wo wir uns aktiv engagieren. Unter «Do not harm» liest man auf der Pinwand: «Viel mit dem Velo unterwegs sein», «Möglichst wenig fliegen» oder «Food Waste vermeiden». Unter «Make the world better» schlagen die Studenten zum Beispiel vor, für andere klimafreundlich zu kochen, empathisch auf Alternativen hinzuweisen oder selbst Gemüse anzubauen.
«Wir sollen auf Post-its aufschreiben, was wir bereits persönlich für das Klima tun und wo wir uns aktiv engagieren.»
Marion und Nico weisen darauf hin, dass es auch gute Nachrichten gebe. Die ZHAW-Mensa sei deutlich klimafreundlicher geworden, da es mittlerweile vegane Menüs zur Auswahl gebe. Zum Abschluss diskutiert die Runde darüber, was den Studenten Mut machen könnte. Einer beschreibt als Motiv sein Gefühl, das «Richtige» zu tun. Jemand anderes spricht von «Sinnhaftigkeit».
Das Résumé aus Veranstaltersicht? Auf die saloppe Frage «Are we fucked?» antwortet Nico mit «vielleicht». Dennoch lohne es sich, weiterzumachen. Gerade aus dem Aktivismus schöpfe er Mut und komme aus der Ohnmacht.
Der Workshop wirkt wie eine Selbsthilfegruppe für Klimaaktivisten; er zeigt auf, in welcher lähmenden Angst sich heutzutage viele Klimaaktivisten befinden. Kein Wunder, wenn Medien, Politik und Wissenschaft seit gut zwei Jahrzehnten auf allen Kanälen irrationalen Klimaalarmismus verbreiten. (ms)