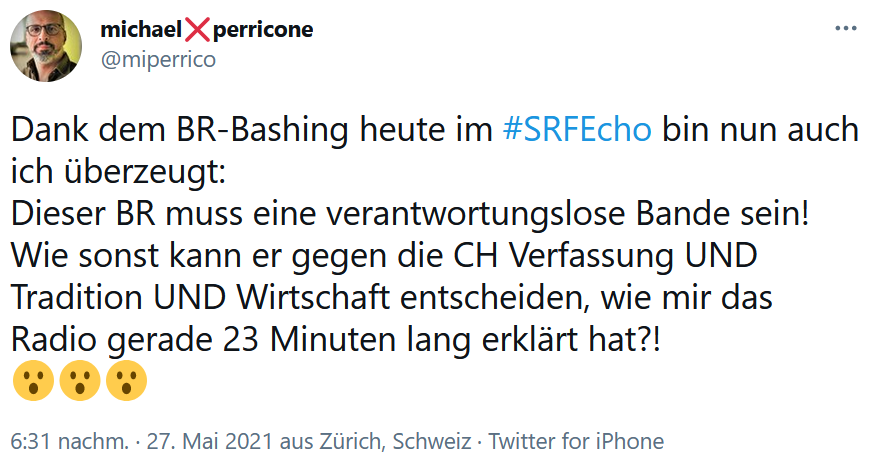Klare Spielregeln
Was ist das Antidot zum heutigen Kapitalismus? Der Sozialismus hat abgewirtschaftet, auch wenn neuerdings einige marxistische Wiedergänger-Intellektuelle dies modisch leugnen. Ist das Antidot zum Kapitalismus also vielleicht doch – der gute alte Kapitalismus? Er ist jedenfalls gemeinwohlverträglich – wenn man ihn lässt.

Die Suche nach dem Antidot
Was wäre somit, nachdem der sozialistische Antikapitalismus abgewirtschaftet hat, als Gegenstück zum Kapitalismus verblieben, das wir zur Schärfung der Konturen seines Begriffs nutzen könnten? Was wäre zum Kapitalismus das historisch-politisch verbliebene Antidot? Einer zweckmässigen Beantwortung dieser Frage kommt man näher in der Beschäftigung mit den Gründen, die den Zusammenbruch des antikapitalistischen Sozialismus keineswegs zu einem unbestreitbaren Triumph des Kapitalismus haben werden lassen – nicht, weil der gescheiterte Sozialismus in einem höheren oder tieferen Sinne doch recht gehabt hätte, vielmehr kraft fortdauernder Weigerung, die unentbehrlichen Funktionen des Kapitalismus in einem auch sozialstaatlich dauerhaft leistungsfähigen Wirtschaftssystem einzusehen und anzuerkennen. Von diesen unentbehrlichen Funktionen lässt sich heute freilich illusionsfrei nur reden, wenn man die selbstschädigungsträchtigen Umstände, ja Skandale mitbenennt, die Medienkonsumenten inzwischen immer wieder einmal an der Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus zweifeln lassen – von der Verzweiflung zahlloser Kleinanleger, die zum Zweck der Sicherung einer finanziell gehobeneren Altersverbringung ihr Sparkapital inkompetenten Vermögensverwaltungen anvertraut hatten, bis zur hoffnungslosen Privatverschuldung ehemaliger Hauseigentümer, die zu Opfern offerierter und vermeintlich tragfähiger hypothekarischer Vollfinanzierung ihrer kleinen Liegenschaft geworden waren, und von den verblüffenden Dimensionen des Grossbetrugs mittels verheissungsvoller, tatsächlich aber kettenfinanzierter Gewinne auf anvertraute Barmittel bis hin zu den ansehensdestruierenden massenme-dialen Berichten über historisch singuläre Einkommenssteigerungen für Banker oder über Boni für Bankergehilfen bei Absatzerfolgen mit sogenannten «Produkten», deren Sicherheitshintergrund ihnen selbst gänzlich unerkennbar geworden war.
Das Bankgewerbe, gewiss, war immer schon in der Verlässlichkeit seiner Leistungen ungleich mehr noch als andere Gewerbe auf Vertrauen angewiesen. Die Geltung, die es gewann und deren es auch im geschäftlichen Sinne bedurfte, entsprach dem Ausmass dieses benötigten und in guten Zeiten tatsächlich bewährten Vertrauens. Jetzt ist grossräumig dieses Vertrauen in die Solidität der Institutionen und Personen beschädigt, die anvertrautes Kapital zu verwahren und zu mehren gehabt haben – gewiss nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus.
Knappheitserfahrungsbefreites Verhalten
Kurz: der Kapitalismus, insbesondere in seiner finanzkapitalistischen Ausprägung, hat eine schlechte Presse. Gleichwohl ist es nicht schwer zu erklären, wieso davon der sozialistische Antikapitalismus – mit Ausnahme einiger weniger marxistischer Wiedergänger-Intellektueller und Bewegungen wie Attac und Occupy Wallstreet – so gut wie gar nicht zu profitieren vermag. Das beruht auf dem gleichfalls jedem Medienkonsumenten vertrauten Faktum, dass schadensstiftender Umgang mit Kapital heute längst nicht mehr allein Sache von Kapitalisten und von Repräsentanten ihrer vermeintlich herrschenden Klasse ist. Möglichkeiten der Nutzung von Kapital mit der Wirkung der Schädigung des Vermögens überwiegend lohnabhängiger Kleinkapitalisten ist längst auch zur Sache sozialstaatlich engagierter Parteien geworden, die sich auf Fälligkeiten der Umverteilung berufen. Auch für die USA, das moderne Land des Kapitalismus, gilt das. Die erwähnte Massengewährung hypothekarisch vermeintlich gesicherter Kredite, die mit gravierenden Schadensfolgen auf den Finanzmärkten in verbriefter Form weltweit verramscht wurden, war parteipolitisch und staatlich abgestützt und rechtfertigte sich als endlich durchgreifende Massnahme der Wohnraumbeschaffung zugunsten kleiner Leute. Überall wächst in hochentwickelten Zivilisationen die Menge wünschbarer und eingeforderter Weltverbesserungen ungleich rascher an als die Menge der Möglichkeiten, sie in den Spielräumen kalkulierbar gehaltener Selbstverschuldung zu finanzieren. Entsprechend eindrucksvoll entwickeln sich fast überall in modernen Ländern die Schuldenstände in den privaten wie in den öffentlichen Haushalten. In markanten Fällen sind sie längst hoffnungslos, und nicht zuletzt in Europa gilt das für etliche Mitglieder der Europäischen Union. Ein Sozialismusromantiker unter den Grossintellektuellen, Jürgen Habermas, fand, nicht zuletzt die «Hauptdarsteller» früher gern sogenannter bürgerlicher Parteien «zappelten» in den Fesseln der «Finanzindustrie» – so zur Zeit ihrer Euro-Rettungskooperationen «Merkel und Sarkozy». Es trifft ja zu: Die Politik hofft hier auf Möglichkeiten der Neuverschuldung von Staaten in der Absicht, Altschulden mit Hilfe niedrigverzinslicher zusätzlicher Kredite bedienbar zu halten, und die hier als Hauptschädiger identifizierte «Finanzindustrie» legte sich mit den Bonitätsbewertungen ihrer Ratingagenturen quer.
Zum Glück tut sie es, so möchte man das kommentieren, nämlich in Erinnerung an die Erfahrung, die jeder Sparer hat machen können, dass Geld ein vernunfttreibendes Medium ist – knappes Geld nämlich. Und eben dafür sorgt doch, unter anderem, der Finanzmarkt mit ordnungspolitisch wirksam gebliebenen Regeln, die auch in der Europäischen Union die Euro-Währungspolitik nicht ausser Kraft zu setzen vermocht hat.
So bitter es ist: Die europäische Gemeinschaftswährung verdankt sich tatsächlich nicht zuletzt dem geldpolitisch gesehen befremdlichen Willen, aufdringlich gewordenen Erfahrungen knappen Geldes zu entkommen. Gewiss: nicht zuletzt deutsche Politiker haben wirklich geglaubt, eine gemeinsame Währung sei ein besonders geeignetes Medium, Nationen heterogener monetärer und fiskalischer Tradition endgültig zusammenzubinden. Die französische politische Führung wusste es besser, beliess aber die Deutschen bei ihrem Glauben, der innerhalb Deutschlands die Euro-Skepsis moralisch inkorrekt werden liess. So befreite Frankreich sich vom lästigen und überdies als prestigeschädigend eingeschätzten Zwang, den Franc dann und wann in Relation zu härteren europäischen Währungen abwerten zu müssen. Als Konsequenz ergaben sich, unter anderem, knappheitserfahrungsbefreite und somit rasch ansteigende Aussenhandelsbilanzdefizite und schliesslich der schon erwähnte Zwang zur Bedienung öffentlicher Schulden durch progressive Neuverschuldung kraft Niedrigzinspolitik der dafür zuständigen transnationalen Zentralbank.
Welches Ende diese währungspolitische Evolution in Europa nehmen wird, ist nicht definitiv abzusehen. Hält man die politisch bequemste Lösung der europäischen Überschuldungskrise für die wahrscheinlichste, so hätten wir mit einer Inflation zu rechnen. Ihre Anfänge sind bereits diagnostiziert und damit der Beginn eines Prozesses, der in der Endkonsequenz seiner kapitalvernichtenden Folgen die Sparer und vorzugsweise die kleinen Leute treffen wird – mit Ausnahme derjenigen selbstverständlich, die sich, wie die Staaten selbst, rechtzeitig ausreichend verschuldet haben.
Das Antidot: ordnungspolitische Regeln
So weit einige zumal europäische Erfahrungen mit dem Kapitalismus postsozialistisch und aktuell. Welches wäre also sein Gegenbegriff, an welchem man sich gemäss aristotelischer Empfehlung zu seinem besseren Verständnis zu orientieren hätte? Einen Gegenbegriff, der, wie der des real existent gewesenen Sozialismus, das Ganze unseres individuellen und kollektiven Lebens umschlösse, gibt es nicht. Es gibt ihn nicht, weil ja auch, anders als die Altsozialisten es sahen und sehen, der Kapitalismus seinerseits das Ganze unseres individuellen und kollektiven Lebens gar nicht umfasst. Den Gegenbegriff zum Kapitalismus bildet entsprechend das politisch ebenso unspektakuläre wie unentbehrliche Ensemble ordnungspolitischer Regeln, die die urkapitalistische Orientierung an Knappheit ebenso unbeschädigt erhalten wie die Möglichkeiten, über Kapitalnutzung Kapital zu mehren – von der Aufsicht über die Einhaltung der Regeln des Bankgewerbes bis zur Selbstbindung der Staaten und ihrer etwaigen Währungsverbünde an die wohlbekannten Regeln geldwerterhaltender Geldschöpfung wie der Budgetkonsolidation.
Wer bändigt den Staatskapitalismus?
Gewiss, wird man sagen und hinzufügen, das alles hätten wir doch schon gehabt – in der Gestalt der sogenannten Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrages zum Beispiel, und kaum einer der verpflichtet gewesenen Staaten habe sich dar-an gehalten. So ist es, und das erzwingt die Frage nach der politischen Gewalt, die in der Lage sein könnte, den korrumpierten und korrumpierenden Staatskapitalismus zu bändigen und zur Einhaltung seiner wohlbekannten ordnungspolitischen Regeln zu zwingen. Die Antwort auf diese Frage ist, im Prinzip der Sache, altbekannt und bewährt. Sie lautet: Mehr Demokratie ist das einzig bekannte Mittel der Staatskontrolle. Gerade auch für den modernen Staat gilt das, der aus zwingenden Gründen ein Staat rasch expandierender Staatsbudgets in Relation zur wirtschaftlichen Wertschöpfung geworden ist. Nicht zuletzt unabweisbare Umverteilungszwecke sind dabei der entscheidende Faktor, und man kennt das Argument, dass just diese Unabweisbarkeit sozialstaatlicher Umverteilungszwecke zugleich ihre demokratische Kontrolle faktisch unwirksam mache – kraft des Interesses der Parteien nämlich, sich über reichliche Klientelbedienung Mehrheiten zu sichern. Der sogenannte Parteienstaat und mit ihm die «politische Klasse», die ihn faktisch managt, ist in vielen Ländern tatsächlich an Grenzen seiner Effizienz angelangt. Wo verbliebe alsdann hier noch die Demokratie als Kontrolleur und Moderator der Staatsmacht? Die Antwort auf diese Frage verlangt weder eine Alternative zur Demokratie noch eine erst noch intellektuell entwurfsbedürftige künftige Superdemokratie, vielmehr das altbewährte, ebenso demokratische wie kapitalismusaffine Verfahren, den Kostenträger wünschbarer und staatlich organisierbarer Neuerungen nicht nur über seine Repräsentanten, vielmehr auch direkt zu seiner Bereitschaft oder Unbereitschaft zu befragen, diese Kosten auch aufzubringen.
Wie befremdlich direktdemokratische Verfahren in etlichen modernen Ländern immer noch wirken, lässt sich, zum Beispiel, an den Verfassungen etlicher deutscher Bundesländer studieren, die allerlei direktdemokratische Verfahren kennen, das aber mit signifikantem Ausschluss steuerlicher oder budgetärer Entscheidungen. Indessen: nie war in modernen Ländern das Wahlvolk wohlhabender als heute, einer verzerrten Selbstwahrnehmung zum Trotz. Die übergrosse Mehrheit der Bürger lebt nicht mehr von der Hand in den Mund, hat vielmehr breitenwirksam Anlage- und Investitionsprobleme, und bis in die Wirtschaftsseite der Heimatzeitungen hinein hat die einschlägige Berichterstattung ein historisch beispielloses Niveau erlangt. Entsprechend wird sich auch im europäischen Währungsverbund in eins mit der Euro-Krise der Irrtum verflüchtigen, Kapitalverwertungsinteressen seien eo ipso gemeinwohlwidrig. In Wahrheit sind ja die Regeln wohlgeordneter und gesicherter Kapitalnutzung zugleich Regeln der Förderung des Gemeinwohls.
Dass das schon alles wäre, was das Gemeinwohl uns abverlangt – das hätte auch unter den professionellen Kapitalverwertern nie jemand öffentlich sagen können, ohne sich zu disqualifizieren. Aber genau so ist es. Sogar in wirtschaftlicher Hinsicht gilt das. Sagen wir es am Beispiel der heute in kapitalismuskritischer Absicht gern beschworenen Alternative von Geldwirtschaft einerseits und Realwirtschaft andererseits. Manche halten diese Alternative für Nonsens, andere verteidigen sie. Beides lässt sich auf den zusammenfassenden Grundsatz bringen, dass Geldwirtschaft und Realwirtschaft sich nicht trennen, aber doch stets unterscheiden lassen. Exemplarisch zitiere ich dafür eine berühmte kleine Geschichte aus dem Leben des allerersten europäischen Wissenschafters. Das war, vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren, Thales von Milet. Thales, meteorologisch kompetent, sah eine besonders gute, wetterbegünstigte Ölfruchternte voraus, kaufte rechtzeitig die Nutzungsrechte aller verfügbaren Ölpressen auf und schlug sie zu Hochkonjunkturpreisen los, als sprunghaft die Nachfrage nach ihnen anstieg. Thales also, nach dem der berühmte Lehrsatz benannt ist, den wir alle einmal in der Schule im Geometrieunterricht zu lernen hatten, war somit zugleich der Erfinder eines Finanzderivats, das ihm das «Forward-Geschäft» erlaubte, aus der erwarteten und termingerecht tatsächlich eingetretenen Wertsteigerung eines früher günstig erworbenen Rechts ein Vermögen zu machen – so nach Markus Lusser, dem langjährigen Mitglied und Präsidenten des Nationalbankdirektoriums der Schweiz ab 1980.
Zurück zu Thales
Einen beachtlichen geldwirtschaftlichen Vorgang repräsentiert die kleine Geschichte tatsächlich. Realwirtschaftlich schien sie die Bauern eher geschädigt zu haben – es sei denn, man läse sie als Vorgeschichte von Erfahrungen mit Vorteilen, die es mit sich bringt, teure, weil saisonal seltene Nutzung aufwendiger Geräte als unternehmerische Dienstleistung anderer Leute einzukaufen. So oder so: sogar noch in wirtschaftlicher Hinsicht sollten die geometrischen Innovationen des Thales, obwohl sie sich ja ökonomischen Interessen gar nicht verdanken, wichtig bleiben.