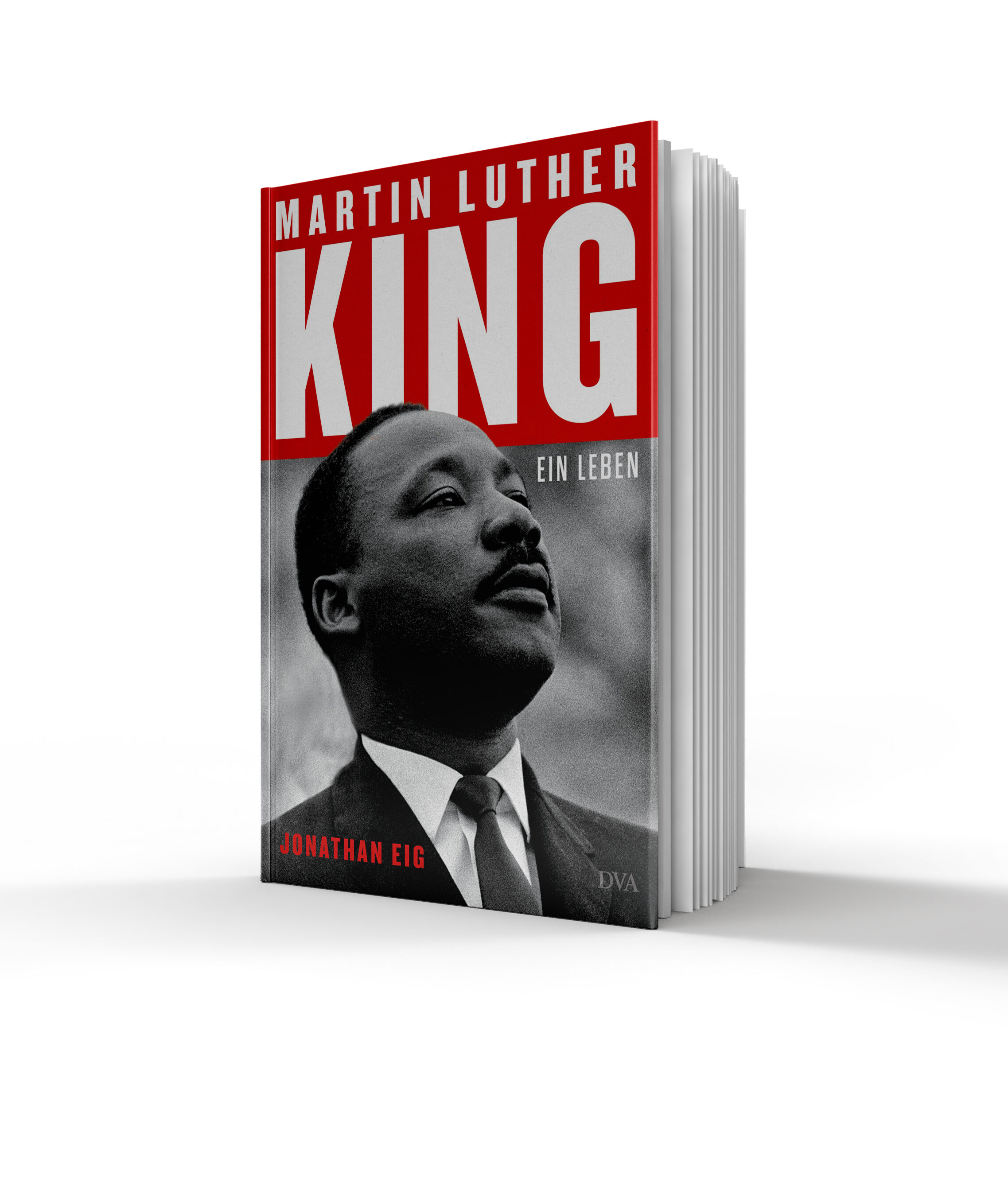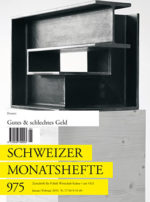Gebete lassen Gletscher kalt
Seit es Gletscher gibt, wachsen sie und ziehen sich zurück. Die Idee, Menschen seien für diese Bewegungen verantwortlich, ist so alt wie fehlgeleitet. Wir sollten besser die natürlichen Prozesse erforschen, als diese kontrollieren zu wollen.
Die meisten von uns kennen die Geschichten unserer Grosseltern oder vielleicht sogar Eltern, wie sie früher Bergtouren unternommen haben und bequem über die Gletscher zu den Hütten des Alpenclubs aufsteigen konnten. Das ist in den letzten Jahren anders geworden, vielerorts führt jetzt der Aufstieg über blockige Moränenhalden.
Die Alpen ohne Gletscher ist für viele gleichbedeutend mit der Endzeit, also die ultimative Katastrophe für die Menschheit. Viele Dinge aber, zum Beispiel eben Gletscher, haben keine unabänderliche Gestalt und verändern sich laufend. So verändert sich die Masse eines Gletschers in Abhängigkeit des Niederschlags und des Eisverlustes durch Schmelzen.
Göttliche Strafe
Einige erinnern sich noch an die Schulzeit und an die dramatischen Geschichten wie jene von der hübschen Sennerin auf der Blüemlisalp, die den Alpsommer im Überfluss von Butter und Käse etwas zu sehr genossen hatte. Über Nacht kam das Unglück: Noch gestern lag der Gletscher weiss und ruhig weiter oben im Tal, und über Nacht ist er losgebrochen und hat mit Schlamm und aufgebrochenem Eis die Alp zugedeckt. Sünde muss bestraft werden.
Auch wenn sich viele Dinge in den Alpen laufend verändern, so bleibt die Vorstellung vom ewigen Eis auf die Zeitachse von gestern–heute–morgen beschränkt, wie wir sie in unserem kurzen Leben erfahren. Wir Menschen sehen uns heute als das Mass aller Dinge in unserer Umgebung und massen uns Verantwortlichkeit für alles an.
«Wir Menschen sehen uns heute als das Mass aller Dinge in unserer
Umgebung und massen uns Verantwortlichkeit für alles an.»
Aber war denn wirklich die schöne Sennerin schuld am wüsten Tun des Gletschers? In unserer Zeit wird die Schuldfrage erneut gestellt; und wieder steht der Mensch im Fokus. Am 31. Juli 2012 fand in Fiesch eine Prozession zur Fürbitte gegen den Schwund des Grossen Aletschgletschers statt. Doch bevor diese Prozession stattfinden konnte, musste der Papst ein Gelübde der Fiescher aus dem Jahre 1678 für nichtig erklären. Damals wurden gegen den vorstossenden Gletscher Gebete gehalten und Prozessionen durchgeführt.
Gletscher, ob sie sich nun ausdehnen oder schrumpfen, beschäftigen die Menschen offenbar zutiefst.
Wissenschaftlicher Sündenerlass
Wenn wir heute über die blockigen Moränenhalden zu den Gletscherzungen hochsteigen, dann finden wir immer wieder kleinere und grössere Holzstücke, die zwischen den Blöcken eingeklemmt sind. Da wir über der Baumgrenze unterwegs sind, handelt es sich bei diesen Proben nicht um lawinentransportierte Stücke.
Das bedeutet, dass die Gletscher einst kleiner waren und dann wuchsen, wobei sie die sie umgebende Vegetation verschlangen. Einzelne der gefundenen Proben sind aufgesplittert, andere sind poliert und haben in die Oberfläche eingepresste Kleinstfindlinge. Diese Hölzer wurden also durch den Gletscher bearbeitet und an dessen Basis mitgeschleift.
Mit beträchtlichen Hochwasserwellen sind die Hölzer an der Gletscherbasis oder in der Gletscherunterlage losgespült und mit dem Schmelzwasser aus dem Gletschertor gebracht worden. Doch die massive mechanische Bearbeitung mit typischen Deformationen infolge grossen Drucks können nur durch die Kraft des fliessenden Gletschers erklärt werden.
Zurzeit treten solche Hölzer unter anderem beim Unteraar-, Tschierva- und Morteratschgletscher auf. Zudem werden stark gepresste «Torfziegel» neben den Hölzern gefunden. Gesamthaft sind weit über 2500 organische Funde geborgen worden. Die Grundfrage ist natürlich, wie alt diese Funde sind, d.h. wann die Bäume oder der Torf gewachsen sind. Grosse Proben mit vielen Jahrringen werden mit der Jahrringmethode, der Dendrochronologie, aufs Jahr genau datiert.

Die Torfproben werden mit der Radiokarbonmethode, zum Beispiel an der Universität Bern, analysiert, was aber nicht eine Zeitbestimmung mit Kalenderjahren erlaubt. Radiokarbonwerte müssen kalibriert werden. Das geschieht mit der DeFries-Methode, die auf dem Vergleich mit der Sonnentätigkeit beruht.
Diese Vergleiche ergeben unerwartete Resultate: Die datierten Gletscherhölzer sind in Zeiten gewachsen, als die Erdoberfläche mehr Energie als heute von der Sonne erhalten hat. Innerhalb der letzten 11 000 Jahre sind in den Alpen mindestens 12 Phasen festgestellt worden, in denen die Gletscher kleiner waren als im Bezugsjahr 2005.
Auch waren die Gletscher zum Beispiel vor 170 Jahren grösser als heute. Solche Gestaltwandlungen sind keineswegs absonderlich. Man sollte also beim Gletscherschwund nicht gleich in Panik geraten.