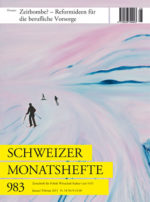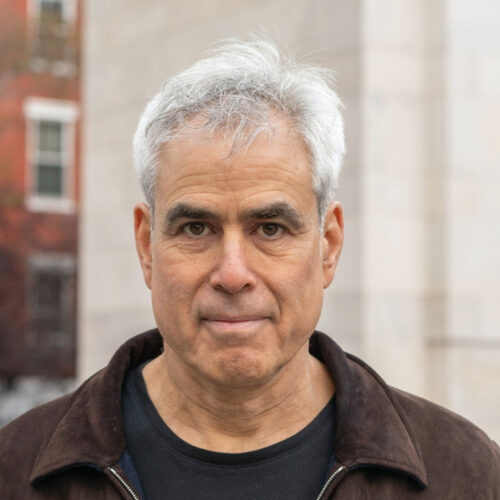
«Wir haben Kinder fragiler gemacht»
Smartphones haben eine Krise der psychischen Gesundheit ausgelöst, sagt der Psychologe Jonathan Haidt. Ein Grund für die Verletzlichkeit der Kinder sind neue Erziehungsmethoden.
Read the English version here.
Jonathan Haidt, wie viel Zeit verbringen Sie pro Tag an Ihrem Smartphone?
Ich benutze mein Smartphone sehr selten, weil ich immer am Computer sitze. Twitter nutze ich nur manchmal, um Dinge zu finden und Ideen auszutauschen. Ich mag es nicht, auf meinem Telefon zu tippen. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren, und bin oft abgelenkt, aber das liegt nicht an meinem Handy. Für mich ist mein Smartphone nur ein Hilfsmittel, das ich benutze, wenn ich etwas brauche.
In Ihrem neuen Buch argumentieren Sie jedoch, dass Smartphones und soziale Medien sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirkten, insbesondere auf die von Kindern. Warum sind Kinder besonders gefährdet?
Dafür gibt es zwei wichtige Gründe. Der eine ist, dass die Pubertät eine ausserordentlich sensible und entscheidende Zeit für Veränderungen im Gehirn ist. Die Neuronen werden neu verdrahtet; wir wechseln von der kindlichen Form des Gehirns zur erwachsenen Form. Dieser Prozess ist in hohem Masse erfahrungsabhängig. Er ist von den Inputs geprägt. In traditionellen Gesellschaften bemühten sich die Erwachsenen, den Kindern beim Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein zu helfen. Wir unternehmen keine solchen Anstrengungen. Wir geben Kindern einfach ein Smartphone, wenn sie in die Pubertät kommen, in der Regel etwa im Alter von 10 Jahren, und überlassen es dann irgendwelchen Fremden im Internet, ihre Gehirnentwicklung zu lenken. Das ist eine wirklich schlechte Idee. Hinzu kommt, dass Kinder in der Regel nicht wissen, wie sie Benachrichtigungen auf dem Handy ausschalten können. Im Grunde erlauben sie damit Dutzenden von Unternehmen, sie zu unterbrechen und ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Für junge Menschen bedeutet das Smartphone also, dass es ihre Aufmerksamkeit grösstenteils oder vollständig in Anspruch nimmt und sie von jeglichem sinnvollem Ziel ablenkt.
In der Vergangenheit wurde vor dem Lesen von Büchern, dem Fernsehen und so weiter gewarnt. Ist das jetzt nicht bloss eine weitere moralische Panik?
Es ist sicherlich richtig, dass Erwachsene bei jeder neuen Sache, die Kinder machen, ausflippen. Ich denke, dass es angebracht ist, die Sache mit einer skeptischen Haltung anzugehen. Als Jean Twenge 2017 einen Artikel mit dem Titel «Have Smartphones Destroyed a Generation?» veröffentlichte, war die Skepsis berechtigt. Seither ist es viel klarer geworden, dass wir einer gigantischen internationalen Krise der psychischen Gesundheit gegenüberstehen. Als Menschen anfingen, Romane zu lesen oder Fahrrad zu fahren, löste das keine solche Krise aus. Wir erlebten damals keinen plötzlichen Anstieg der Selbstmordrate. Es gab keine rekordhohe Zahl von Mädchen, die sich in psychiatrische Kliniken einweisen lassen – heute beobachten wir bei Mädchen im Teenageralter einen Anstieg von fast 200 Prozent. Darüber hinaus gibt es inzwischen Dutzende von Experimenten, die nach dem Zufallsprinzip die Auswirkungen einer Auszeit von den sozialen Medien oder die Auswirkungen der Nutzung einer Plattform wie Instagram im Vergleich zu anderen Plattformen zeigen. Wenn man in den Sozialwissenschaften Experimente, Korrelationsstudien und Längsschnittstudien durchführt, kann man anfangen, Kausalität zu erkennen. Es ist nicht nur eine Korrelation.
Es gibt Menschen, die skeptisch sind und zum Beispiel argumentieren, dass psychische Probleme schon zugenommen hätten, bevor es Smartphones oder soziale Medien gab.
Es stimmt, dass es seit den 1950er-Jahren eine allgemeine Zunahme von Verletzlichkeit und Depression gibt, zumindest in den Vereinigten Staaten. Das gilt für die gesamte Generation X. Die Millennials waren psychisch sogar etwas gesünder als die Generation X. Aber dann, um 2012 bis 2013, stiegen die meisten Zahlen an. Da sehen wir die «Hockeyschläger»-Kurven, vor allem bei den Mädchen. So etwas hat es noch nie gegeben. Ich nenne den Zeitraum von 2010 bis 2015 «Die grosse Neuverkabelung der Kindheit». Was Kinder den ganzen Tag über tun, hat sich radikal verändert. Genau zu diesem Zeitpunkt verschlechterte sich ihre psychische Gesundheit massiv.
«Ich nenne den Zeitraum von 2010 bis 2015 ‹Die grosse Neuverkabelung der Kindheit›. Genau zu diesem Zeitpunkt verschlechterte sich
ihre psychische Gesundheit massiv.»
Spielen nicht auch andere Faktoren eine Rolle? In ihrem neuen Buch «Bad Therapy» argumentiert Abigail Shrier, dass die Gesundheitsindustrie und der Aufstieg der Psychotherapie zu psychischen Problemen beigetragen hätten. Ist das plausibel?
Oh ja, das ist definitiv ein Faktor. Aber er kann das Timing aus mehreren Gründen nicht erklären. Erstens, wenn die Erklärung dafür in erster Linie eine schlechte Therapie wäre, dann wäre es ein sehr allmählicher Anstieg und würde nicht in einem so kurzen Zeitraum geschehen. Die sogenannte «Therapiekultur» hat sich in Amerika seit den 1970er-Jahren entwickelt. Shriers Theorie kann also keine Hockeyschlägerkurve erklären. Sie kann auch nicht das internationale Ausmass erklären.
Die Daten in Ihrem Buch konzentrieren sich auf die USA und die englischsprachigen Länder. Sehen wir ähnliche Trends in der Schweiz und anderen europäischen Ländern?
Ja. Wenn wir den «Health Behavior in School-Aged Children Survey» heranziehen und uns die Häufigkeit in der gewichteten Bevölkerung Europas ansehen, stellen wir fest, dass Knaben etwas häufiger von psychischen Problemen berichten. Bei den Mädchen gab es jedoch genau in dem Zeitraum, über den wir sprechen, einen Anstieg um 38 Prozent. Der stärkste Anstieg ist bei Mädchen in Westeuropa zu verzeichnen, stärker als in Osteuropa. Auch reichere Länder, Länder mit geringer Ungleichheit und Länder mit hohem Individualismus verzeichnen einen stärkeren Anstieg. Der wohl wichtigste Faktor ist die Religion: In religiösen Gesellschaften haben Kinder einen gewissen Schutz, während sie in weniger religiösen Ländern schutzlos ausgeliefert sind. Dies deckt sich mit Studien aus den USA, die zeigen, dass Kinder aus religiösen Familien am wenigsten Probleme haben.
Warum ist das so?
Ich bin ein grosser Fan des Soziologen Émile Durkheim, der der Meinung war, dass die Menschen in moralischen Gemeinschaften verwurzelt sein müssen. In den meisten Teilen der Welt ist das der Fall, aber in den am weitesten entwickelten, wohlhabenden, individualistischen Ländern nicht. Wir haben sehr viel Freiheit, und Freiheit war früher gut für die psychische Gesundheit. Unsere Kinder waren einst im Vergleich zu denen in anderen Teilen der Welt glücklicher. Aber das ist nicht mehr der Fall.
«Unsere Kinder waren einst im Vergleich zu denen in anderen Teilen der Welt glücklicher. Aber das ist nicht mehr der Fall.»
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass wir Kinder in der realen Welt zu sehr und in der virtuellen Welt zu wenig schützen. Was meinen Sie damit?
Menschliche Kinder müssen spielen und erkunden. Sie lernen, unabhängig zu sein, indem sie unabhängig sind. Dabei verletzen sie sich zuweilen, aber nicht schwer. Sie gehen Risiken ein, lernen, damit umzugehen, und sind dann bereit, grössere Risiken einzugehen. So war es seit Millionen von Jahren, bis in die 1990er-Jahre. In englischsprachigen Ländern sind wir alle zur gleichen Zeit durchgedreht. Wir sagten alle: «Oh mein Gott, wir können unsere Kinder nicht rauslassen! Wir können den Erwachsenen nicht trauen; sie könnten unsere Kinder belästigen oder entführen.» Wir begannen, den Kindern das freie Spiel miteinander und die Unabhängigkeit vorzuenthalten, was sie noch fragiler machte. Übermässiger Schutz führte zwar nicht zu Depressionen, Angstzuständen und Selbstmord, aber er schwächte die Kinder und machte sie weniger widerstandsfähig.
Er bereitete Kinder auch schlecht auf die digitale Welt vor.
Die virtuelle Welt ist brandneu; wir haben uns evolutionär nicht dafür entwickelt. Kinder können jetzt mit Milliarden von Fremden in Kontakt treten, darunter viele Männer mit sexuellen Absichten. Wir setzen sie allen möglichen Gefahren aus, die wir nicht verstehen, und unser Schutz für sie tendiert gegen null. Der US-Kongress hat 1998 ein Gesetz verabschiedet, gemäss dem man 13 Jahre alt sein muss, bevor man mit einem Unternehmen einen Vertrag über die Weitergabe seiner Daten ohne das Wissen oder die Erlaubnis der Eltern abschliessen kann. Die Unternehmen sind nicht verpflichtet, diese Altersgrenze durchzusetzen. Im Internet gibt es keine Altersbeschränkungen; jeder Siebenjährige kann pornografische Seiten besuchen oder ein Instagram-Konto eröffnen. Der US-Kongress hat auch festgelegt, dass wir die Unternehmen nicht für den von ihnen verursachten Schaden verklagen können. Und so erlaubten Eltern, die ihre Kinder niemals etwas essen lassen würden, das nachweislich eine um 1 Prozent erhöhte Gefährdung mit sich bringt, ihnen den Zugang zu Plattformen, auf denen sie mit nackten Männern sprechen.
Wie hat Ihre Forschung die Erziehung Ihrer eigenen Kinder verändert?
Ich habe die strikte Regel, dass meine Kinder keine sozialen Netzwerke nutzen dürfen, bis sie in die High School kommen. Die frühe Pubertät ist extrem wichtig. Ich habe also wirklich versucht, meine Kinder in der Middle School zu schützen, also etwa im Alter von 11 bis 13 Jahren. Mein Sohn eröffnete ohne mein Wissen ein Instagram-Konto, als er 15 war. Da er aber sehr verantwortungsbewusst ist und nichts postet, fand ich das in Ordnung. Ich werde länger warten, bevor ich meiner Tochter erlaube, Social-Media-Konten zu eröffnen.
Okay, Sie haben mich vom Problem überzeugt. Allerdings bin ich immer noch skeptisch, was Ihre Lösungen angeht. Sie schlagen vor, das gesetzliche Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien auf 16 Jahre anzuheben. Wie wollen Sie diese Regel durchsetzen?
Das könnte schwierig sein. Aber stellen Sie sich Folgendes vor: Der Gesetzgeber in Ihrem Land legt das Mindestalter für den Alkoholkonsum bei 21 Jahren fest, die Bars müssen jedoch keine Ausweiskontrollen durchführen, da dies in der Verantwortung der Eltern liege. Ausserdem steht es den Bars frei, Getränke mit Kaugummigeschmack zu kreieren, um Kinder anzulocken. Die Bars können somit tun und lassen, was sie wollen, und können nicht verklagt werden. Das wäre verrückt. Doch genau das ist die Situation, die wir jetzt mit Social Media haben. Wir müssen etwas tun.
Sie haben auch vorgeschlagen, Handys aus den Schulen zu verbannen. Wäre es nicht besser, die Schulen würden Kindern beibringen, wie sie Social Media und digitale Technologien verantwortungsvoll nutzen können?
Nein, das wird nicht funktionieren. Zunächst einmal ist es sehr, sehr schwer, das Belohnungssystem des Gehirns zu bekämpfen, selbst bei Erwachsenen. Es ist sehr schwer, Erwachsene dazu zu bringen, eine Diät zu machen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Wenden wir uns nun elf- und zwölfjährigen Kindern zu. Ihr präfrontaler Kortex ist noch sehr unterentwickelt und in einem verletzlichen Zustand. Es fällt ihnen sehr schwer, der Versuchung zu widerstehen. Facebook ist sich dessen bewusst. Ich glaube also nicht, dass Aufklärung sehr hilfreich wäre. Wenn Kinder ein Smartphone in der Tasche haben, werden sie es auch benutzen. Zweitens ist es für sie nicht von Vorteil, wenn sie früh damit anfangen. Ich finde es in Ordnung, wenn Sie Zehnjährigen Unterricht in digitaler Verantwortung geben wollen. Aber wenn man ihnen auch noch ein Smartphone gibt, wird das jeden Unterricht untergraben. Für Lehrer war es schon immer schwierig, die Aufmerksamkeit ihrer Schüler zu behalten. Seit 2012 ist es fast unmöglich geworden. Wenn einige Kinder SMS schreiben, fühlen sich alle Kinder gezwungen, ihre Textnachrichten zu lesen. Wenn einige Kinder in den sozialen Netzwerken posten, fühlen sich alle Kinder unter Druck gesetzt, diese Posts zu lesen. Das wirkt sich auch auf die schulischen Leistungen aus. Wenn wir uns die PISA-Daten ansehen, sehen wir, dass junge Menschen auf der ganzen Welt seit 2012 weniger gebildet, ängstlicher, depressiver, süchtiger und einsamer in der Schule geworden sind.
In der Vergangenheit war die Regulierung neuer Technologien nicht sehr erfolgreich. Sie war meist nutzlos, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Warum sollte das bei Social Media anders sein?
Ich habe mein Buch in der Annahme geschrieben, dass wir von Politikern keine Hilfe bekommen werden, weil wir in den USA keine funktionierende Legislative haben. Deshalb schlage ich Normen vor, die direkt umgesetzt werden können. Natürlich würden staatliche Regeln helfen. Aber eigentlich können wir das selbst in die Hand nehmen. Sobald man ein paar Familien zusammenbringt, einigen sie sich darauf, keine Smartphones vor der High School zu geben, keine sozialen Medien bis 16 zuzulassen, zusammenzuarbeiten, um die Schule davon zu überzeugen, Schliessfächer für Handys zu verwenden und den Kindern mehr Zeit zu geben, draussen miteinander zu spielen. Dafür braucht man nicht die Regierung. Interessanterweise findet man, wenn man mit Eltern spricht, nicht viele, die glücklich darüber sind, was mit der Technologie vor sich geht.
Die Kinder ebenso wenig.
Das ist richtig. Wenn man mit Teenagern spricht, sehen sie die Probleme. Sie wissen, dass die sozialen Netzwerke ihnen wirklich schaden. Aber sie können nicht damit aufhören, weil alle anderen sie auch nutzen.
Ihre Kritik an den sozialen Medien geht über die psychische Gesundheit von Kindern hinaus. In einem Essay schrieben Sie vergangenes Jahr, dass Social Media das Vertrauen schwächten, die Spaltung förderten und die Demokratie gefährdeten.
Die Probleme der Demokratie sind viel schwerwiegender, und ich habe dafür keine so klaren Lösungen wie für die Krise der psychischen Gesundheit von Jugendlichen. Ich bin sehr besorgt über die Zukunft meines Landes in den nächsten zehn Jahren. Ich befürchte, dass die Dinge noch viel schlimmer werden könnten.
Warum?
In Amerika sind die aktuellen Trends der zunehmenden Polarisierung und des sinkenden Vertrauens in Institutionen besorgniserregend. Tatsächlich tun diese Institutionen viel, um das Vertrauen zu untergraben. Die Universitäten und die Gesundheitsbehörden haben sich während der Pandemie furchtbar verhalten. Ohne gute Institutionen, ohne Vertrauen selbst in die Durchführung von Wahlen ist nicht klar, ob das amerikanische Experiment überleben kann. Alle bekannten Probleme mit der Demokratie sind in den USA besonders deutlich zu erkennen. Das Konzept einer liberalen Demokratie, in der wir demokratische Debatten führen, Überzeugungsarbeit leisten und Kompromisse schliessen, ist im Zeitalter der sozialen Medien viel schwieriger umzusetzen.
Gibt es etwas, das Sie optimistisch stimmt?
Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist die Tatsache, dass sich in Bezug auf die psychische Gesundheit von Kindern alle einig sind. Es gibt einen enormen Wunsch nach Veränderung. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten ein oder zwei Jahren grosse Veränderungen vornehmen werden, die sich auszahlen werden. Ich denke, dass wir innerhalb von zwei oder drei Jahren beginnen werden, die Zahl der psychischen Erkrankungen zu senken.