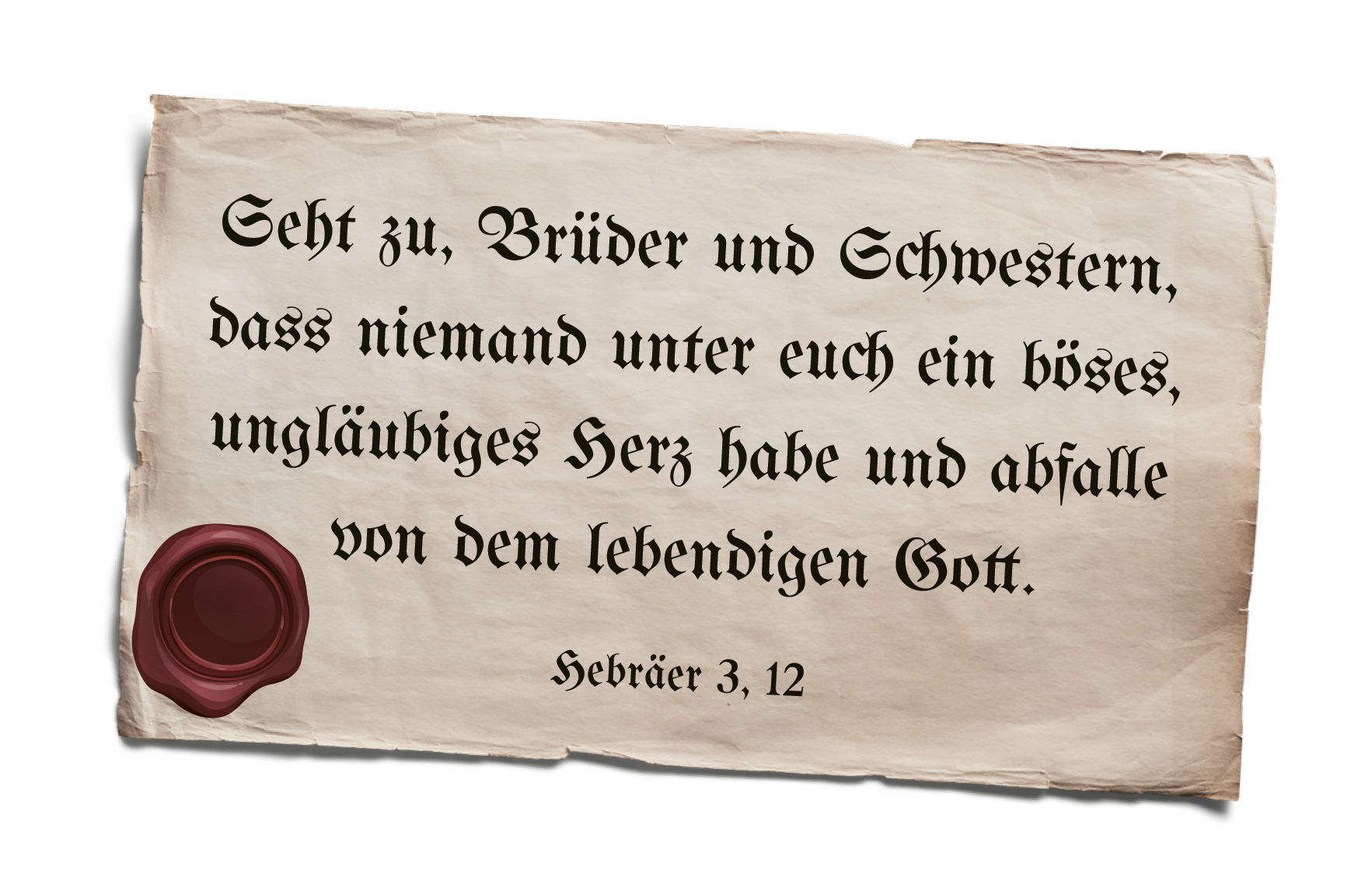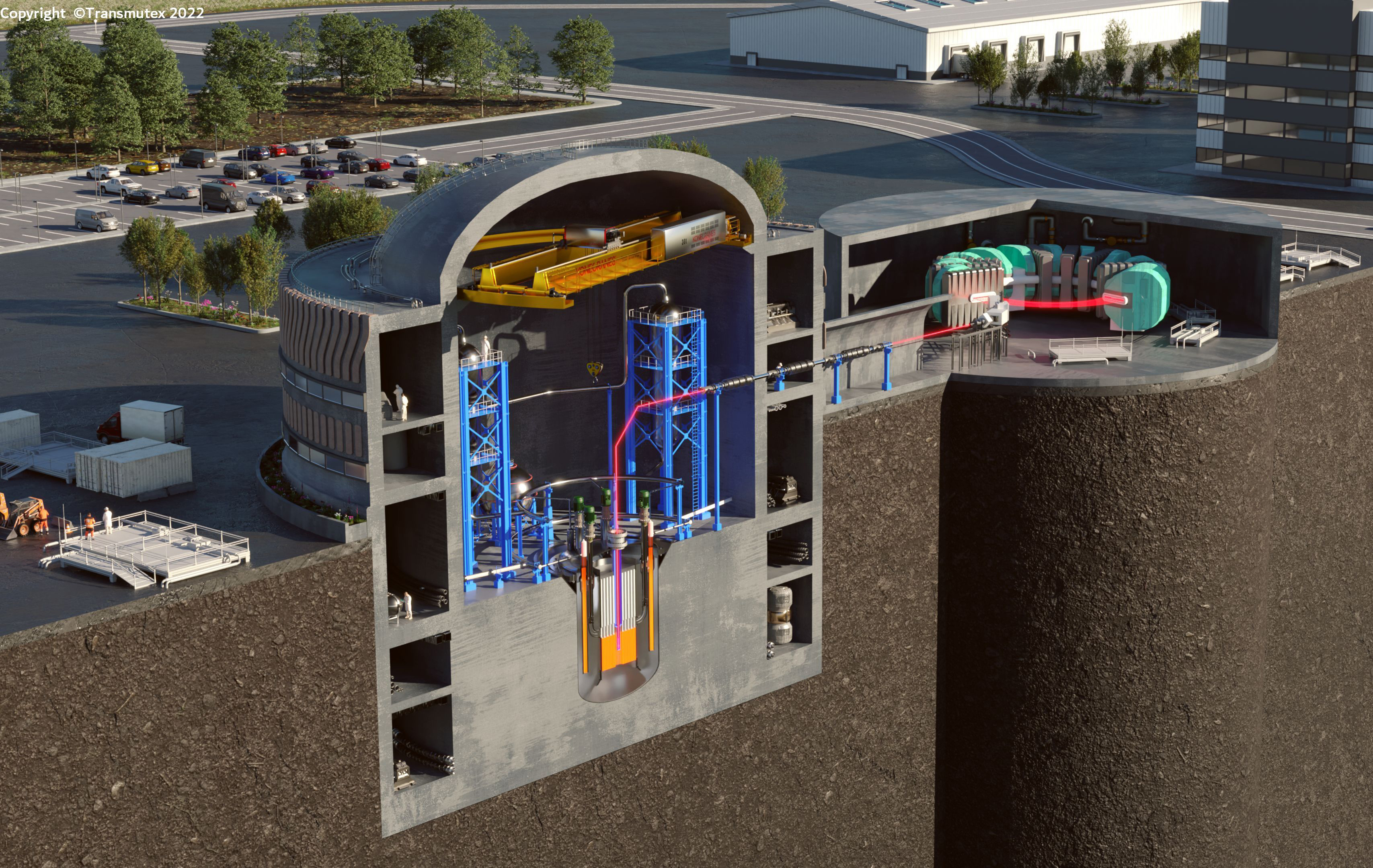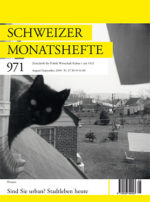Die umgekehrten Bobos
Die Bohème des 21. Jahrhunderts verkleidet ihre Antibürgerlichkeit als Bürgerlichkeit. Ihre demonstrativ zur Schau getragene Tugendhaftigkeit wird leicht zum Tugendterror.
Im Jahr 2000 hat der amerikanische Journalist David Brooks den Begriff «Bobos» geprägt und damit eine neue herrschende Klasse charakterisiert, die eigentlich ein erfolgsorientiertes, kapitalistisches Leben führt – also arbeitet wie die Bourgeoisie –, aber dabei einen Lebensstil kultiviert, der sich mit Symbolen der Gegenkultur schmückt – also wie die Bohème.
Mit anderen Worten: Brooks wollte mit seiner Kurzformel Bobos erfolgreiche moderne Menschen charakterisieren, die zwar einerseits ökonomisch zur Bourgeoisie gehören, andererseits aber einen Lifestyle propagieren, der sich an der Bohème orientiert. Bobos sind Bürger mit antibürgerlicher Attitüde.
Widerstreit zweier Lebensweisen
Heute dagegen beobachten wir den Aufstieg der umgekehrten Bobos. Das sind Leute, die ihre Antibürgerlichkeit als Bürgerlichkeit verkleiden und damit Erfolg haben. Sie leisten nichts, sondern stellen sich als die Guten zur Schau. Sie gehören eigentlich zur Bohème, tun aber so, als ob sie die neue Bürgerlichkeit repräsentierten. In Wahrheit surfen sie nur auf der Welle des links-grünen Zeitgeistes.
Um zu verstehen, wie es zu beiden Typen, also den Bobos und den umgekehrten Bobos, kommen konnte, muss man einen Blick zurück in die Anfänge der Gegenkultur und Antibürgerlichkeit machen. Die spezifisch moderne Gegenkultur begann vor 200 Jahren in Paris. Dort formierte sich die Bohème gegen die Bourgeoisie, der Dandy verspottete durch seinen Lebensstil den Utilitaristen, und die Kunst identifizierte Modernität mit Avantgarde.
Eines der Hauptangriffsziele der avantgardistischen Bohème war und ist die klassische Familie, die für Werte wie Tradition und Pietät steht. Charakteristisch für die Gegenkultur ist nämlich die Arroganz des Glaubens, die vergangenen Generationen besser zu verstehen, als diese sich selbst verstanden haben. Entsprechend wird die Absprengung aller historischen Traditionen gefordert. Der Dichter Rimbaud hat das auf die Formel gebracht: Man muss absolut modern sein! Heute nennt man das «woke».
Interessant ist nun, dass sich die derart attackierte bürgerliche Gesellschaft immer schon von der Gegenkultur fasziniert gezeigt hat. Die Bohème verachtet die bürgerliche Gesellschaft, die sie finanziert, und die Bourgeoisie bewundert die Bohème, die sie bekämpft. Der Ökonom Joseph Schumpeter hat die Bohème und ihren künstlerischen Modernismus deshalb als Resultat einer schöpferischen Selbstzerstörung der bürgerlichen Kultur verstanden. Die Bourgeoisie sei nicht nur politisch, sondern auch kulturell unfähig zur Leitung der modernen Gesellschaft und überlasse sie kampflos ihren Feinden.
Die Gegenkultur dieser antibürgerlichen Elite ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Curricula von Schule und Universität eingedrungen und wurde zur Popkultur. Die Bohème ist seither vor allem auf dem Campus der Universität zu Hause. Und dort sind neben einem stets wachsenden akademischen Proletariat zunächst die Bobos herangereift – und dann eben auch die umgekehrten. So haben wir es heute nicht nur mit einer Bourgeoisie zu tun, die sich als Bohème verkleidet, sondern auch mit einer Bohème, die sich als Bourgeoisie verkleidet.
Unproduktive Zeitgeistsurfer
Im Unterschied zu den prekären Existenzen des 19. Jahrhunderts ist die Bohème des 21. Jahrhunderts aber durchaus gutsituiert. Um zu erklären, wie es dazu kommt, müssen wir etwas konkreter werden und die Akteure benennen. Die soziologischen Trägergruppen dieser eigentümlichen Kulturerscheinung der umgekehrten Bobos sind vielfältig. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie keine produktive Arbeit leisten.
«Die soziologischen Trägergruppen der umgekehrten Bobos sind
vielfältig. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie keine produktive Arbeit leisten.»
Da sind zum einen die Erben reicher Familien, die sich verbal für eine bessere Welt engagieren – man denke an Luisa Neubauer und Carla Reemtsma, aber auch Marlene Engelhorn, die seit Jahren ankündigt, ihre ererbten Millionen für einen guten Zweck zu spenden. Da sind zum Zweiten die Entertainer, also Schauspieler, Musiker und Comedians, die mit erstaunlich naiven Parolen dem links-grünen Zeitgeist huldigen. Da ist, drittens, die politisch-mediale Elite, also Regierungspolitiker und die Stars des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sich gegenseitig die Bälle zuspielen und ihr gut dotiertes Überleben sichern. Da sind, viertens, die Bewohner des akademischen Elfenbeinturms, also Geisteswissenschafter, vor allem in Orchideenfächern wie Gender Studies, Post-Colonial Studies und Critical Race Theory. Und da sind schliesslich Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, die paradoxerweise von der Regierung finanziert werden, beziehungsweise Aktivisten, hinter denen politisch interessierte Milliardäre stehen.
Wie diese umgekehrten Bobos den Begriff Bürgerlichkeit umdefinieren, kann man sich an den deutschen Erfindungen «Bürgergeld» und «Bürgerräte» deutlich machen. «Bürgergeld» ist nicht Geld für Bürger, sondern Geld von Bürgern für Migranten und sozial Schwache. Und «Bürgerräte» sind keine neue Form bürgerlicher Öffentlichkeit, sondern eine Art sozialer Vormundschaft der Gutmenschen.
Leistung und Verantwortung, die beiden wesentlichen Tugenden des wahren Bürgertums, ersetzen die umgekehrten Bobos durch das, was die Amerikaner «virtue signaling» nennen. Gemeint ist das öffentliche Zurschaustellen der eigenen Tugendhaftigkeit, eine Art moralischer Exhibitionismus. Linke Regierungen honorieren das als «zivilgesellschaftliches Engagement».
Mut zur wahren Bürgerlichkeit
Einfache und preiswerte Möglichkeiten, die eigene Tugendhaftigkeit öffentlich auszustellen, sind das «Gendern» und das Schwenken einer Regenbogenflagge. Und dieser Drang, zu signalisieren, dass man zu den Guten gehört, macht selbst vor dem Fussball nicht halt. Wie die One-Love-Armbinde bei der WM in Katar und jetzt das neue «Diversity»-Trikot der deutschen Nationalmannschaft zeigen, ist dem Deutschen Fussball-Bund das «virtue signaling» wichtiger als der sportliche Erfolg. Das ist zwar lächerlich und peinlich, aber noch harmlos.
Die zur Schau gestellte Tugendhaftigkeit wird aber zum Tugendterror in den «woken» Tribunalisierungen der westlichen Gesellschaft und den Selbstanklagen des alten weissen Mannes – den Bussritualen des Sexismus, Rassismus und Kolonialismus. Um sich hier auf die Seite der Guten zu stellen, muss man sich am «Kampf gegen rechts» beteiligen. Er suggeriert in einer kuriosen politischen Topografie, dass die Mitte der Gesellschaft links sei. Dieser Kampf gegen rechts scheint über dem Recht zu stehen, und das wird damit begründet, dass die Demokratie in Gefahr sei. Die umgekehrten Bobos sind als die selbsternannten «Verteidiger der Demokratie» jederzeit bereit, für ihren Kampf den Liberalismus zu opfern. Was sie in jedem Falle nicht verteidigen, sind Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit des Einzelnen.
Fazit: Wir leben heute in einer Gesellschaft, die politisch und kulturell von den Bobos und den umgekehrten Bobos dominiert wird. Die einen dissimulieren Bürgerlichkeit, die anderen simulieren sie. Die einen sind bürgerlich und tun so, als ob sie es nicht wären. Die anderen gehören zu einer gutsituierten Bohème, tun aber so, als ob sie bürgerlich wären. Was unserer Gesellschaft deshalb am meisten fehlt, ist der Mut zur wahren Bürgerlichkeit von Leistung und Verantwortung, Realitätssinn und Dezenz. Man könnte es auch Erwachsensein nennen.