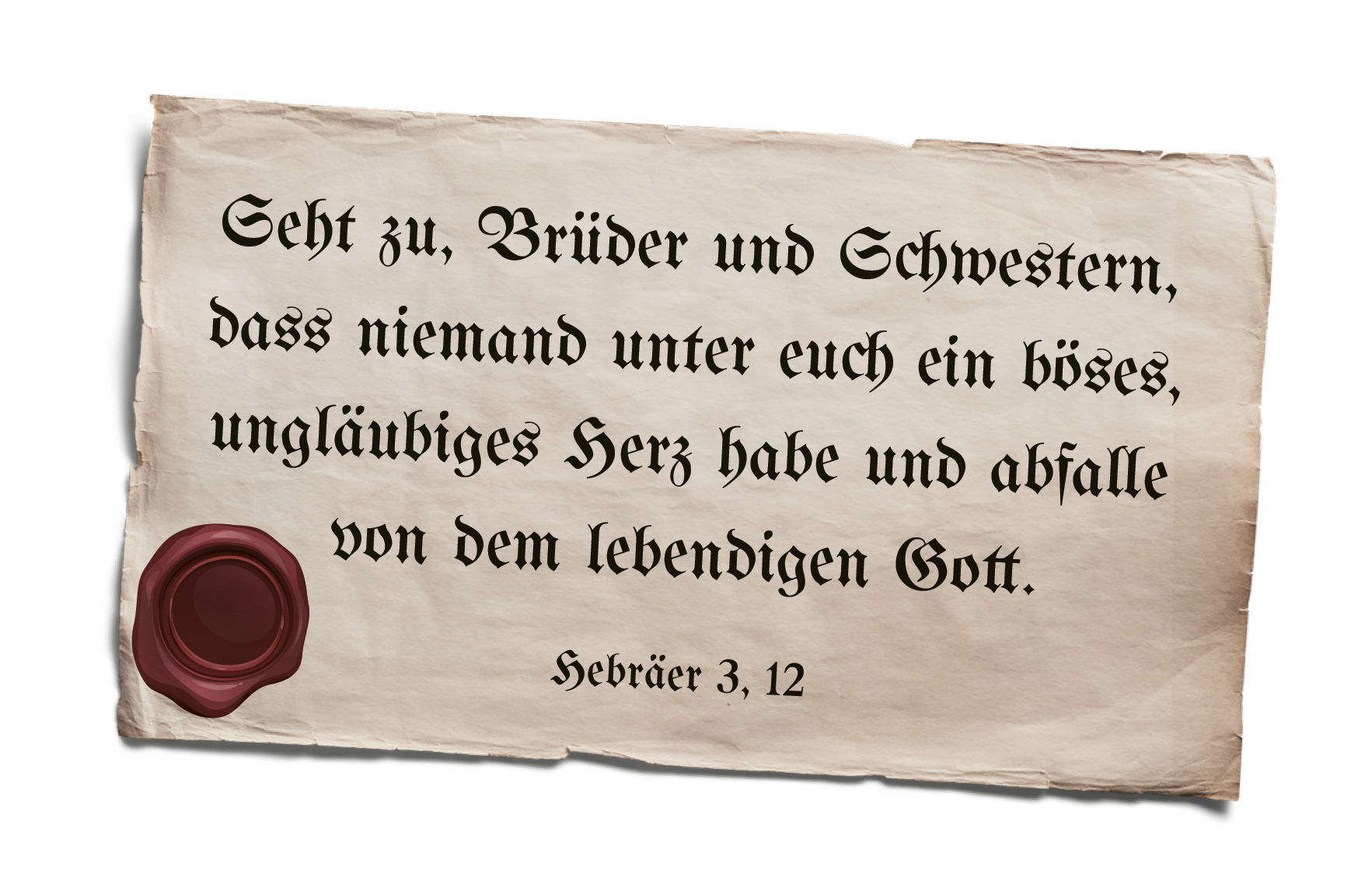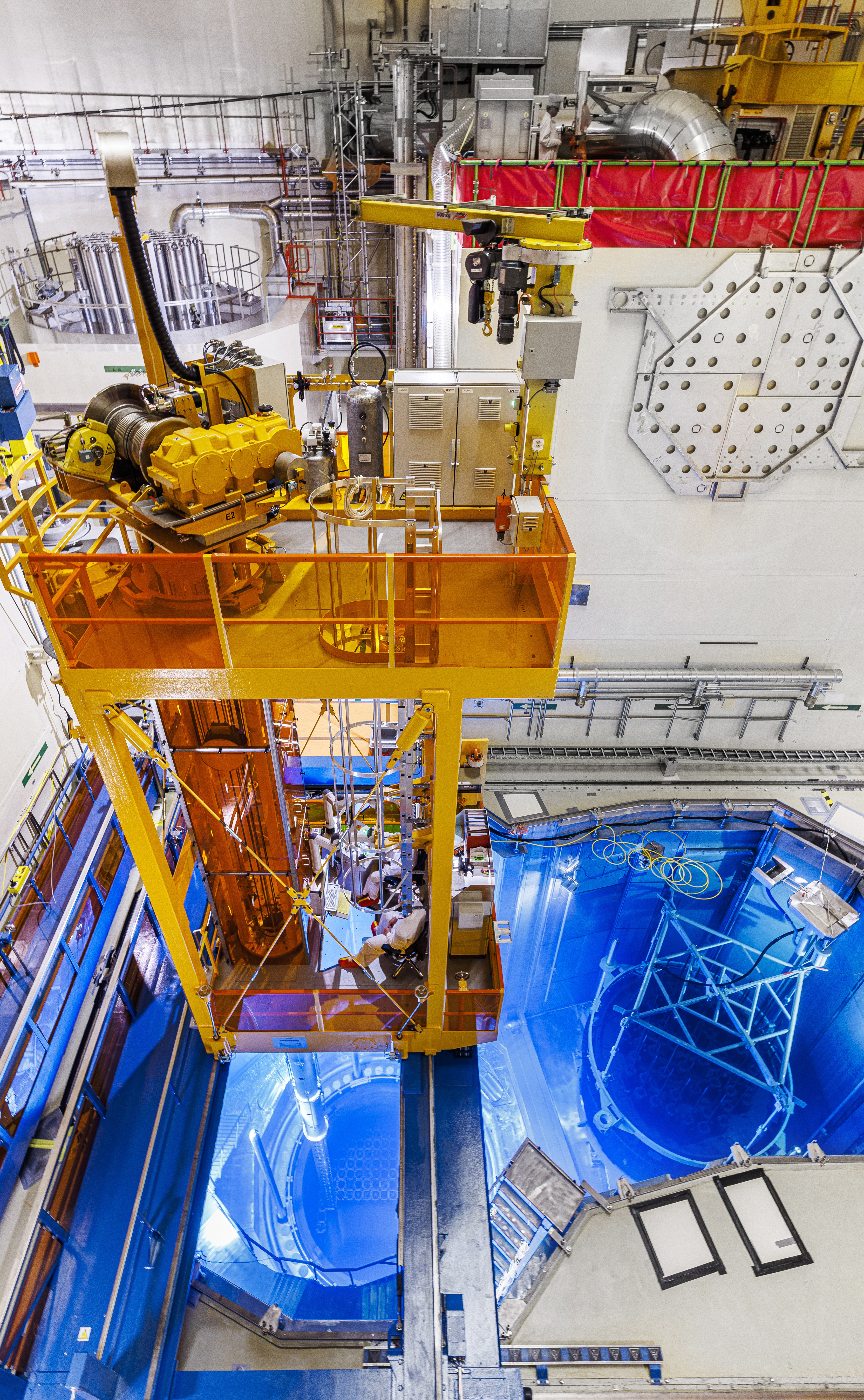«Der beste Weg, Menschen zu helfen, ist, sie in Ruhe zu lassen»
Bürgerliche Tugenden haben uns reich gemacht, sagt die Wirtschaftshistorikerin Deirdre McCloskey. Ihr Niedergang könnte uns wieder arm machen.
Read the English version here.
Deirdre McCloskey, viele Liberale waren von den Zwangsmassnahmen überrascht, mit denen Regierungen auf Covid-19 reagierten. Es scheint jedoch, dass der Trend hin zu mehr staatlicher Macht schon vor dem Auftreten der Pandemie einsetzte.
Ja. Dieser Trend ist mehr oder weniger endlos. Meine linken Freunde, insbesondere jene aus der Ökonomie, sind alle Etatisten. Sie glauben, dass es überall Externalitäten und Nebenwirkungen gibt. Und natürlich gibt es die. Das menschliche Leben besteht aus Nebenwirkungen.
Und diese werden benutzt, um staatliche Eingriffe zu legitimieren.
Das ist das Problem. Und das wird noch verstärkt durch eine alte journalistische Konvention, wonach immer dann, wenn etwas Schlimmes passiert, die Frage auftaucht: Warum hat der Staat das nicht verhindert oder etwas dagegen unternommen? Und nachdem es passiert ist, wird der Staat um Hilfe gebeten. Ich bin keine Anarchistin. Wir brauchen einen Staat. Aber wir brauchen einen beschränkten Staat, wie ihn die Schweiz hat. Die staatsgläubige Ideologie meiner Ökonomenkollegen und die «Mama und Papa werden mir helfen»-Haltung der Öffentlichkeit müssen eingedämmt werden, denn sie führen zu einem unnötigen, kontinuierlichen Anstieg staatlicher Ausgaben und Regulierung.
Spielen kulturelle Faktoren eine Rolle?
Eine sehr wichtige sogar. Vor hundert Jahren verliessen sich die Menschen in der Schweiz, den USA und den meisten anderen Ländern mehr auf ihre Familien, wenn es um Dinge wie Altersvorsorge oder Gesundheit ging. Meine Urgrossmutter, die in den 1890er-Jahren geboren wurde, hatte ein dickes Buch mit medizinischen Ratschlägen für zu Hause. Wenn ihr Kind krank wurde, kümmerte sie sich darum. Es waren Familien, die sich um Menschen kümmerten, nicht der ferne Staat. Und doch hat der Staat in allen Ländern, in Schweden und in den Vereinigten Staaten, ja sogar in der Schweiz, aufgrund des aufkommenden Etatismus eine immer grössere Rolle in solchen Bereichen übernommen. Doch der beste Weg, um Menschen zu helfen, ist, sie in Ruhe zu lassen. Lasst sie arbeiten und Unternehmen gründen.
Sind die bürgerlichen Tugenden im Niedergang begriffen?
Es gibt eine antibürgerliche Denkrichtung, die von Karl Marx, dem Helden meiner Jugend, begründet wurde. Sie hat sich ausgeweitet und ist unter Akademikern sehr ausgeprägt, deren Gehälter von eben jener Bourgeoisie gezahlt werden, die sie verabscheuen. Das ist unehrlich. Im Gegensatz dazu bewundere ich Unternehmer und Geschäftsleute. Im Grossen und Ganzen tun sie Gutes. Einige von ihnen sind schlecht, aber das gilt auch für einige unserer Staatsmänner und für einige unserer Freunde. Der Mensch ist unvollkommen. Aber das System der bürgerlichen Tugenden, die Förderung des ehrlichen Austauschs von Waren, war zwei Jahrhunderte lang sehr erfolgreich. Im Jahr 1800 war die Schweiz extrem arm. Jetzt ist sie extrem reich. Und das liegt daran, dass die Schweiz schon früh ein wichtiges Vorbild für den Respekt vor Menschen in der Wirtschaft war.
«Im Jahr 1800 war die Schweiz extrem arm. Jetzt ist sie extrem reich. Und das liegt daran, dass sie schon früh ein wichtiges Vorbild für den Respekt vor Menschen in der Wirtschaft war.»
Was hat Sie dazu inspiriert, Ihr Buch «Bourgeois Virtues» zu schreiben?
Mich inspirierte die Wiederbelebung der sogenannten Tugendethik in den 1950er- und ’60er-Jahren. Im langen 18. Jahrhundert wurden verschiedene andere Theorien der Ethik entwickelt, wie der Kontraktualismus, der die Idee des Gesellschaftsvertrags beinhaltet, bei dem wir uns untereinander einigen, was gut sei. Eine andere war der Kantianismus, der die Tugend der Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt. Oder der Utilitarismus, der die Tugend der Klugheit in den Vordergrund stellt. Das Konzept der Tugendethik stellt eine Alternative dar, und ich halte sie für überlegen.
Warum?
Es passt besser zum Menschen, aus dem guten Grund, dass die Theorie von Menschen handelt und nicht von irgendwelchen idealen Konstrukten. Immanuel Kant sagte, dass jedes vernünftige Wesen dem folgen würde, was er den kategorischen Imperativ nannte. Ich bewundere Kant sehr, aber es hat für mich nie einen Sinn ergeben, warum er über rationale Wesen theoretisierte und nicht über Franzosen oder Schweizer, also konkrete Menschen. Die Tugendethik spricht über reales menschliches Verhalten. Einfach ausgedrückt, geht es um bestimmte menschliche Tugenden wie Hoffnung, Glaube, Liebe, Klugheit, Gerechtigkeit, Mässigung und Mut. Ausgehend von diesen sieben Tugenden kann man über alle möglichen anderen Tugenden wie Ehrlichkeit, Grosszügigkeit und so weiter sprechen.
Welche der Tugenden sind für Sie am wichtigsten?
Als junge Ökonomin habe ich einmal geglaubt, dass die Klugheit die wichtigste Tugend sei. Als Utilitaristin dachte ich sogar, dass sie die einzige Tugend sei und dass sich alles auf die Klugheit reduzieren lasse. Klugheit ist das, was Thomas von Aquin die leitende Tugend nannte, die Tugend, zu wissen, wie man Dinge tut, wie man durch das Tun von Dingen glücklicher wird. Aber das ist natürlich nicht die Aufgabe von Tugenden wie Mut oder Hoffnung. Hoffnung, Mut und Klugheit zusammen sind die Tugenden eines Unternehmers.
Was wäre ein konkretes Beispiel für das von Ihnen angesprochene antibürgerliche Denken?
Die gesamte Ideologie der Linken ist antibürgerlich. Tatsächlich ist auch ein Teil der Ideologie der Rechten antibürgerlich. Die Rechte vertritt den Standpunkt, dass Hierarchien oder ererbte Hierarchien gut seien und dass wir mehr davon haben sollten. Der politische Philosoph Patrick Deneen von der Universität Notre Dame will zum Beispiel, dass Frauen wieder in die Küche gehen und sich um die Kinder kümmern. Er möchte, dass Priester mehr Macht haben. Das ist eine konservative katholische Ansicht, und sie ist gegen den Handel gerichtet. Auf der Linken gibt es den Harvard-Politologen Michael Sandel, der glaubt, dass der Markt zu weit gegangen sei und dass wir die Dinge auf andere Weise als durch den Markt regeln müssten. Dies ist letztlich antibürgerlich, da er vorschlägt, dass Bürokraten und Regulierungsbehörden die Bürger im Zaum halten sollten.
Was ist mit der «woken» Ideologie? Würden Sie sagen, dass sie auch antibürgerlich ist?
Ja. Obwohl ich denke, dass es tugendhaft ist, wach («woke») zu sein. In den Vereinigten Staaten gibt es Rassismus, ebenso wie es Patriarchat und Frauenfeindlichkeit gibt. Schauen Sie sich nur Donald Trump an, der all das in einem Paket zusammenfasst. Ich habe ein Problem mit der Wokeness, wenn sie an den Staat appelliert, anstatt sich auf Überzeugungsarbeit und Argumente zu stützen. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute sagen: «Ihr sollt mich als Frau bezeichnen, nicht als Mann.» Das ist mir ziemlich egal. In den USA und allen englischsprachigen Ländern hat Ms. die Bezeichnung Miss und Mrs. abgelöst. Das kam nicht, weil irgendeine staatliche Polizei sagte: «Das darfst du nicht mehr sagen!» Diese neue Auffassung war damals woke, aber sie entstand durch Überzeugungsarbeit und war absolut vernünftig. Ich bin eine radikale Verfechterin der freien Meinungsäusserung, aber ich glaube nicht an Zwang.
«Ich habe ein Problem mit der Wokeness, wenn sie an den Staat
appelliert, anstatt sich auf Überzeugungsarbeit zu stützen.»
Die Freiheit machte den Kapitalismus alternativen Systemen überlegen. Aber jetzt, wo wir künstliche Intelligenz haben und sie sich ständig verbessert, könnte diese Technologie den Etatismus oder Autoritarismus dem Kapitalismus überlegen machen?
Ich glaube nicht. Aber wer weiss schon, was die Zukunft bringt. Natürlich kann KI von faschistischen Regierungen eingesetzt werden. In China war ich an einer Konferenz an einer Universität, die auf Technologie spezialisiert ist. Sie waren so stolz, weil sie eine Gesichtserkennungstechnologie hatten. Sie sagten: «Junge, das ist wunderbar! Wir können jetzt jede Person in China beobachten!» Ich habe sie nicht angeschrien, aber ich dachte mir, dass das keine so gute Idee ist. Jede Technologie kann missbraucht werden. Alfred Nobel erfand Dynamit für den Einsatz im Bergbau und auf Baustellen. Aber natürlich wurde es auch von Staaten eingesetzt, um Menschen in die Luft zu jagen.
Sie sagen, dass die Ideen uns reich gemacht hätten. Aber wenn es stimmt, dass wir diese wachsenden antibürgerlichen Tendenzen haben, könnten diese Ideen, die auf dem Vormarsch sind, uns wieder arm machen?
Ganz genau. Der Marxismus hat weite Teile der Welt ärmer gemacht. Unter Mao und Stalin ging es den Menschen schlechter. Innovationen und Ideen sind im Allgemeinen gut, aber nicht immer, denn sie können auch schlechte Ideen und Ergebnisse hervorbringen. Der Faschismus war eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts und der Kommunismus eine Erfindung aus der Mitte des 19. Die Macht der Könige war eine Erfindung der Ägypter und Chinesen vor Jahrtausenden und eine schlechte Idee. Schliesslich sagte Gott in der Bibel zu den Israeliten, die einen König haben wollten: Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, denn ihr könntet es bekommen. In ihrem Fall bekamen sie König Saul.
Haben Sie ein Gegenmittel für schlechte Ideen?
Worauf wir uns als Ökonomen oder als normale Bürger konzentrieren sollten, ist der Kontext für die Entwicklung von Ideen. Der offensichtlichste Punkt ist, dass die Rede- und Denkfreiheit, die es den Menschen erlaubt, in das wirtschaftliche Wettrennen im Rahmen der Chancengleichheit einzusteigen, ein vitales, kreatives intellektuelles, künstlerisches oder musikalisches Leben ermöglicht. Es ist offensichtlich, dass Sklaven keine Innovationen hervorbringen.