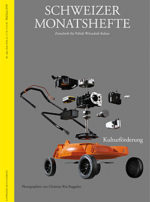Ungarn auf der Suche nach Glaubwürdigkeit
Politik zwischen Täuschung und Enttäuschung
Joseph Alois Schumpeter hat dem Entrepreneur in seiner ökonomischen Theorie einen zentralen Platz eingeräumt. Der Entrepreneur ähnele einer romantischen Führerfigur, die nicht ausschliesslich vom Macht- und Profitstreben beherrscht sei. Er müsse gegen den Strom schwimmen und immer wieder den Mut zu neuen Initiativen aufbringen. Gibt es heute in der Politik noch Persönlichkeiten, die diesem Ideal entsprechen und die, wie seinerzeit Winston Churchill, dem Volk in schwierigen Situationen klaren Wein einschenken und es auf «Blut, Mühsal, Tränen und Schweiss» einschwören?
Ferenc Gyurcsány, seit 2004 Ministerpräsident der Republik Ungarn, hat es – unter Bezugnahme auf Churchill – nach den Parlamentswahlen im April 2006 versucht. Seiner Regierung war das Kunststück gelungen, als erste nach der Wende im Amte bestätigt zu werden. Seine Botschaft war so klar wie unpopulär. Ungarn habe seit Jahrzehnten über seine Verhältnisse gelebt. Das horrende Haushaltsdefizit sei nur mit harten und konzertierten Massnahmen zu stopfen. Der Beitritt zur Eurozone drohe sonst in utopische Ferne zu rücken. Kurz, eine nationale Kraftanstrengung sei nötig, bei der jeder zu leiden habe. Vor der Wahl tönte es anders. Dem distanzierten Beobachter mögen die üppigen Wahlversprechen schon damals seltsam vorgekommen sein; die politische Bombe explodierte aber erst im September, kurz vor den Regionalwahlen. In einer Rede an die neu gewählte Parlamentsfraktion der Sozialisten (MSZP) hatte der Premier drastische Worte gewählt. Es gebe keine einzige Massnahme der letzten Legislaturperiode, auf die man stolz sein könne, ausser der Wiederwahl. Man habe bisher nur gelogen und es sei nun an der Zeit, der Realität ins Auge zu blicken. Der Mitschnitt der Rede kam an die Öffentlichkeit, ein Pulverfass explodierte. Einen Monat vor dem fünfzigsten Jahrestag der Revolution von 1956 zogen wieder Zehntausende auf den Kossuth Tér am Parlament. Randalierer stürmten das staatliche Fernsehen.
Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Die kommunistische Diktatur war in der Endphase, im Vergleich zu den Nachbarstaaten, weniger repressiv gewesen, und die Transformation verlief ziemlich reibungslos. Der glatte Übergang hatte aber auch seine Schattenseiten. Die Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen unterblieb beinahe gänzlich. Und wie in jeder Übergangsphase, waren die Gewinne unterschiedlich verteilt. In weiten Teilen der Bevölkerung entstand das Gefühl, von derselben Nomenklatura gleich zweimal betrogen worden zu sein. Der Premier selbst ist mit der Tochter einer kommunistischen Dynastie verheiratet, und er ist in der Wendezeit zu einem der reichsten Männer des Landes geworden. Diese Fakten erklären den scharfen Gegensatz zwischen den aus den Kommunisten entstandenen Sozialisten (MSZP) und der bürgerlichen Opposition des FIDESZ besser als die Unterschiede in den Parteiprogrammen. Der FIDESZ ist in mehrfacher Hinsicht sogar etatistischer als die Sozialisten und bietet keine glaubwürdigen liberalen Alternativen an. Bezüglich ihrer unverhältnismässigen Wahlversprechen unterscheiden sich beide Gruppen kaum. Dies erklärt die Tatsache, dass das politische Klima von Enttäuschung über alle bisherigen Regierungen bestimmt wird. Keine Partei konnte bisher ihre Versprechungen einlösen. Ein eigentlicher Gesinnungswandel hat nach der Wende nicht stattgefunden. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme werden nicht eigenverantwortlich und unternehmerisch gelöst, sondern stets – als Forderungen – an den Staat adressiert.
Gyurcsánys Rechtfertigung nach Bekanntwerden der Rede ist eine Art von Selbststilisierung als politischen Entrepreneurs Schumpeterscher Prägung. Es sei nun gerade das Ziel, von den Lügen wegzukommen, die in der ungarischen Politik über lange Zeit die Szene beherrscht hätten. Das Rückzugsgefecht wird an mehreren Fronten geführt. Die Rücktrittsforderungen von der Gegenseite wären nur dann glaubwürdig, wenn man dort vor den Wahlen mehr Mut zur Wahrheit gezeigt hätte. Moralisch ist Gyurcsány diskreditiert. Aber solange seine Regierung das Vertrauen der Parlamentsmehrheit hat, muss sie in ihrem Saft schmoren. Die Folgen sind katastrophal. Das ohnehin kleine Vertrauen in die Politik schwindet noch mehr dahin. Bezeichnenderweise sind es der Staatspräsident und das Verfassungsgericht, die in der Bevölkerung noch das höchste Ansehen geniessen.
Schumpeter hat sein Entrepreneur-Modell auch auf die Politik übertragen. Seine Kritiker haben dagegen eingewendet, demokratische Politik sei ein Forum für die Suche nach der bestmöglichen Lösung und nicht einfach ein Stimmenmarkt und ein populistisches Buhlen um die Gunst des Wählerschaft. Die gegenwärtige Lage der Politik in Ungarn scheint aber Schumpeter recht zu geben. Ein Politiker vom Format Churchills ist leider weit und breit nicht in Sicht.
Andreas Böhm, geboren 1977, ist Politikwissenschafter und arbeitet, nach einem Forschungsaufenthalt an der Andrassy-Universität Budapest, als Assistent an der Universität St. Gallen.