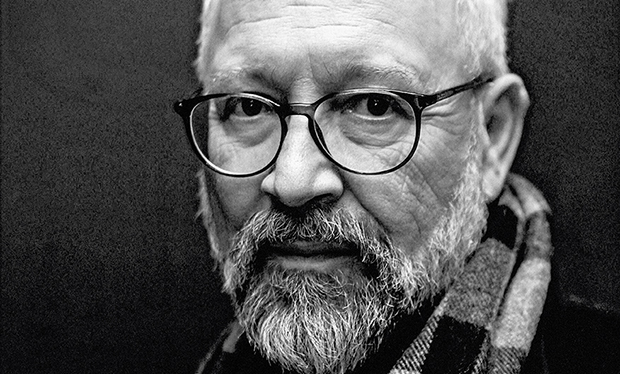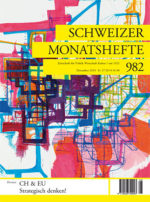Wie Demokratie (wirklich) funktioniert
Unbequeme Wahrheiten zu unserer Staats- und Regierungsform.

Das Vereinigte Königreich stimmte für den Austritt aus der EU, obwohl unter Ökonomen Konsens herrscht, dass dies das Einkommen der meisten Briten mindern wird. Die bizarr-populistische Fünf-Sterne-Bewegung gewann bei der letzten Wahl in Italien eine relative Stimmenmehrheit. Nationalistische, interventionistische Parteien kontrollieren Ungarn und Polen. In Deutschland holten die Karikatur einer Links- und die Karikatur einer Rechtspartei zusammen mehr Wählerstimmen als die Sozialdemokraten. Und die US-Wähler gewährten einem rüpelhaften, korrupten Reality-TV-Star den Zugang zu ihren Nuklearcodes. Die Schweizer, deren Demokratie so vernünftig scheint, müssen sich im Jahr 2018 fragen, ob sie von Idioten umgeben sind.
Um die Antwort vorwegzunehmen: In gewisser Hinsicht sind sie das. Aber die Dummheiten, deren Zeugen wir derzeit werden, haben ihre Wurzeln nicht in aktuellen Entwicklungen – sie sind in den Anreizstrukturen der meisten modernen Demokratien angelegt. Wähler verhalten sich «falsch», weil ihre politischen Systeme Anreize schaffen, sich falsch zu verhalten. Was bedeutet das?
Ein Märchen von der Demokratie
Die voruniversitären Bildungssysteme sind weltweit sehr unterschiedlich, aber sie scheinen ihren Schülern überall dieselbe Geschichte davon zu erzählen, wie Demokratie funktioniert. Den Politikwissenschaftern Christopher Achen und Larry Bartels folgend, können wir diese Geschichte die «Populärtheorie» der Demokratie nennen. Sie geht folgendermassen: die typische Bürgerin hat, erstens, eine gute Vorstellung davon, was ihre Interessen und Anliegen sind. Sie muss gar nicht per se eigennützig sein, vielleicht sind ihr neben ihrem Eigeninteresse etwa die Umwelt, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung wichtig. Zweitens formt sie im Lichte dieser ihrer Interessen und Anliegen so etwas wie eine Weltanschauung – ein stabiles Set von politischen Überzeugungen. Bei Wahlen prüft sie, drittens, die antretenden Parteien oder Kandidaten und wählt dann die Partei oder Kandidatin, von der sie glaubt, dass sie ihre Weltanschauung am besten bedienen, ihre Anliegen am besten umsetzen wird. Da angenommen wird, dass sich alle Wähler gleich verhalten, widerspiegelt die obsiegende Partei oder Kandidatin – viertens – den politischen Willen der grössten Koalition von Wählern. Kandidaten oder Parteien, die Wahlen gewinnen wollen, müssen also Programme vertreten, die eine breite Masse ansprechen. Am Ende stellen die Politik, die eine Demokratie umsetzt, und die Werte, auf denen sie aufbaut, auf diese Weise eine Art Kompromiss zwischen den politischen Willen der überwiegenden Mehrheit der Wähler im Land dar.
«Wähler verhalten sich ‹falsch›, weil ihre politischen Systeme Anreize schaffen, sich falsch zu verhalten.»
Das ist, in Kürze, was die Populärtheorie sagt. Leider ist es aber nicht nur kurz, sondern auch falsch. Warum es falsch ist, erkläre ich später.
Zunächst: warum sollten Demokratien daran interessiert sein, ihren Bürgern diese Theorie angedeihen zu lassen? Die Antwort ist einfach: So wie der Mythos des Gottesgnadentums der Könige die Monarchie legitimierte, legitimiert die Populärtheorie die demokratische Regierungsgewalt. Die Theorie behauptet schliesslich, Demokratien würden das tun, was gut für die Bürger sei – und auch das, was die Bürger wollten. Der Populärtheorie nach führen Präsident, Premierminister oder Kanzlerin mit ihren Verwaltungen zwar das Land, das Volk aber ist der wahre Herrscher. Oder bildlich gesprochen: die Regierung steuert das Schiff, aber wir, die Menschen, sagen, wohin es fährt.
Wenn Sie an die Populärtheorie glauben, werden Sie politische Gleichberechtigung für wichtig halten – denn die Populärtheorie behauptet, Wählen sei ein zentraler Weg, sich zu schützen und seine Interessen voranzutreiben. Wenn Sie an die Populärtheorie glauben, sind Sie vermutlich auch besorgt, Minderheiten und Kleingruppen wie die amerikanischen Ureinwohner oder die Sinti und Roma könnten überstimmt und ignoriert werden. Sie werden also sicherstellen wollen, dass solche Minderheiten am politischen Prozess teilnehmen und dass die Mehrheit sie respektiert. Die Populärtheorie legt Ihnen auch nahe, sich grosse Sorgen um den Einfluss des Geldes auf die politischen Prozesse zu machen. Wenn private Sponsoren Kampagnen oder politische Werbung finanzieren, werden Sie sich Sorgen machen, dass ihnen damit besserer Zugang zu Politikern beschieden ist und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese die Interessen der Sponsoren höher gewichten als die der Wähler. Und Sie werden sich wahrscheinlich fragen, ob es nicht besser wäre, Wahlen aus öffentlichen Geldern zu bezahlen – wobei Sie, wenn Sie schlau sind, vielleicht erkennen, dass Interessengruppen und grosse Parteien öffentliche Wahlfinanzierung zu ihren eigenen Gunsten manipulieren könnten.
Wenn Sie an die Populärtheorie glauben, werden Sie sicher annehmen, mehr Partizipation sei «gut» und niedrige Beteiligungswerte seien «schlecht». Je mehr Menschen, die sich beteiligen, desto wahrscheinlicher, dass die Regierung alle fair behandelt, nicht wahr? Folglich werden Sie möglicherweise den Wahlzwang, wie er in Australien, Ecuador oder im Kanton Schaffhausen existiert, für eine gerechtfertigte Einrichtung halten – «wir müssen die Bürger zu ihrem eigenen Wohl zum Wählen zwingen». Und schliesslich werden Sie, wenn Sie an die Populärtheorie glauben, eine erhebliche kognitive Dissonanz erleben, wenn Demokratien schlechte oder dumme Entscheidungen treffen. Sie werden vielleicht dagegenhalten, dass diese Entscheidungen in Wahrheit undemokratisch seien und auf absichtlicher Sabotage beruhten; die Demokratie würde schon funktionieren, wenn nur die russischen Hacker, die Pharmariesen, die Lehrergewerkschaften oder böse Milliardäre sie nicht ruinierten. Sie werden sich vielleicht sogar einreden, die Sieger hätten betrogen. Oder: die Bürger hätten ihre Bürgertugenden verloren und die Demokratie müsse erst recht in jeden Winkel des Lebens getragen werden, damit die Bürger endlich lernten, sich selbst zu regieren. Unter keinen Umständen aber werden Sie der Demokratie selbst die Schuld geben; stattdessen werden Sie das Dogma wiederholen, das Heilmittel gegen die Krankheiten der Demokratie sei stets: mehr Demokratie.
Das Problem ist: die empirische Politikwissenschaft hat die Populärtheorie falsifiziert. Das ganze Ding ist ein Mythos.
Macht zum Machtmissbrauch
Das Hauptproblem der Demokratie ist, dass sie den Menschen Macht gibt und sie gleichzeitig dazu einlädt, ihre Macht zu missbrauchen. Stellen Sie sich, als Analogie, eine riesige Hochschulvorlesung mit Hunderten Studenten vor. Der Dozent kündigt an: «Wir werden am Ende des Semesters eine Abschlussprüfung durchführen, die 100 Prozent Ihrer Zeugnisnote ausmacht. Da mir akademische Gleichberechtigung sehr wichtig ist, werden Sie nicht einzeln benotet. Stattdessen wird der Durchschnitt aus all Ihren Noten errechnet, und Sie werden alle dieselbe Note erhalten.» Sie gehen jetzt vermutlich davon aus, dass die Durchschnittsnote irgendwo zwischen 1 und 3 liegen wird – sehr unbefriedigend bis unbefriedigend – und dass viele Studenten sich nicht die Mühe machen werden, die Unterlagen zu studieren und zu lernen, um sich stattdessen auf die Schüler zu verlassen, die den Schnitt heben. Um zu dieser Annahme zu kommen, müssen sie nicht einmal besonders dumm oder per se faul sein – sie reagieren nur auf falsche Anreize. Auch eine Studentin, die beharrlich darauf hinarbeitet, das Unterrichtsmaterial zu beherrschen, wird davon ausgehen müssen, eine schlechte bis sehr schlechte Note zu bekommen. Vernachlässigt sie das Lernen, wird ihre Note nicht messbar niedriger sein. Selbst wenn sie es fertig bringt, den Stoff völlig verkehrt wiederzugeben, wird ihre Note allein deshalb keinen Deut schlechter ausfallen. Aber da das für alle Studierenden gilt, können wir davon ausgehen, dass die meisten von Ihnen nicht oder sogar falsch vorbereitet sein werden – das Ergebnis wird dementsprechend schlecht sein.
In grossen Demokratien haben Wähler dieselben Anreize wie diese Studenten. Nur: statt mit 500 geht ein französischer Bürger bei der Präsidentenwahl mit 47 Millionen «Mitstudierenden» zur «Prüfung». Bei wichtigen, nationalen Wahlen in modernen Demokratien zählt die einzelne Stimme also fast nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie Auswirkungen auf den Ausgang einer Wahl hat, ist verschwindend gering. Wie wir wählen, ist wichtig – wie ein Einzelner wählt, nicht.
Folglich ist in der Demokratie ein Widerspruch eingebaut: Die Demokratie nutzt Volkswahlen, um zu bestimmen, wer regiert. Indem sie die einzelne Stimme bedeutungslos macht, lädt sie den einzelnen Bürger aber gleichzeitig ein, sich ignorant, uninformiert und irrational zu verhalten und seine Stimme und sogar seine politischen Überzeugungen für andere Dinge einzusetzen als dafür, seine Interessen und Anliegen voranzubringen. Wähler können es sich leisten, sich dummen, falschen und wahnhaften Vorstellungen von Politik hinzugeben, weil sie diese Vorstellungen nichts kosten.
Das bringt uns einem realistischeren Demokratiemodell schon näher.
Um es in einem Satz zusammenzufassen: In der Politik geht es nicht um Inhalte.1
Wähler: Unstet und unwissend
Schon in den 1950er Jahren haben in den USA Politikwissenschafter, Ökonomen und Psychologen damit begonnen, zu erforschen, was Bürger wissen, wie sie über Politik denken, wie sie Informationen verarbeiten und was ihr Wahlverhalten bestimmt. Die Ergebnisse sind ziemlich deprimierend: Das realistische Bild zeigt, dass politische Loyalität ähnlich funktioniert wie ein Bekenntnis zu Footballteams: Bostoner unterstützen die New England Patriots, weil Bostoner das eben tun, nicht weil sie unabhängig voneinander zum Schluss gekommen wären, die Patriots seien das beste Team (oder auch nur das beste Team für sie). Ähnlich wählen Bostoner irischer Abstammung die Demokraten, weil Bostoner Iren das eben tun, nicht weil die Demokraten ihre Interessen und Anliegen am besten bedienten. Im realistischen Bild beeinflussen politische Interessen und moralische Werte das Wahlverhalten normalerweise gerade nicht. Die meisten Wähler haben weder feste politische Überzeugungen noch eine Weltanschauung oder ein stabiles Set von politischen Meinungen. Die meisten Parteiwähler haben nicht einmal eine besonders treffende Vorstellung davon, was ihre bevorzugte Partei oder ihre Lieblingskandidaten tatsächlich tun wollen – mehr noch: die meisten teilen oder unterstützen die Pläne ihrer Partei oder ihrer Kandidaten eigentlich gar nicht.
«In den meisten modernen Demokratien ist der typische Bürger, ja sogar der typische Wähler radikal unwissend, was einen Grossteil der relevanten politischen Informationen betrifft.»
Die meisten Wähler sind auch nicht ideologisch. Eine signifikante Minderheit beschäftigt sich aber durchaus damit, welche Dinge ihre Partei befürwortet, und kommt post hoc zum Schluss, dass sie diese Dinge ebenfalls befürwortet. Das bedeutet aber nicht, dass diese Wähler bestimmte Parteien unterstützen, weil diese sich für ihre grundsätzlichen Anliegen einsetzen. Vielmehr wählen die meisten «ideologischen» Wähler eine Weltanschauung, weil sie zu ihrer Partei passt, nicht umgekehrt. Die typische US-amerikanische Demokratin ist also nicht Demokratin, weil sie Abtreibungsbefürworterin ist; sie ist Abtreibungsbefürworterin, weil sie Demokratin ist – und letzteres ist sie aus willkürlichen und zufälligen Gründen.
In den meisten modernen Demokratien ist der typische Bürger, ja sogar der typische Wähler radikal unwissend, was einen Grossteil der relevanten politischen Informationen betrifft. In den USA weiss der Medianwähler nicht, welche Partei die Kongressmehrheit hat, und kann weder wichtige Gesetzesänderungen noch signifikante Veränderungen gesellschaftlicher Indikatoren nennen. Jedes zweite Jahr werden US-amerikanische Wähler in den «American National Election Studies» zu grundlegenden politischen Tatsachen befragt. Üblicherweise können die besten 25 Prozent der Wähler etwa 90 Prozent der Fragen richtig beantworten, die mittleren 50 Prozent schneiden unwesentlich besser ab als ein Zufallsgenerator – und die unteren 25 Prozent schlechter als der Zufallsgenerator. Aber Wähler sind nicht nur unwissend, sondern vielfach fehlinformiert. Beispielsweise überschätzten britische Bürger während der Brexit-Abstimmung deutlich, wie viele Einwanderer aus der EU im Land waren, überschätzten, wie viel China im Land investierte, unterschätzten dramatisch, wie viel die EU in Grossbritannien investierte, und überschätzten massiv, wie viel das Vereinigte Königreich an diversen sozialen Ausgleichszahlungen an die EU überweist. Je schlechter eine Bürgerin informiert war, desto höher war also die Wahrscheinlichkeit, dass sie für den Austritt aus der EU stimmte.
Wähler sind zudem kurzsichtig. Sie erinnern sich höchstens an die Wirtschaftsentwicklung der letzten sechs Monate. Dementsprechend bestrafen sie Politiker kaum je für eine schlechte Leistung – sie haben keine genaue Vorstellung davon, was Politiker getan haben oder wofür verschiedene Politiker verantwortlich sind. Empirische Studien zur Wählerpsychologie zeigen auch, dass Wähler nicht rational über Politik nachdenken. Während viele Wähler keine festen Meinungen haben, sind diejenigen, die solche Meinungen haben, oft dogmatisch. Sie ignorieren und vermeiden entkräftende Belege und glauben neue Hinweise, die ihre Ansichten zu bestätigen scheinen, automatisch. Sie konsumieren vornehmlich Nachrichten und Informationen, die mit dem, was sie glauben wollen, übereinstimmen. Sie sehen sich als Teil eines Teams. In den Vereinigten Staaten bedeutet, Anhänger der Boston Red Sox zu sein, auch, die New York Yankees zu hassen. In ähnlicher Weise verachten Parteiwähler die Wähler anderer Parteien, halten sie tendenziell für dumm und moralisch korrupt. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, behandeln sie Anderswähler schlecht, vermeiden, sie zu Nachbarn zu haben oder mit ihnen arbeiten zu müssen – sie diskriminieren sie sogar aktiv bei Stellenbesetzungen.
Zusammenfassend hängen Parteitreue und Wählerverhalten in einem realistischen Demokratiebild weder mit moralischen oder weltanschaulichen Festlegungen zusammen noch reflektieren sie die Überzeugung der Wähler darüber, wie Parteien oder Kandidaten ihren Interessen nutzen oder schaden könnten. Vielmehr reflektieren Parteitreue und Wählerverhalten ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Die Beziehungen zwischen bestimmten politischen Gruppen und Identitäten sind kontingent und willkürlich. Zwar sind Wähler wenig ideologisch, pflegen aber intensive parteipolitische Rivalitäten.
Schon vor Tausenden von Jahren stellte Platon die Hypothese auf, dass die demokratischen Massen zu ignorant seien, um sich selbst regieren zu können. Die Daten, die seine These bewiesen hätten, standen ihm noch nicht zur Verfügung. Uns schon. Wie sich zeigt, lag Platon weitgehend richtig.
Wählen: wie das Schwenken einer Vereinsfahne
Dieses realistischere Bild sollte viele Ihrer Haltungen zur Demokratie verändern: Zum einen erscheint politische Gleichberechtigung nicht länger so wichtig. In der Populärtheorie ist politische Gleichberechtigung nötig, um sicherzustellen, dass die Interessen aller gehört und fair behandelt werden können. In der Realität wählen Wähler aber nicht so, dass ihre Interessen – oder irgendjemandes Interessen eigentlich – gestärkt werden. Seine Stimme abzugeben ist kein Versuch, ein erwünschtes Ergebnis herbeizuführen; es ähnelt eher dem Schwenken einer Vereinsfahne bei einem Fussballspiel. So gesehen gleicht das Beharren auf strikter politischer Gleichberechtigung der Forderung, die Fans aller Fussballnationalteams hätten das Recht auf gleich gute WM-Partys.
Wenn Sie der realistischen Theorie folgen, werden Sie sich auch weniger Sorgen um geringe Wahlbeteiligungen machen. Da bei Wahlen weder Wählerinteressen erkennbar noch Politiker veranlasst werden, solchen Interessen zu folgen, ist es zu vernachlässigen, wie viele Menschen wählen gehen. Die Teilnahme an Wahlen für obligatorisch zu erklären ist kein Weg, die Wähler zur Selbsthilfe zu zwingen; es ist eher, als würde man Betrunkene zum Autofahren verpflichten.
Die realistische Theorie sollte Sie zugänglicher dafür machen, Alternativen zur Demokratie in Betracht zu ziehen. Schliesslich sind Wahlen in dieser Betrachtung weitgehend zufällige Ereignisse, die die Interessen und Anliegen von Wählern nicht reflektieren. Wahlen ermächtigen Wähler, aber die Wähler setzen diese Macht nicht in einer Weise ein, die ihre Werte und Überzeugungen abbildet. Der Ökonom Robin Hanson ist zum Schluss gekommen, dass wir bessere politische Ergebnisse erzielen könnten, wenn die Bürger über Werte abstimmen, aber auf Überzeugungen wetten könnten. Die Philosophen Claudio Lopez-Guerra, Alex Guerrero und David van Reybrouck haben sich dafür ausgesprochen, Wahlen durch Verlosungen zu ersetzen. Lopez-Guerra, Bryan Caplan, Thomas Mulligan und ich haben argumentiert, dass es das Beste sein könnte, inkompetente Bürger von Wahlen auszuschliessen oder, besser noch, die abgegebenen Stimmen nach politischem Wissen zu gewichten, eventuell in Kombination mit Mechanismen, die rassen- und klassenbezogenen Verzerrungen entgegenwirken. Aus Sicht der Populärtheorie sind solche Vorschläge böse; aus Sicht der realistischen Theorie scheinen sie es wert, weiterverfolgt zu werden.
Für Realisten ist es kein grosses Rätsel, dass Wähler oft schlechte Entscheidungen treffen. Es überrascht nicht, dass die US-Amerikaner einen Clown zum Präsidenten gewählt und die Briten sich in den eigenen Fuss geschossen haben: Wenn Wähler wählen, wählen sie expressiv, um ihr Bekenntnis zu ihrem Team zum Ausdruck zu bringen. Sie versuchen erst gar nicht, ihre Interessen voranzubringen. Wählen ist, wie Kleidung in Vereinsfarben anzuziehen. Nur, dass als Endresultat dieses bizarren Prozesses jemand an die Macht kommt und neue Gesetze in Kraft treten. Für den Realisten ist das Rätsel vielmehr, warum Demokratien dann doch immerhin so gute Ergebnisse erzielen, wie sie es bis anhin tun. Aber sie haben zumindest einige Antworten: Zum einen scheint es, wie Martin Gilens in «Affluence and Influence» (dt. «Wohlstand und Einfluss») zeigt, so zu sein, dass Wähler mit hohem Einkommen wesentlich mehr Einfluss haben als Wähler mit niedrigerem Einkommen. Als Verfechter der Demokratie wurmt Gilens das. Als Liberaler aber gesteht er, dass es auch einen Vorteil mit sich bringe: Wähler mit höherem Einkommen sind meist auch besser informiert und setzen sich für intelligentere politische Programme ein als Wähler mit niedrigem Einkommen. Ein weiterer Grund, wieso der Leistungsausweis von Demokratien gut ist, liegt darin, dass Politiker, Verwaltungen und so weiter signifikanten Spielraum haben, unabhängig von Wählerwünschen zu handeln – aber wissen, dass sie für allzu desaströse Entscheidungen an der Urne bestraft werden können.
Alles anders macht die Schweiz?
In der Schweiz scheint die Demokratie besser zu funktionieren als fast überall sonst. Warum ist das so? Und: kann das Schweizer Modell kopiert werden? Nun, es mag Bestandteile des schweizerischen Verfassungsdesigns geben, die andere Länder übernehmen könnten und sollten. Viele Elemente sind aber spezifisch schweizerisch. Beispielsweise hat die Schweiz eine lange Tradition einer direkten Demokratie, die auf relativ lokaler Ebene stattfindet. Die Anreize bei lokaler Politik sind ohnehin andere als auf nationaler Ebene, es ist aber auch leichter für die Bürger zu erkennen, wo Probleme liegen, und diese einzeln über konkrete Sachabstimmungen zu beheben – die Anreize sind hierbei stärker, die Möglichkeiten grösser.2 Der schweizerische Föderalismus ermuntert auch zu regelmässigen «Abstimmungen mit den Füssen»: Bürger können sich leicht zwischen Kantonen bewegen, die unterschiedliche politische «Packages» anbieten. Während die Stimmabgabe kaum Wirkung zeigt, hat es einen grossen Einfluss, den Ort zu wechseln, an dem man lebt. Die Kantone wetteifern also mit ihren Governance-Angeboten um Arbeitskräfte und Steuerzahler, dazu müssen sie fit sein. Schliesslich ist die Schweiz eine relativ kleine politische Einheit, die sich durch hohe Einkommen und gute Bildung auszeichnet. Wäre die britische Wählerschaft ähnlich zusammengesetzt, würde sie vielleicht auch bessere Entscheidungen treffen. Einen überzeugenden Weg, sie mit mehr «Swissness» zu «reparieren», gibt es aber nicht.
Wenn wir politische Institutionen entwerfen, kommen wir unweigerlich in ein unschönes Dilemma: Konzentrieren wir die Macht in den Händen weniger, machen die individuellen Beiträge dieser Einzelnen einen erheblichen Unterschied. Die wenigen haben also jeden Anreiz, ihre Macht rational und informiert zu nutzen, aber auch, das zu ihrem eigenen Vorteil zu tun. Verteilen wir die Macht andererseits breit unter den vielen, verliert zwar jeder Einzelne den Anreiz, eigensinnig zu handeln, aber auch den Anreiz, informiert zu sein, rationale, wissenschaftliche Überlegungen anzustellen oder auch nur seine Stimme dem eigenen Interesse gemäss abzugeben. Moderne Demokratien versuchen, einen Mittelweg zu finden. Das Schweizer Modell funktioniert überraschend gut, aber es gibt keine naheliegende Möglichkeit, es anderswohin exportieren zu können, ohne umfassende weitere, teils massive Strukturreformen anzustrengen. Die grösseren, zentralisierteren Demokratien scheinen dazu verdammt, immer wieder ins Schwimmen zu geraten.
Ich erlaube mir, diesen Satz von dem Ökonomen Robin Hanson zu leihen. Anmerkung der Redaktion: Der Satz lautet im englischen Original: «Politics is not about policies.» Das Englische unterteilt, was wir «Politik» nennen, in drei Begriffe: «Polity» für das Ensemble der politischen Institutionen, «policy» für politische Programme und Inhalte und «politics» für die politischen Prozesse. ↩
Man beachte hierzu, dass die Beteiligung an nationalen Abstimmungen in der Schweiz meist niedrig ist und typischerweise die am besten informierten Bürger zur Urne gehen. ↩