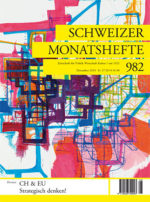Illusion eines zweistufigen Bildungssystems
Der Dualismus von Universität und Fachhochschule beruht auf der Illusion, Grundlagenforschung und Praxisbezug seien sinnvoll abzugrenzen. Der Autor warnt vor Qualitätsverlust und Nivellierung infolge grosser Zahlen.
Früher einmal, und das ist noch gar nicht lange her, war die Bildungslandschaft in der Schweiz einfach und übersichtlich. Auf der einen Seite gab es Schulen und auf der anderen Seite höhere Bildungsanstalten, die sich Hochschulen (wie die Eidgenössiche Technische Hochschule ETH oder die Hochschule St. Gallen HSG) oder Universitäten nannten. Das ist inzwischen anders geworden. Neben Universitäten gibt es seit 1996 auch Fachhochschulen, und nicht selten taucht die Frage auf, worin sich diese eigentlich noch von den Universitäten unterschieden. Denn Fachhochschulen machen alles, was Universitäten auch tun: unterrichten, weiterbilden, forschen und beraten. Und in Zukunft werden sie auch noch dieselben Titel anbieten wie die Universitäten, also Bachelor und Master. Nur für die Ausbildung von Doktoranden haben die Universitäten weiterhin ein Monopol, denn irgendwo muss es ja noch einen Unterschied geben.
Schon bei der Gründung der Fachhochschulen stellten die Bildungsexperten des Bundes umfangreiche theoretische Überlegungen an und kamen zu folgendem Resultat: Fachhochschulen sollen an–wendungs- und praxisorientiert sein, während es Aufgabe der Universitäten sei, Grundlagenforschung zu betreiben und die Welt mit neuen Theorien zu versorgen. Man wollte also ein zweistufiges tertiäres Bildungssystem, bei dem die Forschung an den Universitäten hauptsächlich neues Wissen generieren sollte.
Die Fachhochschulen hätten nach die-sem Konzept die «Rohfassung» für die Praxis zu vereinfachen und im Unterricht zu vermitteln gehabt. Zur Beschreibung dieses Vorgangs benutzte man das noble Wort «angewandte Forschung», mit dem zugleich die neue Domäne der Fach-hochschulen charakterisiert wurde. Und ähnlich stellte man sich auch die Arbeitsteilung der Wissensvermittlung vor: Universitäten werfen den Studierenden schwer verdauliche Theoriebrocken an den Kopf, während Fachhochschulen den Stoff in Form von leicht verdaulichen und praxisrelevanten Häppchen servieren.
Diese Konzeption eines zweistufigen Hochschulsystems war von Anfang an eine Illusion. Auf der einen Seite ist es heute auch für Universitäten absolut en vogue, praxisorientiert zu sein. Forschung im Elfenbeinturm ist zu einem Schimpfwort geworden, und auch Universitäten wollen moderne, anwendungsorientierte Dienstleistungszentren sein. Auf der anderen Seite erwies sich die den Fachhochschulen ursprünglich zugedachte Dienerrolle – als Scharnier zwischen Universität und Praxis – als realitätsfremd. Vielmehr entwickelten die Fachhochschulen in verschiedenen Bereichen eigene Forschungskompetenz, die sich in vielen Publikationen und technischen Entwicklungen manifestiert. Die theoretisch vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie so schön ausgedachte Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Heute ist es so, dass an Universitäten und an Fachhochschulen parallel, teilweise sogar gemeinsam geforscht wird. Entscheidend ist letztlich immer die Kompetenz der Forschenden auf bestimmten Gebieten und nicht, ob sie an einer Uni oder an einer FH lehren.
Gibt es also gar keine wirklichen Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Universitäten? Schauen wir auf die Inhalte von Lehre und Forschung in den Bereichen Technik, Wirtschaft oder Soziales, so sind die Unterschiede oftmals marginal; mit der Einführung von Bachelor und Master werden sie sich weiter verwischen.
Stärken der Fachhochschulen
Der Hauptunterschied liegt darin, dass Fachhochschulen tendenziell klein und lokal verankert sind, während Universitäten Massenbetriebe darstellen, die mit ihrer Region im allgemeinen wenig zu tun haben. Gerade diese Unterschiede machen heute eine Stärke der Fachhochschulen aus. So findet man an den Schweizer Fachhochschulen ein im Vergleich zu den Universitäten geradezu traumhaftes Betreuungsverhältnis zwischen Dozierenden und Studierenden. Der Unterricht findet in relativ kleinen Klassen statt, was eine vermehrte Vermittlung des Stoffes im Dialogverfahren ermöglicht und den Einsatz verschiedener, an den Stoff angepasster Lernmethoden erleichtert.
Auch die regionale Verankerung ist eine Stärke der Fachhochschulen, denn die Universitäten haben jene in ihrem Bestreben nach internationaler Ausrichtung immer mehr verloren. Die Professoren stammen an den Universitäten nur noch zu einem kleineren Teil aus der Schweiz, mit lokaler Politik und Wirtschaft haben sie wenig am Hut. Schliesslich geht es darum, internationale Spitzenforschung zu betreiben, und dazu braucht es keinen Bezug zur Region. Einige der neu entstandenen Fachhochschulen haben dieses Vakuum inzwischen entdeckt und sind in die Bresche gesprungen. Kantonale Behörden, Gemeinden, Spitäler oder Schulen, aber auch Unternehmen beanspruchen vermehrt die Dienste «ihrer Fachhochschule», da hier die notwendige Vertrautheit mit den regionalen Verhältnissen vorhanden ist.
Trotz diesen Stärken brauchen die Universitäten eine allzu starke Forschungskonkurrenz vorläufig nicht zu befürchten. Denn die Fachhochschulen sorgen selbst dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. So schmückt sich jede Fachhochschule zwar gerne mit ihren Erfolgen in der Forschung und publiziert grossangelegte Forschungsberichte, doch bei der Finanzierung wird diese Forschung meist stiefmütterlich behandelt. Alles Geld sollte von aussen, das heisst über Aufträge hereinkommen, und die Forschenden müssen sich mühsam von Projektantrag zu Projektantrag durchboxen. Dem Aufbau einer echten Forschungskompetenz sind somit enge Grenzen gesetzt, die Forschung lebt hauptsächlich vom Know how, das sich Fachhochschulprofessoren, vor ihrer Anstellung, an den Universitäten erworben haben. Behindert wird die Forschung auch durch eine oftmals dirigistische und bürokratische Forschungspolitik, bei der Direktionen darüber entscheiden, was sinnvolle und gute Forschung in den einzelnen Fachgebieten sei, und wo man sich jedes Projekt von ganz oben genehmigen lassen muss. Die Selbstverwaltung und Grundfinanzierung der Universitäten verleiht diesen gegenüber den Fachhochschulen nach wie vor einen gewaltigen Vorsprung.
Es besteht die akute Gefahr, dass die zur Zeit ausgezeichneten Bedingungen zum Studium an einer Fachhochschule mit der Zeit verloren gehen. Gemäss den Schätzungen des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie soll die Zahl der Studierenden in diesem Bereich in nächster Zeit beträchtlich ansteigen. Daran ist an und für sich nichts auszusetzen, wenn dabei eine gewisse Verlagerung der Studierenden weg von der Uni hin zu den Fachhochschulen stattfände. Das heisst, dass sich diejenigen Studierenden, die eher eine praxisnahe und gut organisierte Ausbildung wünschen, für eine Fachhochschule entscheiden und damit auch die Universitäten entlasten. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Die Universitäten versuchen stattdessen, noch grössere Massenbetriebe zu werden und die Fachhochschulen gewinnen nur zusätzliche Studierende durch eine Zunahme der Gesamtzahl der Studierenden. Hier zeichnet sich deutlich die Gefahr einer Nivellierung nach unten ab: immer mehr aber im Durchschnitt immer schlechtere Studierende.
Quantität statt Qualität
Generell läuft die Schweiz Gefahr, dass hier zunehmend eine «Tonnenideologie» nach dem Motto «je mehr, desto besser» den Ton angibt. Unser Land weist nämlich von allen Industrieländern auf Hochschulstufe die geringste «mittlere Bildungsdauer» auf. Diese wird aufgrund der pro Einwohner durchschnittlich an einer Hochschule verbrachten Zeit ermittelt. Schweizerinnen und Schweizer studieren im Durchschnitt nur etwas mehr als ein Jahr an einer Hochschule (in Finnland sind es fast drei Jahre), und nur knapp 20 Prozent schliessen ein Hochschulstudium ab (in Finnland sind es 40 Prozent). Also, so sagen sich viele Politiker, müssen wir die Zahl der Studierenden erhöhen und an das OECD-Niveau anpassen. Der Schweizer Bundesrat denkt bereits in diese Richtung. In seinem vor kurzem vorgeschlagenen Wachstumsprogramm nimmt die Bildung einen grossen Stellenwert ein, und der Bund will prüfen, ob man nicht die im internationalen Vergleich geringe Zahl der Hochschulabgänger erhöhen müsste.
Alle «Tonnenideologien» haben sich bis heute als falsch herausgestellt, die meisten hat man inzwischen auch überwunden. Nur im Bildungsbereich scheint man sich davon nicht lösen zu können, und man glaubt nach wie vor, dass mehr Hochschulabgänger auch mehr Wohlstand bringen. Was auf den ersten Blick wie ein Manko aussieht, nämlich der niedrige Anteil der Hochschulabsolventen an der Gesamtbevölkerung, ist in Wirklichkeit eine der grössten Stärken der Schweiz. Die Schweiz hat es bisher einigermassen geschafft, die Entwicklung in Richtung Massenuniversitäten im Zaum zu halten und die Qualität der Universitäten zu wahren. Worauf es nämlich wirklich ankommt, ist nicht die Zahl der Studierenden, sondern ob die intellektuell begabten jungen Menschen eines Landes eine qualitativ gute Ausbildung an den Universitäten oder Fachhochschulen erhalten können. Und der Prozentsatz der intellektuell begabten jungen Menschen eines Landes ist längerfristig ziemlich konstant und hat sich gegenüber Bildungsreformen als äusserst resistent erwiesen. Was hingegen nicht konstant ist, ist das Niveau der Bildungsinstitutionen. Erhöht man die Zahl der Studierenden, dann ist das im allgemeinen gleichbedeutend mit einer Senkung des Ausbildungsniveaus.
Halten wir also fest: Die Fachhochschulen bilden eine wirkliche Bereicherung der schweizerischen Hochschullandschaft, sowohl in der Bildung als auch in der Forschung. Ein Hang zur Bürokratie und ein knauseriges Verhalten gegenüber den Forschenden verhindern jedoch zur Zeit eine weitere Entfaltung der bereits ansehnlichen Forschungskompetenz. Was die Ausbildung betrifft, so haben sich die Fachhochschulen gegenüber den Universitäten dank ihrem optimalen Betreuungsverhältnis und ihrer übersichtlichen Struktur zu einer ernstzunehmenden Alternative entwickelt. Das angestrebte Wachstum der Studentenzahlen an den Fachhochschulen sollte aber nicht durch einen ständigen Anstieg des Prozentsatzes der Hochschulabgänger erreicht werden; denn das ist zwangsläufig mit einer Nivellierung nach unten verbunden. Vielmehr sollte eine teilweise Verlagerung des Studiums von den Universitäten an die Fachhochschulen eingeleitet werden. Dies würde es den Universitäten ermöglichen, das Niveau ihrer Ausbildung wieder anzuheben. Wer an einer Universität studiert, sollte vor allem auch ein theoretisches Interesse mitbringen. Für die mehr praktisch interessierten Studierenden bieten die Fachhochschulen eine sinnvolle und keineswegs zweitklassige Alternative. Sie wird bis jetzt noch zu wenig genutzt. Die Wirtschaft hat den Wert der praxisorientierten Fachhochschulbildung bereits erkannt. Fachhochschulabgänger im Bereich Wirtschaft verdienen nach dem Studium im Durchschnitt etwas mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen von den Universitäten.