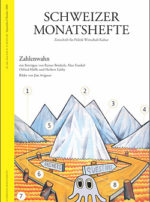Helfen oder weglaufen? Im Krieg wird die Wahl zwischen richtig und falsch plötzlich existenziell
Wir alle tragen sowohl Zivilcourage als auch Feigheit in uns. Auch ich habe mich schon einschüchtern lassen. Und ich bereue es bis heute.

Wir stehen zu dritt am Ufer eines kleinen Flusses im Süden der Ukraine. Witali und Roman sind Soldaten. Zusammen sehen wir uns das Desaster an, das die russische Artillerie in dem etwa zwanzig Meter breiten Gewässer angerichtet hat. Zwei zerfetzte ukrainische Lastwagen stehen im Wasser, und auf dem andern Ufer ragt das abgerissene Heckteil eines kleineren Fahrzeugs mit zwei Rädern in die Luft. Ukrainische Pioniere hatten hier eine Furt mit Steinen aufgefüllt, sodass auch schwere Panzer auf dem improvisierten Damm übersetzen können. Die russischen Granaten haben dem nun allerdings ein Ende gesetzt.
Witali wünscht sich ein Foto von sich mit der eindrücklichen Szenerie im Hintergrund. Das ist eine dumme Idee, wir stehen schon viel zu lange im Freien und sind von weitem sichtbar. Die Kamera einer Drohne kann uns auch aus grosser Distanz sehen, ohne dass wir eine Chance hätten, das kleine Fluggerät am Himmel zu erspähen. Inzwischen meldet der Drohnenpilot wohl seine Beobachtung einer Artilleriebatterie.
Wir machen noch ein paar Fotos und drehen dem Fluss dann den Rücken zu, wollen gehen. Da schlägt wenige Meter hinter uns eine Granate ein. Es ist ein gewaltiger Knall, und ich spüre, wie Schlamm an meinen Nacken spritzt. Meine Ohren sausen. Welches Glück, dass ich nur von Erde getroffen wurde! Vor den Granatsplittern hat mich die Böschung des Ufers geschützt. Wir laufen, so rasch wir können, denn jeder von uns erwartet die nächste Granate: Witali zuvorderst, ich in der Mitte und der etwas fester gebaute Roman zuhinterst.
Plötzlich liegt Roman im Schlamm. Ist er verwundet?
Ich kehre um und frage ihn, ob es ihm gut gehe. Er sei nur ausgerutscht wegen der schlechten Schuhe, die er trage, kommt die prompte Antwort. Ich solle nur weiterlaufen. Ausser Atem suchen wir Schutz bei ein paar Hausruinen. Doch die zweite Granate kommt nie.
Wer die unzähligen Kriegsvideos aus der Ukraine sichtet, wird schnell merken, dass es oft nicht rational ist, einem Gestürzten oder Verwundeten in einer derartigen Situation zu helfen. Rational wäre es, wenn alle in verschiedenen Richtungen davonliefen, bevor die nächste Granate oder Drohne einschlägt. Wäre Roman damals getroffen worden, hätte ich mir aber mein Leben lang Vorwürfe gemacht. Ich hätte unter Gewissensbissen gelitten. Und obwohl die Entscheidung, wegzulaufen oder umzukehren, in einem Sekundenbruchteil gefällt wurde, waren mir die Folgen für meine eigene Psyche klar. In diesem Fall hält man sich an das Prinzip, Hilfe zu leisten. Auch wenn es Gefahr für einen selbst bedeutet.
«Wäre Roman damals getroffen worden, hätte ich mir mein Leben lang Vorwürfe gemacht.»
Ein Jahr später in Zürich-Oerlikon: Ein Jugendlicher attackiert einen älteren Mann, der mit seinen Einkäufen gerade auf dem Weg nach Hause ist, mit Faustschlägen. Ich schreie den jungen Typen an und laufe über die Strasse, um dem Angegriffenen zu helfen. Dabei glaube ich ganz allein zu sein. Doch es gibt auch in der Schweiz Menschen mit Zivilcourage: Ein grosser kräftiger Mann kommt zu Hilfe, packt den Jugendlichen am Kragen, hebt ihn hoch und drückt ihn gegen einen Recycling-Container. Ein herbeigeeilter Araber hält derweil die Freunde des Aggressors in Schach. Das Ganze geht glimpflich aus und der ältere, offenbar psychisch behinderte Mann kann nach Hause gehen.
Gerettet statt ausgeraubt
In vielen Situationen wissen Menschen, was richtig und was falsch ist. Es gibt jene, die feige weitergehen, wenn sie jemanden in Not sehen, und andere, die stehen bleiben, eingreifen oder zumindest Polizei oder Ambulanz anrufen. Diese Beobachtung habe ich in den verschiedensten Ländern und Kulturen gemacht.
Als ich für die NZZ Korrespondent in Schwarzafrika war, hatte ich mit dem Motorrad einen schweren Unfall – mitten in der Nacht und mitten in der von Gewaltkriminalität geplagten kenianischen Hauptstadt Nairobi. Ich lag auf dem Asphalt, unfähig aufzustehen, weil mein Fuss nur noch über Sehnen und ein paar Muskelstränge mit dem Unterschenkel verbunden war.
Doch anders als erwartet kam niemand, um mein Telefon, Geld oder Motorrad zu stehlen. Autos hielten an, Menschen halfen mir auf, sie suchten meine Brille und hievten mich auf den Hintersitz eines Fahrzeugs, um mich danach in die Notaufnahme zu fahren. Tage später, als es mir besser ging, kam einer der nächtlichen Helfer, um mir zu sagen, er habe mein Motorrad an einen sicheren Ort gebracht. Ob ich jemand schicken könne, der es abhole. Das Ehepaar, das mich ins Spital gebracht hatte, besuchte mich am Krankenbett und wollte für mich beten.
Diese Leute haben mich gerettet. Es ist nur selbstverständlich, dass ich im Gegenzug andern in Not helfe, so gut ich eben kann.
Verhinderter «Dschihadist»
Die Entscheidung, was richtig und was falsch ist, fällt nicht immer leicht. Doch manchmal ist es sehr simpel. Die Supermacht Sowjetunion überfällt Ende 1979 das kleine und arme Afghanistan. Ich bin zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Der Überfall politisiert mich, ich beginne, Zeitungen zu lesen, und fange an, mir eine Meinung zu bilden. Ich empfinde es als eine riesige Ungerechtigkeit, wie die Sowjets in Afghanistan vorgehen. Und was mich besonders ärgert: Es scheint niemanden besonders zu interessieren. Es gibt keine Grossdemonstrationen wie während des Vietnamkriegs.
1984, nach meiner Matura, reise ich mit meinem älteren Bruder nach Pakistan, der Basis der afghanischen Rebellen, die im Nachbarland gegen die Sowjets kämpfen. Ich habe mir eine Fotokamera gekauft, aber eigentlich möchte ich mich in Afghanistan den Rebellen anschliessen und ebenfalls kämpfen. Heute würde man einen solchen Menschen «Dschihadist» nennen. Aber es gibt viele Hindernisse, nicht zuletzt die Durchfallerkrankungen, die alle westlichen Besucher Afghanistans heimsuchen. So realisiere ich bald, dass ich mit einer Kalaschnikow in der Hand weniger bewirken kann, als wenn ich Bilder schiesse, Tagebuch führe und meine Texte Zeitungen in der Schweiz und Deutschland anbiete. Die unabhängige Berichterstattung am Ort des Geschehens hilft den Afghanen mehr als ein kränkelnder «Dschihadist». So bin ich Journalist geworden.
«Ich realisierte bald, dass ich mit einer Kalaschnikow weniger bewirken kann, als wenn ich Bilder schiesse, Tagebuch führe und Texte schreibe.»
Als ich wieder in der Schweiz bin, droht der sowjetische Botschafter in Pakistan allen Journalisten, die illegal nach Afghanistan einreisen, mit dem Tod. Die totalitäre Supermacht Sowjetunion will sicherstellen, dass nur jene Informationen nach aussen gelangen, die ihre Sicht der Dinge stützen. Dennoch reise ich danach noch zweimal mit den Rebellen nach Afghanistan, schreibe Zeitungsreportagen und veröffentliche erste Fernsehbeiträge, gefilmt mit einer Super-8-Kamera.
Nebenher lerne ich Persisch, um mich mit den Afghanen besser verständigen zu können. Was ich für richtig halte – nämlich unabhängig aus dem Kriegsgebiet zu berichten –, zahlt sich am Ende auch für mich persönlich aus. Ich veröffentliche nun regelmässig Artikel, und der Sonderberichterstatter der UNO für die Lage der Menschenrechte in Afghanistan lädt mich nach Genf ein, damit ich ihm persönlich über meine Erfahrungen berichte. Im Februar 1989 zieht sich die Sowjetunion aus Afghanistan zurück, was den dortigen Bürgerkrieg aber nicht beendet. Im Juni desselben Jahrs fällt der Eiserne Vorhang in Europa, und im Dezember 1991 wird die Sowjetunion aufgelöst. Der Überfall auf Afghanistan entpuppt sich im Nachhinein als einer der Katalysatoren, die das Schicksal des kommunistischen Machtblocks in Europa besiegeln.
Die Motivation, heute in die Ukraine zu reisen, bis zur Front, und dabei mein Leben und meine Gesundheit zu riskieren, ist immer noch die gleiche. Trotz aller argumentativen Verrenkungen von Putin-Anhängern, warum Russland keine andere Wahl geblieben sei, als die Ukraine anzugreifen, ist die Sache eigentlich sehr simpel: Es gibt einen Aggressor, und es gibt einen Angegriffenen, der sich verteidigt. Ausserdem gefährdet der russische Vorstoss die Friedensordnung in Europa und stellt damit auch für uns in der Schweiz eine Gefahr dar. Man muss schon mit Blindheit geschlagen sein, um das nicht zu sehen.
Wegen meiner Berichterstattung aus der russischen Region Kursk, in die ich mit ukrainischen Soldaten gereist war, will die russische Justiz nun einen Haftbefehl gegen mich ausstellen. Inzwischen sind neben mir noch mindestens 13 andere Journalisten betroffen. Medien sollen eingeschüchtert werden, über den Krieg gegen die Ukraine zu berichten. Einen solchen, möglicherweise international ausgestellten Haftbefehl kann ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber Aufgeben ist keine Option.
Falsche Furcht
Als jungem NZZ-Redaktor wurden mir in den 1990er-Jahren Akten zugespielt, die Funktionäre einer Schweizer Grossbank schwer belasteten. Während der Recherchen kam es dann zu einem Austausch mit der Rechtsabteilung der Grossbank: Ich sass in einem Konferenzraum fünf Anwälten des Finanzinstituts gegenüber. Damals liess ich mich einschüchtern, weil ich mich vor rechtlichen Schritten und Gerichtsprozessen fürchtete. Das war ein Fehler, den ich noch heute bereue. Die Grossbank musste am Ende für ihre Fehler geradestehen, doch ich hatte das Informationsleck nicht genutzt – eine schwere journalistische Sünde.
In der Folge versprach ich mir, mich nie mehr einschüchtern zu lassen. Als ich im letzten Sommer in einem ukrainischen Schützenpanzer die russische Grenze überquerte, sass ein rumänischer Journalist neben mir. Mircea Barbu hatte im Fernsehen über den Krieg in der Region Kursk berichtet und wurde nun von den Russen international zur Fahndung ausgeschrieben. Als Barbu von seinem Haftbefehl erfuhr, sass er gerade in der U-Bahn und lauschte einem Hörbuch von Alexei Nawalny, dem 2024 im Gulag umgekommenen russischen Oppositionsführer. Auf Facebook zitierte Barbu folgenden Satz Nawalnys: «Die einzigen Momente in unserem Leben, die wirklich zählen, sind jene, in denen wir das Richtige tun, in denen wir den Blick nicht auf den Tisch senken, sondern wenn wir den Kopf heben und uns in die Augen sehen. Nichts anderes zählt.»