Fabel
Ein kalifornisches Märchen

Es war einmal ein Mann, der hatte eine Therapeutin. Die wollte, dass der Mann ein paar Dinge aufarbeitet, indem er eine Geschichte darüber erzählt.
Der Mann wohnte ganz allein in einer 1-Zimmer-Hütte in einem ziemlich zwielichtigen Stadtteil. Eines Morgens wachte er auf und erkannte, dass es das im Grunde für ihn gewesen war. Das war nicht schlimm. Aber es war auch nicht toll. Und wahrscheinlich würde es sich nicht bessern. Der Mann war schlau genug, um sich darüber im Klaren zu sein, aber die Schläue reichte nicht, um etwas daran zu ändern. Er lebte bis ans Ende seiner Tage, dann starb er. Punkt. Zufrieden?
Der Mann merkte, dass seine Therapeutin das gar nicht lustig fand.
Ein recht unbefriedigendes Ende, meinte die Therapeutin. Das könne der Mann doch besser. Der Mann dachte: Meint sie das wirklich ernst? Doch er behielt es für sich. Der Mann war nicht davon überzeugt, dass er überhaupt mit der Therapeutin zu sprechen brauchte, aber er hatte schon so viele andere Dinge ausprobiert (Tränke, Zaubersprüche, Hexen), so viel Kupfer und Silber ausgegeben und stand immer noch mit leeren Händen da. Deswegen dachte er sich: Was soll’s, warum nicht.
Wie soll ich das machen?, fragte er.
Warum fangen Sie nicht noch einmal von vorne an?, erwiderte die Therapeutin. Und konzentrieren Sie sich diesmal auf die Details, statt zum Ende zu hetzen.
Okay, sagte der Mann.
Es war einmal ein Mann, der nicht mit dem Schwert umgehen konnte und sich ausserdem vor Drachen fürchtete, also meldete er sich für den LSAT an, schnitt ziemlich gut ab und wurde an einer anständigen Uni zum Jurastudium zugelassen. Dort lernte er nützliche Fertigkeiten. Fertigkeiten, mit denen er im Dorf seinen Lebensunterhalt verdienen und die Dorfbewohnerinnen umwerben konnte.
Doch bald nach dem Abschluss fand der Mann heraus, dass in seinem Dorf viele Leute die gleichen Fertigkeiten besassen. Sehr viele Leute sogar. Wirklich unglaublich, wie viele Anwälte es in dem Dorf gab. Entsprechend waren die örtlichen Jungfern trotz seiner Anstrengungen nicht sonderlich beeindruckt. Ausserdem schämte sich der Mann, dass er nach so einer umfassenden Ausbildung immer noch nicht mit dem Schwert umgehen konnte.
Doch für den Mann war das in Ordnung. Absolut kein Problem. Er fühlte sich kein bisschen unzulänglich. Er fand einen Job in einer mittelgrossen Kanzlei. Das Gehalt lag ein bisschen unter dem Durchschnitt, und die Stelle war nicht gerade seine erste Wahl. Vielleicht in den Top drei. Oder Top fünf. Irgendwo da. Trotzdem hätte der Mann es auch schlechter treffen können. Er ging seinem Tagewerk mit einigem Geschick nach und baute sich so eine recht angenehme Existenz auf. Konnte die Gesellschaft seiner Lieben geniessen. Seine Eltern waren allerdings inzwischen beide tot und seine Schwester lebte in einem Königreich auf der anderen Seite des Meeres. Aber es war nicht so, als hätte er keine Freunde. Hatte er nämlich absolut. Leute, die er anrufen konnte, wenn er mal Lust auf ein Bier oder einen Film hatte. Aber dann waren da diese Nächte. Wenn der Mond neu war und der Himmel schwarz und die Stunde vor Sonnenaufgang sich hinzog, als würde sie niemals enden. In diesen endlosen Nächten lag er allein in seiner Hütte, schaute aus dem Fenster in den sternenleeren Himmel und fragte sich: Gab es da draussen ein Leben für ihn? Jemanden, der ihn lieben würde? Oder es wenigstens lernen könnte, ihn zu lieben, sich von ihm lieben lassen würde?
Er spielte mit dem Gedanken, eine junge Dame zu verzaubern, doch er besass keinerlei magische Kräfte, das kam also nicht in Frage. Wenn er eine holde Maid finden wollte, die mit ihm den Bund der Ehe einging, musste er das auf die altmodische Art und Weise tun: Er musste sie überlisten. Kleiner Scherz. Nein, er musste eine Frau mit niedrigen Erwartungen finden, damit er auch nur den Hauch einer Chance hätte.
Schliesslich fand er solch eine Frau, die einzige Tochter des Kerzenziehers, ein Mädchen, das als unscheinbar galt. Und traurig. Ziemlich traurig sogar. Erst nach vielen Ehejahren sollte der Mann verstehen, wie traurig sie wirklich war.
Doch eins nach dem anderen. Jetzt war dem Mann erst einmal klar geworden, dass er die Tochter des Kerzenziehers heiraten musste. Denn anders als die anderen Dorfbewohner, den Kerzenzieher miteinbezogen, konnte der Mann eines sehen: Die junge Dame war überhaupt nicht unscheinbar. Sie besass lediglich gewisse Zauberkräfte, mit denen sie ihren Liebreiz verschleierte. Der Mann sagte dem Mädchen, er kenne ihr Geheimnis. Sie leugnete es, und er sagte, er habe gewusst, dass sie es leugnen würde. Natürlich müsse sie abstreiten, dass sie eigentlich die schönste Jungfer im Dorf, ja vielleicht im ganzen Königreich sei. Das Mädchen sah verwirrt aus. Schamesröte überzog ihr Gesicht. Sie schaute ihm in die Augen, wollte ihn verstehen. Neckte der Mann sie etwa? Doch der Mann lächelte nicht. Er wirkte ernst. Er wisse, weshalb sie ihre Schönheit durch Zauberkraft verberge, sagte er: um sich zu schützen. Aber aus irgendeinem Grund könne er (und nur er) sie durchschauen. Da brach das Mädchen in Tränen aus, weil der Mann sie sicherlich nur demütigen wollte. Doch sie sah, dass er ernst blieb. Und nach einer Weile versiegten ihre Tränen, und mit feuchten Wangen gab sie dem Mann einen sanften Kuss auf den Mund.
Der Mann bat den Kerzenzieher um die Hand seiner Tochter. Der Vater verlangte, der Mann möge einen Drachen töten, um seine Hingabe zu beweisen. Obwohl der Mann in ganz guter Verfassung und wirklich überhaupt nicht schlecht in Form war, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass er keine Zeit fürs Fitnessstudio hatte, so war er doch immer noch nicht stark genug, um ein zweihändig geführtes Ritterschwert zu schwingen. Praktisch veranlagt, wie er war, machte er sich also auf die Suche nach dem kleinsten aller Drachen.
Nach einer langen Suche fand er schliesslich einen, der kaum grösser als ein Rebhuhn war. Ein Junges vielleicht. Und wenn wir ehrlich sind, wirkte der Drache auch leicht kränklich. Er sah aus verängstigten, feuchten Augen zu ihm auf, und als der Mann das Schwert hob, um ihn zu töten, da sagte seine Braut: Bitte, tu das nicht. Das ist doch blöd. Du musst kein Drachenbaby umbringen, nur um mir irgendwas zu beweisen. Na gut, erwiderte der Mann und versuchte, sich die Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Er senkte das Schwert, tätschelte dem Drachenjungen den Kopf und schickte es zurück in seine Höhle oder woher es sonst gekommen sein mochte. Der Kerzenzieher war wütend, oder vielleicht ist das das falsche Wort – er hatte ein recht mildes Herz –, aber auf jeden Fall leicht angefressen. Dennoch wollte er seine Tochter verheiraten, und so gab er den beiden widerwillig seinen Segen. Der Mann hatte eine Frau gefunden.
Er sagte zu ihr: Ich werde dir ein gutes Leben bieten. Oder wenigstens ein ziemlich gutes. Sie sagte: Halt den Mund und lass uns verschwinden, bevor mein Vater es sich anders überlegt.
Und das taten sie.
Und der Mann liebte seine Frau. Zumindest so gut er das konnte. Der Mann war ungeschickt, mit den Händen wie mit dem Herzen. Er stolperte über Wörter, verpasste Gelegenheiten und konnte, den besten Absichten zum Trotz, nicht gut mit zerbrechlichen Gegenständen umgehen. Die beiden führten ein ruhiges Leben, das von Vernunft und gezügelten Erwartungen bestimmt wurde. Vielleicht kein Stoff, aus dem Legenden gemacht wurden. Nicht gerade eines «Es war einmal…» würdig. Doch es war angenehm und ehrlich.
Er fragte sich laut, ähem, ob er seine Therapeutin mit dieser Geschichte nicht schrecklich langweilte.
Doch langsam verstand der Mann, dass seine Therapeutin nicht locker lassen würde, bis er nicht
(1) einen emotional aufrichtigen Weg zu
(2) einem unerwarteten und
(3) doch unausweichlichen Ziel
gefunden hatte. Was auch immer das heissen mochte.
Der Mann atmete tief durch und fuhr fort.
Es war einmal ein Typ, der kein Schwert halten konnte und sich fast in die Hose machte, wenn er einen Drachen vor sich hatte, und sei er noch so klitzeklein, also studierte er Jura, lernte ein paar nützliche Fertigkeiten, und nach dem Abschluss wurde er Anwalt, was er ganz gut hinbekam und womit er sich ein Leben aufbaute. Zumindest versuchte er es.
Super. Der Therapeutin gefiel die Richtung, die das Ganze annahm.
Doch er träumte von mehr. Er erzählte seiner Frau davon, wenn sie abends in ihrem kalten, steinernen Häuschen lagen.
Ach ja?, fragte sie hoffnungsvoll. Ein bisschen überrascht. Wovon träumst du? Davon, ein Held zu sein?
Nein, antwortete er kleinlaut. Tief im Innern träumte er nicht davon, ein Anwalt oder ein Held zu sein, sondern ein Schmied. Albern, das wusste er, weswegen er nie jemandem davon erzählt hatte. Er wartete darauf, dass sie lachen würde, doch sie lachte nicht. Sie sagte, das sei ein wunderschöner Traum.
Kaum hatte er es jedoch ausgesprochen, da redete der Mann es sich schon wieder aus. Das Schmiedehandwerk war altmodisch, und kaum noch jemand verdiente damit Geld. Natürlich würde er weiter als Anwalt arbeiten. Würde immer für seine Frau sorgen. Und die Tochter des Kerzenziehers erwiderte: Das weiss ich doch.

Es war kalt, also schmiegten sie sich aneinander. Liebten sich unter dem fast leeren Nachthimmel. Durch das Fenster erblickte der Mann einen einzelnen Stern. Er hing tief und leuchtete auf sie hinab.
So lief es eine Zeitlang ganz gut. Sie sprachen abends miteinander, liebten sich, und dann schlief der Mann ein und seine Frau lauschte seinem Schnarchen und sorgte sich um ihn. Er wirkte müde, überarbeitet. Sie sorgte sich weit über die Geisterstunde hinaus und sank dann, kurz vor Sonnenaufgang, in einen ruhelosen Halbschlaf. Sie litt an Angstzuständen und nahm Tränke dagegen, Kräuter und andere Dinge aus der Apotheke. Alles davon bekam sie verschrieben – sie behandelte sich nicht etwa selbst oder so. Aber die Tränke halfen nicht oder nur wenig – sie wurde vergesslich, verlor hie und da eine Stunde, doch nichts linderte ihr Grauen. Es stellte sich heraus, dass sie das Grauen zu Recht verspürte.
Eines Nachts, als sie beide schliefen (das waren nur wenige Stunden), belegte eine ihnen unbekannte Hexe von weit weg ihr Haus mit einem Fluch. Den Grund dafür sollten sie nie erfahren. Der Segen eines Kindes würde ihnen auf ewig verwehrt bleiben. Ihr Stern stand am Himmel und würde nie zu ihnen herab auf die Erde fallen.
Die Eheleute gingen unterschiedlich mit dieser Nachricht um. Die Tochter des Kerzenziehers stürzte sich in Recherchen, las zahlreiche Bücher. Fand eine Selbsthilfegruppe, die sich jeden Dienstag traf. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte, und redete nicht weiter darüber. Legte mit dem Schmiedehandwerk eine Pause ein. Knirschte nachts mit den Zähnen. Sie entfernten sich voneinander. Der Mann wollte seine Frau berühren, bei ihr liegen, aber der Kummer war zu gross.
Doch sie liebten einander. Eines Tages nach der Arbeit kam der Mann mit zwei Flaschen guten Weins nach Hause, und sie öffneten beide und setzten sich auf den Boden im Wohnzimmer ihres Häuschens und tranken den Wein aus und assen einen ganzen Laib Brot und lachten übereinander und sich selbst. Sie versuchten, irgendetwas Gutes daran zu entdecken, dass sie so bösartig verflucht worden waren, und als sie am nächsten Morgen erwachten, ging es ihnen etwas besser.
Sie erstellten eine Liste. Man konnte immer noch adoptieren. Das würde Zeit, Geld, Geduld und Glück kosten. Doch sie hatten es ja nicht eilig, oder? Und während sie warteten, konnten sie Spass miteinander haben. Öfter in den Urlaub fahren. Wenn sie genügend Kupfermünzen sparten, könnten sie vielleicht sogar ans Meeresufer reisen. Irgendwann. Wieso nicht? Die beiden versuchten, alles von seiner positiven Seite zu betrachten.
Und dann, wie aus dem Nichts, bumm. Einfach so. Gerade als der Mann aufgegeben hatte, da fiel der Stern vom Himmel in den Bauch seiner Frau. Und dort leuchtete er sechs Wochen, bis ein Herzschlag zu hören war. In der zwölften Woche erzählten sie ihren Angehörigen und Freunden davon. In der achtzehnten Woche erfuhren sie, sie würden einen Jungen bekommen. Einen eigenen Sohn. Und der Anwalt-Schmied und die Tochter des Kerzenziehers waren überglücklich. Sie hinterfragten nicht, weshalb es jetzt passierte oder ob es etwas damit zu tun hatte, dass sie endlich aufgegeben hatten. Sie dankten dem Himmel und der Erde und dem kleinen bisschen Magie, das vielleicht doch noch in der Welt wohnte.
Die Schwangerschaft verlief nicht gerade problemlos. In manchen Nächten kam der unsichtbare Wolf auf dem Feuerwind herbeigeritten und schnappte nach dem Kind, zerrte an ihm, um es mit sich in die Berge zu schleppen. Der Wolf kam in der dreissigsten Woche. In der zweiunddreissigsten Woche kam er erneut, und die weissen Magier sorgten sich und behielten die Frau über Nacht da, nur zur Beobachtung. Nur als Vorsichtsmassnahme.
Doch das Glück war ihnen hold und sie schafften es bis zur fünfunddreissigsten Woche. Die weissen Magier hatten immer noch Befürchtungen. Sie schauten in ihre Kristallkugeln oder was auch immer. Hinter geschlossenen Türen wisperten sie miteinander. Sie nickten weise, strichen sich über die weissen Bärte, warfen dem Anwalt-Schmied betrübliche und gewichtige Blicke zu. Total unmöglich, wie diese Magier sich aufführten. Als das Kind schliesslich zur Welt kam, weinten der Mann und seine Frau Tränen der Freude und Erleichterung. Zwei Arme und zwei Beine. Zwei Augen, eine Nase und ein Mund, Farbe in den Wangen. Das Köpfchen bedeckt mit weichen, fast unsichtbaren Haarsträhnen.
Ein paar Wochen später fiel es der Frau zum ersten Mal auf.
Etwas mit dem Baby.
Anfangs schwer zu bemerken, da der Junge normal aussah. Sich normal verhielt. Ass. Schlief.
In den ersten zwei Monaten hielten der Schmied und seine Frau oft inne, schauten einander an. Als wollten sie sagen: Wir haben es geschafft.
Nach sechs Monaten schauten sie einander nicht mehr an; stattdessen musterten sie schweigend ihren Sohn. Hatten Angst, etwas zueinander zu sagen, aus Furcht, es auszusprechen. Und dadurch Wirklichkeit werden zu lassen, was sich mit jedem Tag schwerer leugnen liess. Sagten nur grundsätzlich positive Dinge, drückten vage Hoffnungen aus. Kein Grund, sich jetzt schon verrückt zu machen. Keine voreiligen Schlüsse ziehen.
Nach zwölf Monaten sagten sie nichts. Sie mussten nichts sagen.
Der Mann und seine Frau brachten den Jungen zu dem Magier, der ihm auf die Welt geholfen hatte. Zunächst weigerte sich der Alte, sie zu empfangen. Er schüttelte sanft den Kopf. Die Frau bettelte ihn an. Fiel auf die Knie und flehte. Der Anwalt-Schmied versuchte sie an den Armen nach oben zu ziehen. Doch sie rührte sich nicht. Sie kniete drei glutheisse Tage und drei eiskalte Nächte vor dem Turm des Weisen, und der Mann wich ihr nicht von der Seite.
Am Morgen des vierten Tages trat der Magier vor die Tür, wollte irgendwohin und erschrak, als er über die Tochter des Kerzenziehers stolperte, die immer noch dort wartete. Das konnte er nicht länger erdulden.
Euer Sohn, sagte er, wird niemals von dieser Welt sein.
Da vergoss die Frau von neuem bitterliche Tränen. Der Mann starrte den Magier an und fragte: Was meinen Sie damit? Was soll das heissen? Ich weiss ja, Sie sind ein Magier und deswegen drücken Sie sich so aus, aber Sie können doch nicht so was von sich geben und dann einfach nur dastehen.
Der Geist des Jungen, erklärte der weisse Magier, manche nennen es die Seele – sie sitzt fest. Als steckte sie in einer kleinen Kiste, die wiederum in einer Kiste steckt, und so fort.
Ist der Fluch daran schuld?
Kann sein. Schwer zu sagen. Womöglich hat das Kind Angst, die Welt zu betreten, oder die beharrliche dunkle Energie, die seiner Erschaffung anhaftete, verbietet es ihm.
Dunkle Energie. Bei diesem Ausdruck wurde es dem Mann kalt ums Herz. Er fürchtete sich. Er wusste es. All das hatte mit ihm zu tun. Er konnte es zwar nicht beweisen, doch er wusste, dass es seine Schuld war, konnte seiner Frau nicht mal mehr in die Augen schauen, da er Angst hatte, sie würde auf den ersten Blick Bescheid wissen.
Falls seine Frau jedoch solche Gedanken hegte, liess sie sich nichts anmerken. Sie fasste nach der Hand des Magiers und bedrängte ihn um Rat. Was konnten sie tun? Sagen Sie uns, was wir tun sollen.
Die Antwort, erwiderte der Magier, ist womöglich tief in dem Jungen versteckt. Zu tief, um sie ans Licht zu holen. Ihr werdet ihn nie kennenlernen. Doch ihr werdet euch um ihn kümmern, ihn lieben und dafür sorgen, dass er alles hat, was ein Kind braucht.
Sobald der Anwalt-Schmied diese Worte hörte, wusste er, dass sie wahr waren. Er fragte sich, was die Versicherung wohl übernehmen würde, plagte sich ob der umfangreichen Selbstbeteiligung, der schrecklich hohen Obergrenze für Zuzahlungen. Der Anwalt-Schmied sah jahrelange Therapeutenbesuche vor sich, Förderschulen, Betreuer. Keine Kindergeburtstage. Keine Spieltreffen oder Freunde. Keine Baseballspiele mit seinem Sohn.
Mit sechzehn Monaten stand der Junge einmal auf, klatschte in die Hände.
Mit zwanzig Monaten ein Wort: Ada. Ada, ada. Ada.
Dann, mit zwei Jahren, neue Wörter in schneller Folge: Mama, Baby, Dada, tut leid.

Wieso tut leid?
Vielleicht hörte er es oft.
Mit drei fragte er: Was ist das? Und: Wer ist das? Und: Wo gehen wir hin?
Mit fünf sagte der Sohn des Anwalt-Schmieds: Dad ist mein bester Freund. Das sagte er von sehr weit weg, von einem Ort tief in seinem Inneren. Der Mann konnte seinen Sohn kaum hören. Der Junge sass auf dem Boden und sah verwirrt aus, aus seinem Mund drang ein schreckliches Geräusch. Ein altes Geräusch der Schmerzen, die in ihm steckten. Der Junge schaute aus dem Fenster, wo andere Jungs vorbeirannten. Er wollte auch rennen. Doch seine Beine funktionierten nicht richtig.
Sein Vater sagte: Natürlich funktionieren sie, mein Sohn. Mit deinen Beinen ist alles in Ordnung.
Und der Sohn erwiderte: Wieso fühle ich mich dann, als ob ich festsitze?
Sein Vater sagte: Wir bekommen dich schon noch frei. Deine Beine sind doch schön, sie sind gut. Sei nicht sauer auf deine Beine. Schau mich an. Schau Mommy an. Wir kriegen das schon hin. Wir haben dir diese Beine gegeben. Tut uns leid. Tut mir leid. Es ist nicht deine Schuld. Und du wirst schon noch rennen.
Irgendwann rannte der Junge tatsächlich. Oder so etwas in der Art. Es sah komisch aus, und die anderen Jungs machten sich über ihn lustig. Also rannte der Junge nach ein paar Versuchen nicht mehr.
War alles in Ordnung? Brauchte der Mann eine Pause?
Nein, es war alles in Ordnung.
Ein Schluck Wasser vielleicht?
Nein, sagte der Mann. Mir geht’s gut.
Einmal tief durchatmen, okay?
In anderer Hinsicht lief es ziemlich gut. Es stellte sich heraus, dass der Mann ein talentierter Schmied war. Nicht übermässig talentiert. Er würde keine Schwerter für Ritter und Prinzen schmieden. Doch er hatte etwas. Und die Leute bemerkten es. Sie brachten ihm Sachen zu schmieden, und er schmiedete sie, dass die Funken nur so flogen. Er hämmerte auf dem Zeug herum, glättete es, hielt es ins Feuer, fertigte jede Menge Sachen an. Was ursprünglich als Nebenbeschäftigung begonnen hatte, wurde nun zu einer Art Heimgewerbe.
Dafür hatte er Zeit, da er seinen Job in der Kanzlei gekündigt hatte und nun als Anwalt in der Kommunalverwaltung arbeitete. Keine Boni, aber reichlich Zusatzleistungen. Und die Arbeitszeiten waren um einiges besser. Nun war der Mann fast jeden Abend zum Essen zu Hause. Gemeinsam mit Frau und Sohn bezog er ein etwas grösseres Heim, kurz hinter dem Dorfrand. Der Anwalt-Schmied war immer noch kein Ritter oder Lehnsherr, selbstverständlich nicht, doch er sorgte für seine Familie. Sie litten nie Hunger. Alles war so weit in Ordnung, doch manchmal, wenn sie zu einem Erntedankfest ins Dorf gingen, wurden sie von anderen Familien seltsam angeschaut, und sie ertrugen die Blicke nicht. Mitgefühl, gemischt mit etwas anderem. Etwas in die Richtung: Ich bewundere euch ja, aber fasst mich bloss nicht an, damit ich mir nicht die Pest oder das Unglück ins Haus hole. Mitleid, ja, ihr tut mir ja leid und ich bin in Gedanken bei euch – bei euch da drüben, bleibt bloss da drüben und kommt keinen Schritt näher. Ich bewundere euch aus der Ferne. Der Mann kannte den Blick nur zu gut. Seine Frau sagte: Sei nicht so streng. Die meinen es doch nur gut. Aber der Mann sagte: Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Oh, er kannte den Blick und konnte ihn absolut nicht ertragen. Die Vermessenheit. Die anderen Familien sagten nichts. Das war das Schlimmste daran. Ausser, sie sagten doch etwas. Und das war dann noch schlimmer: Bewundernswert. Sie müssen so stark sein, so selbstlos. Na, das war doch mal ein Märchen. Die Vorstellung, jemand könne selbstlos sein. Als unterschiede sich ihr Leben irgendwie von dem der anderen, als hätten sie keine Laster oder Bedürfnisse, als wollten sie nie mal einen trinken, oder zwei, oder zehn. Als machte ein Kind wie ihres sie zu einer verzauberten Art, einer Art übermenschlicher Märchenmenschen, die niemals gelangweilt oder müde oder geil waren. Doch der Schmied-Anwalt konnte es den Fremden nicht verdenken, so sehr ihn ihr aufrichtiges Mitgefühl auch ankotzte. Also beachtete er sie forthin nicht mehr.
Seine Beförderung zum leitenden Anwalt der Abteilung stand an. Mittlerweile war sein Sohn acht. Nein, eher zehn. Oder fünfzehn. Die Zeit verging so schnell. Der Junge hatte noch immer keine Freunde, und obwohl es den Mann jedes Mal schmerzte, wenn sein Sohn ihn fragte, woran das liege, war es ungleich schmerzhafter, als er eines Tages nicht mehr fragte. Das war inzwischen schon Jahre her. Alles war nach wie vor in Ordnung. Ihre Hütte kam ihnen zu eng vor, also kauften sie sich ein grösseres Haus. Schlechtes Timing, da der Anwalt-Schmied einen Monat später hinsichtlich der Beförderung übergangen wurde. Etwas von wegen, er habe nicht die richtige Einstellung. Über inoffizielle Kanäle im Dorf war ihm zu Ohren gekommen, dass die höheren Tiere in der Abteilung ihn alle mochten, sich jedoch nicht sicher waren, ob er der zusätzlichen Verantwortung gewachsen war. In Anbetracht seiner, na ja, Umstände. Sie wussten, dass er ein Kind hatte, das besondere Aufmerksamkeit benötigte. Vielleicht war das nur eine nette Art, das eigentliche Problem zu verschweigen. Vielleicht empfanden die anderen seine Gesellschaft als Belastung. Sie nahmen jedoch alle Anteil. Seine reizende Frau, sein behindertes Kind oder was auch immer. Niemals würden sie ihn feuern, das wusste der Mann. Er konnte dort arbeiten, solange er wollte, örtliche Lehnsgüter ins Liegenschaftskataster einpflegen. Das Reich unter niederen Feudalherren und Lehnsmännern aufteilen, Steuern für Herren veranschlagen, die weitaus reicher waren, als er es sich jemals träumen lassen könnte. Einen stetigen Kupferfluss auf seinem Konto verzeichnen. Eine gesicherte Existenz, eine Existenz für seine Familie. So gehörte es sich.
Und deswegen fügte er sich in sein Schicksal. Er war wütend auf seine Frau, obwohl sie das nie von ihm verlangt hatte. Er blieb abends lange fort, zunächst bei der Arbeit, dann nicht mehr bei der Arbeit. Seine Frau ging immer öfter zum Apotheker. Erlernte das Anrühren von Tränken. Bald hatte sie sich einen eigenen Trank zusammengestellt. Sie bezeichnete ihn als Entspannungselixier. Nur, um den Tag irgendwie zu überstehen.
Ihr Sohn wuchs immer weiter. Beziehungsweise sein Körper wuchs. Bei dem Rest wusste man es nicht so genau. Manchmal wirkte es, als wäre er eine Seele gefangen in einem Geist, der in einem Hirn gefangen war, das wiederum in einem Körper gefangen war. Ein Körper, der zu einem Männerkörper wurde, während im Inneren, gleich einer Motte ohne Sinn und Verstand, ein Kind umherflatterte. Ein Baby. Ihr Baby.
Scheisse, Mann, muss das wirklich sein? Ich weiss nicht, ob ich das schaffe.
Machen Sie weiter. Das ist gut.
Was ist gut?
Die Therapeutin sagte, er mache Riesenfortschritte. Endlich nähere der Mann sich dem Wesentlichen.
Der Mann wusste nicht, was er sonst noch erzählen sollte. Er schwitzte unter den Armen, sein Rücken tat weh, sein Arsch war auf dem durchgesessenen Therapeutensofa eingeschlafen. Er musste dringend mal pinkeln. Er war die ganze Erzählerei so was von leid.
Na gut. Er solle sich eine Pause gönnen, einen Schluck Wasser trinken und weitermachen, sobald er so weit sei.
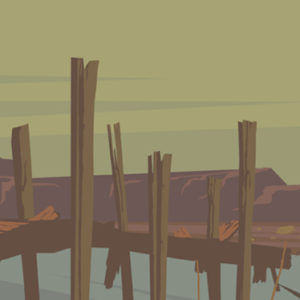
Der Mann wollte nicht weitermachen. Doch die Therapeutin schaute bedeutungsschwanger auf die Uhr, und der Mann verstand, dass seine Zeit fast um war, also machte er weiter. Es war einmal eine Therapeutin, die hatte keine Ahnung.
Der Mann wartete auf eine Reaktion, doch die Therapeutin schluckte den Köder nicht. Sie schwieg. Sie nickte, beugte sich vor und wartete darauf, dass er fortfuhr.
Es war einmal eine Therapeutin, die überhaupt nichts brachte und viel zu teuer war, und der Mann war nicht gerade Krösus. Er verdiente ganz gut, aber das hier war im Haushaltsplan eigentlich nicht vorgesehen, und ausserdem waren sie beide nicht die Typen, die zum Therapeuten rannten. Das war etwas für reiche Leute. Seine Frau war auf die Idee gekommen, seine Noch-Ehefrau, unter Umständen, und was war das überhaupt für ein Müll, ihm solche Bedingungen aufzudrücken, um seine Ehe zu retten, als hätte er das wirklich verdient, nach allem, was er getan hatte – Bedingungen. Bedingungen! Als wäre er der einzig Kaputte. Als wäre er der einzige, der möglicherweise ein bisschen zu wütend auf den Jungen geworden war, den Kindsmann, nie gewalttätig, nur ein bisschen gemein. Verdammte Scheisse, er hatte keine Ahnung, wieso er so gemein war. Er konnte nichts dagegen tun, wenn es in ihm aufstieg, wirklich nicht, das Blut, die Hitze, die ihm ins Gesicht kroch, und er spürte es genau – er würde etwas sagen, das er nicht zurücknehmen könnte, er würde genau das Gegenteil von dem sagen, was er eigentlich meinte, wo er doch nichts sehnlicher wollte, als dem Jungen über die Wange zu streichen und zu sagen…
Tut mir leid. Scheisse. Tut mir leid. Ich bin total verwirrt.
Kein Problem. Lassen Sie sich einen Moment Zeit. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.
Ich weiss nicht.
Sie wissen was nicht?
Ob ich das hier schaffe.
Trinken Sie einen Schluck.
Der Mann trank einen Schluck eiskaltes Wasser.
Es war einmal ein Mann, der war wütend und hasste die Geschichte, in der er steckte. Klar? Er war wütend, verstanden? Es war einmal ein Mann, der eine Geschichte nicht mit «Es war einmal…» anfangen durfte. Weil es nicht irgendwann einmal war. Es war jetzt. Und er war auch kein Schmied – er war einfach ein normaler Typ, der im Wald hauste. Vielleicht hatte er zu spät geheiratet, aber er hatte sich halt um seine Mutter kümmern müssen und in all den Jahren, in denen er ihren Körper beim Schrumpfen beobachtete, nie die Zeit dazu gefunden. Nur das Beste für seine Mutter. Tagsüber arbeitete er, und abends kümmerte er sich um sie, und als sie dann tot war, heiratete er. Ein bisschen später als gewöhnlich. Vielleicht zu spät. Aber er wollte seine eigene Geschichte. Eine ganz einfache. Mehr wollten er und seine Frau gar nicht, und die Frauenärztin klärte sie über das erhöhte Risiko auf, den Fluch und so weiter. Aber egal. Sie bekamen trotzdem einen Sohn. Der Mann und seine Frau und der Junge, der lachte und klatschte, aber nicht redete oder rannte. Sie waren eine Familie. Seine Familie. Seine Frau – sie war ein guter Mensch, besser als er. Sie brachte ihm bei, den Jungen zu lieben. Er liebte den Jungen über alles.
Und sie zogen noch tiefer in den Wald. Sie wollten weit weg sein von allem. Sie wollten keine anderen Leute mehr sehen. Einen neuen Wald finden, ein neues Dorf, ein neues «Es war einmal…», einen Ort, an dem sie vor Tränken und Zaubersprüchen und allem anderen in Sicherheit waren. Vor Drachen. Werwölfen. Flüchen. Einen Ort ohne Zauberei. Wo auch immer das sein mochte.
Der Mann und seine Frau bauten ein stabiles Haus, befestigten es von Hand mit Holz, Stöcken, Lehm, Steinen, mit allem, was sie finden konnten. Sie lebten vorsichtig, still, schauten einander die meiste Zeit nicht einmal an. Sie hatten die Schnauze voll davon, in einem unausgegorenen Märchen zu leben. Es reichte mit dem Blutvergiessen, es reichte mit den Tränken und Elixieren, für dieses Leben reichte es ihnen. Sie dachten, wenn sie nicht miteinander redeten, nicht versuchten, alles zu verstehen, dann würde die Geschichte einfach verschwinden. Würde nicht mehr versuchen, einen Sinn zu ergeben, würde nicht mehr versuchen, ihre gebrochenen Herzen zu brechen.

Also dachten sie nicht mehr nach. Nachts träumten sie nicht mehr. Sie schnitten die Teile aus ihren Köpfen, die fürs Träumen zuständig gewesen waren, und verfütterten sie an die wilden Tiere. Verstreuten ihr Traummaterial auf dem Boden, auf dass es zerpickt, zernagt, zerkaut würde. Aufwachen, traumlos schlafen, arbeiten. So vergingen viele Tage. Jahre.
Der Junge wuchs. Aber nicht wirklich.
Dann, eines Tages, schaute der Mann seine Frau am Frühstückstisch an. Sie steckte ihrem Sohn eine Erdbeere in den Mund. Ihr Sohn lächelte. Dumm, unwissend, ein Erwachsenengesicht mit den Augen eines Kindes. Das Lächeln eines Idioten.
Dieser Anblick war das Schönste, was der Mann jemals gesehen hatte.
Einen Augenblick lang war er glücklich.
Er ging hinaus, um Holz zu sammeln, und lief in seiner Glückseligkeit so weit weg von seinem Zuhause wie schon lange nicht mehr. Er kam zu einem Bach mit einer alten Brücke, von der nur noch verfaulte Bretter übrig waren. Und dort entdeckte er etwas Merkwürdiges.
Auf der anderen Seite der kaputten Brücke sass, ganz allein, sein Sohn.
Was machst du denn hier?, fragte der Mann. Wie bist du hierhergekommen?
Der Junge sagte, das wisse er nicht. Er begann zu jammern. Ein furchtbares Schluchzen. Ein erwachsener Mann, der wie ein Säugling heulte. Tut mir leid, sagte er, es tut mir so leid.
Schon gut, sagte der Mann. Ist ja gut. Hör auf zu weinen. Sag schon, Kleiner, was meinst du? Was tut dir leid?
Der ganze Ärger. Dass ich euer Leben verpfuscht habe.
Um Gottes willen, sagte der Mann. Nicht doch.
Eigentlich hätte sich der Mann entschuldigen müssen. Wie sollte er dem Jungen nur erklären, dass er weder stark noch gut genug war, um ihm ein Vater zu sein?
Der Junge sagte, er sässe fest, oder etwa nicht? Sässe hier drüben fest, auf der anderen Seite der Brücke. Wieder liefen ihm Tränen über das Gesicht.
Der Mann versuchte, seinen Sohn aus der Entfernung zu beruhigen. Summte ihm ein Lied vor, das er ihm als Baby vorgesummt hatte. Kurz verstummten die Schluchzer, und der Junge sagte: Dad, erzähl mir eine Geschichte.
Doch was für eine Geschichte sollte der Mann ihm erzählen? Als Geschichtenerzähler taugte er nichts. Früher hatte er es mal mit allegorischen Märchen gehabt, aber er war vom Weg abgekommen. Keine Karte, keine Legende. Er wusste nicht mehr, was wofür stehen sollte.
Er sah sich um. Er war im dunkelsten Teil des Waldes. Diese Gegend kannte er nicht. Das Haus, die Lichtung, alles war so klein, so weit weg. Die Geräusche, die aus den Bäumen drangen, jagten ihm Angst ein. Da erkannte der Mann, was er getan hatte. Er hatte versucht, die Geschichte zu ignorieren. Er und seine Frau hatten versucht, weiterzuleben, ohne miteinander zu reden oder zu lange nachzudenken. Doch die Geschichte war nicht verschwunden. Der Zahn der Zeit hatte seine Arbeit verrichtet. Während der Mann nicht hingeschaut hatte, war rings um ihn alles eingestürzt.
Er drehte sich nach dem Weg um, auf dem er gekommen war, doch der Pfad zum Haus führte ins Nichts. Ein paar Meter weiter verschwand er einfach in die Umgebung. Hinter ihm gab es keine Möglichkeit, seine Schritte zurückzuverfolgen. Vor ihm war die Brücke zu seinem Sohn, aber sie war schon längst verrottet. Wenn er sich darauf wagte, würde sie seinem Gewicht nicht standhalten. Er konnte nicht von der einen Seite auf die andere gelangen.
Stattdessen wandte er sich also von beidem ab, von zu Hause und von seinem Sohn, und rannte los. Er rannte, so schnell er konnte, rannte einfach in den unbekannten Wald. Und dann rannte seine Frau an seiner Seite. Und alle Ungeheuer, alle Bestien, alles Schreckliche, stofflich oder immateriell, alles, was den Mann und die Frau jemals gejagt oder heimgesucht hatte, alles war ihnen auf den Fersen, trieb sie vor sich her. Und allen Monstern voran lief ihr Sohn, ihr Sohn, und fragte: Wollt ihr nicht meine Eltern sein? Warum nicht? Warum nicht? Bald wussten sie nicht mehr, ob sie jemals nicht gerannt waren. Ihr Leben war eine einzige lange Hatz gewesen.
Nein, sagte der Mann, das ist nicht fair.
Und seine Frau sagte: Wir haben keine Zeit für Fairness.
Und der Mann sagte: Wieso rennen wir eigentlich? Wir sind in unserer eigenen Geschichte. Wir brauchen überhaupt nicht zu rennen.
Dann schaute er an sich hinab und erkannte, dass er kein Held war, kein Schmied noch sonst irgendetwas. Er sah zu seiner Frau und erkannte, dass sie keine Jungfrau in Nöten war, keine Tochter eines Kerzenziehers. Er kannte sie kaum noch. Doch er wusste, dass sie Rachel war. Sie war diejenige, die in Rachel steckte. Sie war die Mutter ihres Kindes. Ihres Sohnes. Er schaute zu dem Jungen. Einem inzwischen erwachsenen Mann. Immer noch ein Junge. Ein liebenswürdiger Junge, der in einem miefenden Mann festsass, und er wusste, dass er dem Jungen die Nase putzen und den Arsch abwischen würde, solange es eben nötig wäre, denn genau das tun Schmiede. Genau das tun Märchenhelden. Sie arbeiten als Anwälte in der Verwaltung. Sie kaufen ein. Sie rasieren ihren Sohn dreimal die Woche und füttern ihn mit Pudding und singen ihm ab und zu etwas vor.
Das hier war kein Traum, kein Märchen. Das hier war alles, was es gab, was es jemals geben würde.
Es war einmal ein Märchen, und irgendwann hatten die Dinge vielleicht noch zusammengepasst, eins zu eins, oder zumindest fast, aber irgendwo unterwegs hatten sie sich verdreht und verknotet, und jetzt wusste er nicht mehr, was er vor sich hatte.
Dem Mann fiel nichts mehr ein. Er hörte die Uhr ticken: tick tick tick tick tick tick tick tick tick. Er schaute seine Therapeutin an, ob er wohl schon überzogen hatte. Die Therapeutin schwieg. Der Mann begriff, dass er neues Gebiet betreten hatte. Er hatte die Grenze des Waldes erreicht. Nun gab es nichts mehr, wo er hätte hinrennen können.
Er atmete durch, merkte, dass er immer noch schwitzte. War es das, was die Therapeutin gewollt hatte? Einen Anwalt-Schmied in ihrer Praxis, der ihr Sofa vollschwitzte und langsam den Halt verlor? Konnte sie ihm helfen? Konnte sie ihm dabei helfen, wieder von der einen Seite auf die andere zu gelangen?
Die Zeit ist um, sagte sie. Nicht schlecht für den Anfang.
Den Anfang?
Ja.
Der Mann schaute seine Therapeutin an. Fragte sich, ob das ihr Ernst war.
Seine Mittagspause war vorbei. Der Mann stand auf. Auf dem Weg nach draussen sagte er: Bis nächste Woche, und die Therapeutin sagte: Vielleicht. Er drehte sich zu ihr um. Sie sagte: Erst mal abwarten, wie es jetzt mit Ihnen weitergeht.
Der Mann ging den Flur hinab, erleichterte sich, wusch sich die Hände, spritzte sich Wasser ins Gesicht. Als er wieder auf den Flur trat, bemerkte er etwas. Das sah ja aus wie – Quatsch, niemals. Er bildete sich bloss etwas ein. Aber. War das etwa möglich?
Ein schwacher Umriss auf dem Teppichboden.
Ein Pfad.
Wohin führte er? War es ein Ausweg? Oder ein Eingang?
Und der Mann sagte sich: Na gut. Vielleicht hat sie recht. Wenn deine Geschichte hier anfängt, dann soll es eben so sein.
Charles Yu
ist amerikanischer Schriftsteller. Von ihm zuletzt erschienen: «Sorry Please Thank You: Stories» (Pantheon Books, 2012) und «Handbuch für Zeitreisende» (Rowohlt, 2012). Aktuell ist er einer der Schreiber der erfolgreichen HBO-Serie «Westworld» und lebt mit seiner Familie in Santa Monica, Kalifornien.
Anna-Christin Kramer
ist literarische Übersetzerin und lebt in Annapolis in den USA.
Johan Keslassy
ist Illustrator und lebt in Rouen, Frankreich.











