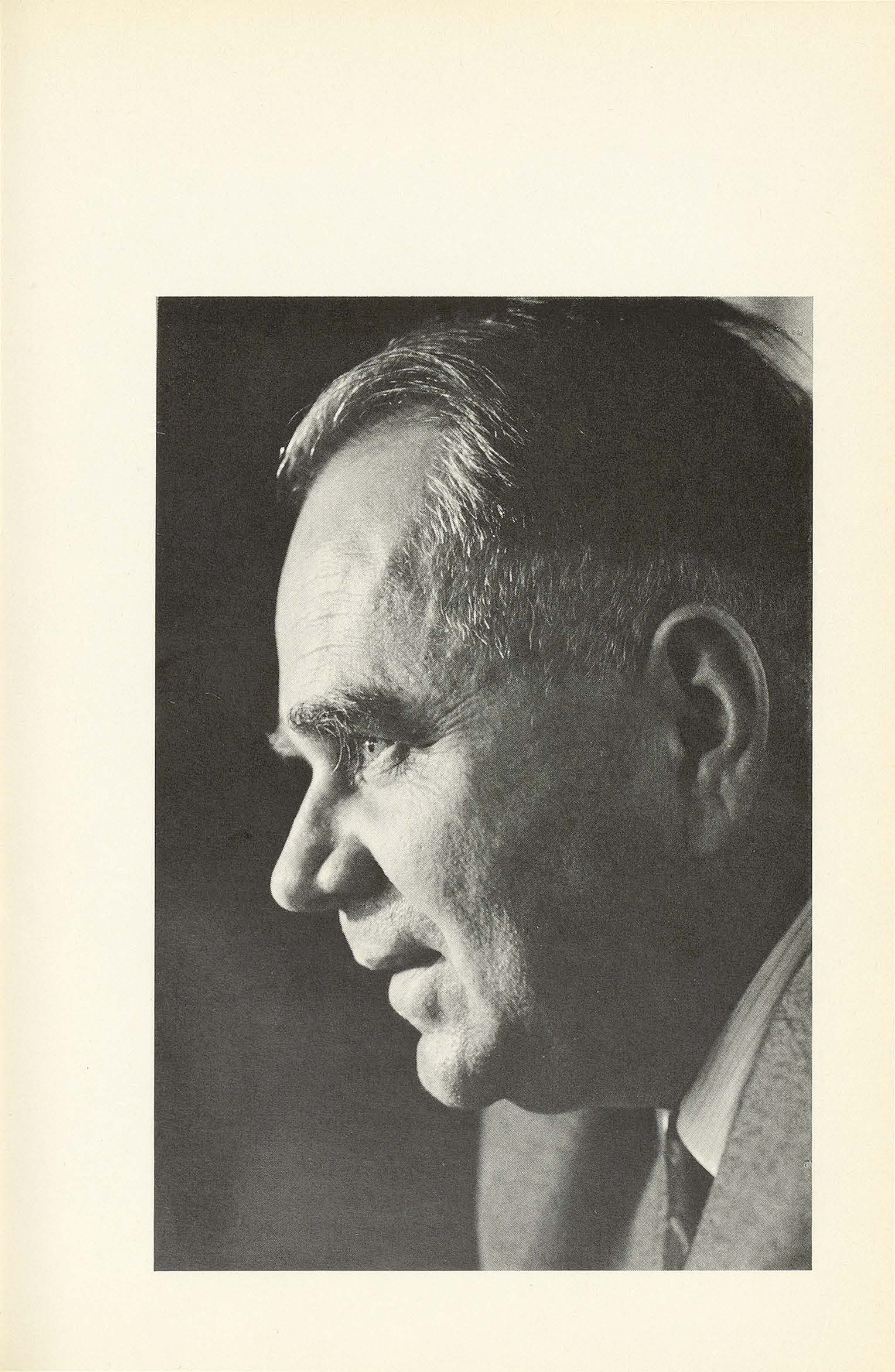Produktiver zweifeln
Untergang vertagt: Der Austritt der Briten wird nicht zur «Jetzt endlich – und erst recht»-Verbundesstaatlichung der EU führen. Viel wahrscheinlicher ist ein Europa der variablen Geometrie. Das Schönste: Der Weg dorthin ist bereits ausgehandelt.
Ist Ihnen schon einmal die Europakarte der Nachrichten des Zweiten Deutschen Fernsehens aufgefallen? Da ragt ein Grossteil des Kontinents heller und höher heraus als der Rest; die Schweiz erscheint als tiefer dunkler Binnensee; auch Norwegen fällt deutlich ab; die Türkei (und mit ihr Zypern) verblasst gegenüber Griechenland, leuchtet aber wie Russland immerhin noch deutlich heller als der Balkan.
Nach dem Brexit müsste man in Mainz auch Grossbritannien dunkelblau einfärben. Dabei brauchten wir doch gerade jetzt angesichts all der Krisen «mehr Europa!», heisst es. «Europa» kann dabei alles Mögliche heissen: schon die Europa, der das Europa seinen Namen verdankt, war geographisch, wie u.a. Adolf Muschg eingangs eines Essays mit dem Titel «Was ist europäisch?»1 notiert, gar keine Europäerin, weil sie aus dem heutigen Gaza-Streifen stammte. Europas geographische Grenzen sind willkürlich; seine kulturellen Wurzeln sind unübersichtlich; seine politischen Geschichten waren oft genug mörderisch. Und dennoch blühten auf dem europäischen Halbkontinent Freiheit, Kultur und Recht im andauernden Wettbewerb insgesamt prächtiger als sonst wo: teils früher, meist dauerhafter und einst vielfältiger.
Hört mir auf mit den Narrativen!
Von mir aus also her mit diesem «mehr Europa» – solange damit kein makroökonomisch-geopolitischer Kontinentalkollektivismus gemeint ist, der mit Blick auf aggregierte Zahlen von Sozialprodukt, Bevölkerung oder Sprengköpfen auf anderen Kontinenten nun schlicht «mehr EU» fordert. Die Schweizer, laut Muschg «ohne Einbildung und vor allem ohne Illusionen» europäisch, wissen, dass man nicht als Nation in diesem Sinne gross sein muss, um frei und wohlhabend zu sein. Und die Briten wissen, dass «mehr Europa» nicht etwa «weniger Afrika, Asien oder USA» heisst oder heissen sollte. Beide wissen, dass Europa nicht mit der Europäischen Union identisch ist.
«Neue wie alte Probleme haben Europa und die EU genug.»
Europäische «Identität» und «Finalität» sind die am häufigsten genutzten und am wenigsten ergiebigen Schlüsselbegriffe in intellektuellen Elitediskursen und politischen Sonntagsreden zur Zukunft Europas. Beide gipfeln zwangsläufig in der Forderung nach einem neuen europäischen «Narrativ». Ich kann es nicht mehr hören. Fast täglich laden EU-finanzierte Netzwerke, Bewegungen, Initiativen zu «Events» ein, bei denen dieses Narrativ debattiert oder künstlerisch-kreativ dargestellt werden soll. Neulich ging ich hin, weil Joschka Fischer da war. Hat mir gefallen. Fischer sagte (sinngemäss): «Hört mir bitte mit diesem europäischen Narrativ auf. Narrativ heisst heute: den Leuten fällt nichts Konkretes mehr ein. Wir müssen jetzt neue Probleme lösen und nicht neue Geschichten erzählen.»
Stimmt: neue wie alte Probleme haben Europa und die EU genug. Weniger zu den neuen Problemen als zur neu erhärteten Nebenbedingung gehört, dass darauf zu verzichten ist, irgendeine «europäische Identität» und «Finalität» vorauszusetzen oder zu erzwingen. Jürgen Habermasʼ Hoffnung auf einen «europäischen Verfassungspatriotismus»2 als Identitätssurrogat können wir nach den Erfahrungen der Euro-Rettungsjahre getrost im Starnberger See versenken. Auch das «wir» gegen «die anderen» hat schon mal besser funktioniert. Wie Adolf Muschg 2005 ahnte: «George W. Bush wird als Identitätsstifter ja nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen.» Die EU hat nun genug eigene Bushs oder Trumps im Europäischen Rat. Was die Finalität des «europäischen» (soll heissen: EG-/EWG-/EU-) Projekts betrifft, sollte man auch die, durchaus unter Anstimmen verdienter Lobgesänge auf schon Erreichtes, vorerst versenken. Wie Oliver Zimmer jüngst in der «NZZ»3 festgestellt hat, gab es bisher so etwas wie einen «geschichtsphilosophischen Kern des europäischen Projekts», nämlich «zum einen den universellen Anspruch» und den «säkularen Erlösungsdiskurs, zum anderen – und in der Praxis wohl noch wichtiger – die Annahme eines gerichteten Entwicklungsprozesses».
Nur die zwei alten europäischen Demokratien England und die Schweiz seien in diesem Sinne «geschichtsphilosophisch taub», so Zimmer. Das mag sein: sowohl das United Kingdom als auch die Confoederatio Helveticae könnten aus eigener Erfahrung gelernt haben, dass es schon schwer genug ist, sich selbst als «Einheit in Vielfalt» zu finden. Einem Auftrag der immer engeren Union der Völker Europas, der von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Gerichtshof stets zugunsten eigener Kompetenz und mit rechtlichem Vorrang selbst gegenüber nationalem Verfassungsrecht ausgelegt und ausgenutzt wird4, müssen solche Länder mit Misstrauen begegnen.
Vom Gleichen reden, etwas Anderes meinen
Aber auch ohne Briten und Schweizer gewinnt eine «Finalität» oder «Identität» der EU der 27 nun nicht plötzlich neue Konturen. Der grosse Sprung nach vorn in eine politische Union wird auch ohne die Bremser aus London nicht gelingen. Zwar redet man in Berlin und Paris immer noch viel und gerne davon. Man meint damit aber Grundverschiedenes. In Paris meint man: Vergemeinschaftung der Schulden der Eurozone, noch mehr Bailout durch die EZB, gemeinsame EU-Steuern, gemeinsames Budget der Eurozone, gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung, gemeinsame Einlagensicherung und mehr europäische Industriepolitik, konkret: Subventionen für europäische (französische) Champions, Hilfen und Protektion für (französische) «Verlierer» der Globalisierung.
In Deutschland fordert zumindest Wolfgang Schäuble auch eine «Fiskalunion», meint damit aber etwas ganz Anderes. Diese politische Union soll weitgehend entpolitisiert werden; verbindliche Regeln (etwa des «Fiskalpakts») sollen durch möglichst automatische Sanktionen oder mit Hilfe unabhängiger Organe durchgesetzt werden.
Die Vorschläge aus Paris und Berlin sind jeweils klarer und radikaler als das, worauf sich die fünf (!) Präsidenten der EU bisher einigen konnten.5 Sie entsprechen stärker der Vision eines europäischen Bundesstaats, wenn auch eines jeweils sehr unterschiedlichen: eines diskretionär-interventionistischen oder eines regelgebunden-ordnungspolitischen.
Beide Vorschläge würden Vertragsveränderungen erfordern. Eine Zustimmung aller 28 (oder bald 27) Mitgliedstaaten zum einen oder anderen Modell ist illusorisch. Jede Variante einer politischen Union verlangt schliesslich demokratische Legitimation nicht nur der Vertragsänderung selbst, sondern auch des Vollzugs einer Verlagerung zentraler Elemente bisher nationalstaatlicher Ausübung von Souveränität.
Wenn Schulden, Steuern, Arbeitslosenversicherungen oder Spareinlagen «vergemeinschaftet» werden sollen, gilt verfassungsrechtlich wie demokratietheoretisch die Losung der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung: «No taxation without representation». Das EU-Parlament ist hierauf keine Antwort, denn es fehlt ein weiteres zentrales demokratisch-rechtsstaatliches Prinzip: «One man, one vote». Die Stimme eines Maltesers hat bei Europawahlen über elfmal mehr Gewicht als die einer Deutschen. Im Unterhaus eines «echten» Bundesstaats, der eigene Steuergelder umverteilte und am Ende auch Kompetenz beanspruchte, wäre dies nicht mehr haltbar.
Gerade demokratisch-egalitaristisch gesinnte EU-Föderalisten sind deshalb in einiger Verlegenheit. Sie müssen eine paneuropäische Öffentlichkeit, Identität und Solidarität und damit entgegen empirischer Evidenz die Entstehung eines funktionierenden paneuropäischen Parteiensystems imaginieren oder simulieren. Einfach schon einmal mit «politischer Union» als europäischer Wirtschaftsregierung zu beginnen – in der Hoffnung, dass ein europäischer Demos einem elitär vorauseilenden Quasi-Bundesstaat schon eines Tages folgen wird –, würde die europäische Einigung eher beschädigen denn fördern.
Ausgeträumt
Aber damit ist kaum wirklich zu rechnen. Der Traum der Vereinigten Staaten von Europa ist vorerst ausgeträumt – auch «dank» des Drucks der parteipolitisch wirksamen Nationalromantik, die plötzlich sich wieder in ganz Europa zeigt. Diese populistischen Kräfte von rechts und links sind indes arg falsche Freunde der liberalen Gegner eines europäischen Superstaats. Sie könnten ihrerseits den Albtraum eines Rückfalls in Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Protektionismus fördern.6 Überhaupt: rechts oder links ist in Europa kein sinnvoller politischer Kompass mehr. Am sich zunehmend gleichenden rechten und linken Rand nehmen die Gegner von Freisinn, Freihandel und Freizügigkeit zu. Das hat sich auch in Grossbritannien gezeigt. Zwar gab es auch optimistisch-liberale Gründe für einen Brexit, aber am Ende gaben Gegner der Offenheit den Ausschlag. So kommt es, dass weder die Regierung in London noch die Kämpfer für den Brexit einen Plan B haben. Wahrscheinlich hätte eine Abstimmung zur Frage «Soll Grossbritannien Mitglied der EU bleiben oder den Status eines Mitglieds des Europäischen Währungsraums anstreben?» keine Mehrheit für «leave» ergeben, weil man den Verlust an Souveränität («regulation without representation») bemerkt hätte. Die Frage «Soll Grossbritannien Mitglied der EU bleiben oder auf den Status eines WTO-Drittlandes zurückfallen?» hätte sicher auch keine Mehrheit für den Austritt ergeben – weil die ökonomischen Nachteile sofort deutlich geworden wären. Genau deshalb hat sich das «leave»-Lager auch nie auf ein Modell festlegen wollen.
«Der Traum der Vereinigten Staaten von Europa ist vorerst ausgeträumt.»
Selbstverständlich brauchen auch die Kontinentaleuropäer Zeit, herauszufinden, wie sie dem Misstrauensvotum gegenüber der EU begegnen können. Es sollte sich nicht das wiederholen, was 2005 nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden geschah, als jeweils das Projekt der europäischen «Verfassung» vom Volk abgelehnt wurde. Damals wie heute wurde eine «Reflexionsphase» ausgerufen; man wolle die Sorgen der Bürger ernst nehmen; ein «Plan D» (für mehr Demokratie) wurde gefordert. Am Ende kehrte man zu Plan A zurück. Die Verfassung wurde schlicht umbenannt in «Vertrag von Lissabon». Franzosen und Niederländer wurden nicht noch einmal gefragt.
Viele wollen nun an den Briten ein Exempel statuieren, um anderen zu zeigen, dass ein Leben nach dem Austritt nur Nachteile mit sich bringt. Geht dies auf Kosten des freien Handels, Kapital- und Personenverkehrs, nimmt man freilich gegenseitige Selbstschädigung in Kauf. Statt auf Abschreckung zu setzen, kann man indes auch die Attraktivität der EU steigern, um so weitere Exits unwahrscheinlicher zu machen. Wie kann das gelingen?
Attraktivität der EU steigern
Konkret sollte die EU die Zeit nutzen, «Plan C» (C für Cameron) zu verwirklichen und die im Februar mit David Cameron ausgehandelten Reformen trotz des Brexits umzusetzen. Der damalige Ratsbeschluss ist zwar rechtlich nun hinfällig, da er nur im Fall eines «positiven» Referendums in Kraft getreten wäre; auch hätte er in Teilen nur für Grossbritannien gegolten – aber politisch hätte er das Zeug, einiges an Unbehagen mit der EU in vielen anderen Mitgliedstaaten zumindest zu mildern. Folgendes wurde damals einvernehmlich feststellt:
Flexible Integration: Die Bezugnahme in den EU-Verträgen auf den Prozess einer immer engeren Union sei vereinbar mit «verschiedenen Wegen der Integration für verschiedene Mitgliedstaaten». Das ist durchaus ein Bekenntnis, dass «one-size-fits-all» nicht das Grundprinzip der EU sein muss und eine flexible Geometrie der Integration der Willigen und Fähigen ein durchaus vertragskonformes Modell ist. Das könnte in vielen EU-skeptischen Ländern die Angst vor gleichmacherischer Bevormundung aus Brüssel zumindest mildern.
Subsidiarität und Demokratie: Nationale Parlamente können mit einer verbindlichen Subsidiaritätsrüge («rote Karte») aus ihrer Sicht übergreifende Rechtsakte verhindern. Das könnte helfen, dem Vorwurf der Bürgerferne und des Demokratiemangels zu begegnen.
Freizügigkeit und Sozialsysteme: Der Zugang von EU-Ausländern zu bestimmten Sozialleistungen kann für eine Anfangszeit von einigen Jahren beschränkt werden. Wenn die Angst vor der Migration in die Sozialsysteme (statt in den Arbeitsmarkt) ein bedeutender Grund ist, der EU den Rücken kehren zu wollen, sollte man sich dieses Kapitel noch einmal genau ansehen und allgemeingültige, faire Regeln vereinbaren.
Fairness zwischen Euro- und Nichteuroländern: Weitere Schritte zur Vertiefung dürfen weder zu einer Diskriminierung der Nichteurostaaten führen, noch haften diese für Rettungsschirme der Eurozone. Daran sollte man festhalten, um nicht in Ländern wie Tschechien, Dänemark, Polen oder Ungarn den EU-Kritikern Munition zu liefern. Es ist kein schlauer Plan, wenn man dem Euro nur entgehen kann, indem man aus der EU austritt.
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit: Hier ist noch Platz für «mehr Europa». Der offene Binnenmarkt für Dienstleistungen ist noch längst nicht «vollendet»; der für Energie, Digitales wird gerade erst angedacht, ebenso wie eine echte Kapitalmarktunion. Und schliesslich: die EU ist extrem schwerfällig, Freihandelsabkommen abzuschliessen (TTIP, CETA). Das sind ausschliessliche Kernkompetenzen der EU. Wenn sie hier nicht liefert, ist sie geliefert.
Die EU könnte also ironischerweise jetzt, nachdem der Cameron-Deal geplatzt ist, diesen in weiten Teilen als Reformagenda für eine EU ohne Grossbritannien umsetzen. Schliesslich war es ja genau das Ziel dieser Beschlüsse, die Desintegration der EU zu verhindern. Zugegeben: im Fall der Briten hat das nicht gereicht. Aber jetzt noch weit hinter diese Reformen für mehr Flexibilität, Subsidiarität, Fairness und Wettbewerbsfähigkeit zurückzufallen, wäre töricht.
Conclusio
Der Austritt der Briten soll, darf und wird auch nicht zur «Jetzt endlich – und erst recht»-Verbundesstaatlichung der EU führen, sondern langfristig zu einem Europa der variablen Geometrie. Gemeint ist damit ein nach Politikbereichen, nicht nach Ländern strukturiertes Europa der unterschiedlichen «Kreise» oder Integrationsschritte der Willigen und Fähigen. Das wäre meine langfristige Erwartung an die Zukunft Europas: flexible Integration, die auch einen Platz für die Schweiz, Grossbritannien und andere Europäer bietet, ohne die «Alles-oder-nichts»- und «Alles-muss-allen-passen»-Besessenheit (Aquis communautaire). Ein Europa der – wenn auch nicht «optimal» dimensionierten – Clubs ist teilweise schon Realität (Schengen, Euro, EWR, Zollunion, EU-Patent, Bologna…) und wird nun wieder verstärkt diskutiert – hierüber wäre zu reden.7
Und dies ganz im Sinne auch von Adolf Muschg: «Dieser produktive Zweifel ist der redlichste, in seiner Humanität zuverlässigste Begleiter der europäischen Geschichte gewesen. Ich meine, die Einigung Europas sei eine neue, eine wahrhaft historische Gelegenheit, ihn konstruktiv und nachhaltig auf sich selbst anzuwenden.»8
Das meine ich auch. Mein Name ist Wohlgemuth; ich bin skeptischer Optimist. Utopische Narrative gehen mir ebenso gegen den Strich wie apokalyptische Prophezeiungen. Der grosse Sprung nach vorn in den europäischen Zentralstaat scheint mir ebenso unwahrscheinlich wie der grosse Rückfall in europäische Nationalstaaterei. Und das ist jeweils auch gut so.
Adolf Muschg: Was ist europäisch? München: C.H. Beck, 2005. ↩
Vgl. David Abulafia: Europa neu denken. In: Schweizer Monat, Nr. 1039, September 2016, S. 40 – 45. ↩
Oliver Zimmer: Geschichtsphilosophisch taub. In: NZZ vom 25.7.2016. ↩
Dieter Grimm: Europa ja – aber welches? Zur Verfassung der europäischen Demokratie. München: C.H. Beck, 2016. ↩
Jean-Claude Juncker u.a.: Die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden. ↩
Vgl. Deirdre McCloskey: Auf die harte Tour? S. 74. ↩
Clara Brandi und Michael Wohlgemuth: «Europe à la carte? A club-theoretical vindication». In: Johannes Varwick und Kai Olaf Lang (Hrsg.): European Neighbourhood Policy. Leverkusen: Budrich, 2007, S. 159 – 180. Aktuelle Beiträge: Hubertus Porschen und Johanna Strunz (Hrsg.): Statt Brexit: #EUpgrade. Berlin: Die Familienunternehmer, 2016; Jean Pisany-Ferry u.a.: Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership. ↩
Muschg, S. 64. ↩