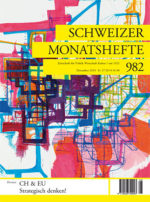Jamaikas letzter Löwe
Kurzgeschichte von Marlon James. Übersetzt von Anke Caroline Burger. Mit Illustrationen von Wojtek Klimek.

Che Guevara, auf der Titelseite der Abendzeitung, aufgedunsen, oben ohne, tot. Mehrere Männer umstanden ihn, alle in Uniform, keiner davon tot, keiner wirklich ein Mann, allesamt Jungs mit Maschinengewehren, die sie wie einen Phallus hochhielten. Keiner der Jungs auf dem Foto konnte beweisen, dass er den entscheidenden Schuss abgefeuert hatte, aber alle behaupteten es. Andere waren nicht auf dem Foto, auch nicht in der Kaserne, noch nicht mal in der Gegend, behaupteten es aber trotzdem. Che, mit Hose, aber ohne Stiefel, Schlafzimmerblick in den halboffenen Augen, den Mund zu einem kleinen, schiefen Lächeln verzogen, wirkte nicht tot, sondern wie gerade aus süssem Schlummer erwacht. Daneben fand sich eine andere Schlagzeile: Kein Lebenszeichen vom Jungen, der zuletzt auf der Aloysius Dawkins Street gesehen wurde.
«Haben sie ihn gekriegt, diese Schlangen, was, Mister Minister? Schwarzherzige Schlangen.»
Morrison bekleidete seit fast sieben Jahren kein öffentliches Amt mehr, aber sein Hausmädchen Clemencia nannte ihn immer noch «Mister Minister». Jahre hatte es gedauert, bis er den Verdacht losgeworden war, in ihrer Stimme könnte ein Anflug von Ironie liegen; mittlerweile ging er davon aus, dass sie ihm wirklich unterwürfig ergeben war. Dafür hatte er sie sogar geehelicht, aber sie diente ihm weiterhin als Hausmädchen und nannte ihn immer noch Mister Minister. Er nannte sie Missus Minister, halb aus Zuneigung, halb im Spott, aber Zuneigung und Spott waren zwei Dinge, die an seiner Frau einfach vorbeirauschten. Die ideale Gattin für jemanden wie Morrison.
Er betrachtete Clemencia über seinen langen Nasenrücken hinweg. Sie war mit einem Flederwisch auf der Veranda zugange und wirbelte den Staub auf, statt ihn wegzuwedeln. Die Veranda war auf allen Seiten mit glaslosen Holzjalousien umschlossen, durch die ein eisiger Wind hereindrang. Manchmal ärgerten ihn auch die Moskitos. Clemencia wollte die Lamellen schliessen, aber er hatte dagegen protestiert, mit seinem üblichen Spruch, er warte auf den Abend, den einzigen Besucher, der ihn nie versetzte. Hinter ihm war eine graue Wand, die in der Mitte von einer dunklen, zur Küche führenden Fluröffnung durchbrochen wurde. In diesem Land gilt das Fenster mehr als der Spiegel, hörte er eine Stimme sagen, aber er schüttelte sie ab.
«Hör auf, mir Eselsmist in die Ohren zu schmieren, du alte Krähe», gab er grantig zum Besten.
Ohne Veränderung in Gesten oder Gesichtsausdruck wedelte Clemencia weiter Staub. Er fragte sich, ob sie ihm etwas vorspielte, ob sie vielleicht nur zu gut wusste, dass er sie von oben herab behandelte. Womöglich schmiedete sie ja schon süsse Rachepläne, jeden Abend eine kleine Prise Arsen im Tee vielleicht? Es musste sich um Verfolgungswahn handeln, redete er sich gut zu, eine so unerfreuliche wie unvermeidliche Alterserscheinung. Er war fünfundsiebzig Jahre alt und kinderlos.
1965 wurde Morrison zum ersten Premierminister des Landes gewählt. Er war ein schlaksiger, viel zu gross geratener Weisser mit wild wuchernden Koteletten, die direkt dem vorherigen Jahrhundert entsprossen zu sein schienen. Das dünne Haupthaar war schon mit dreissig weiss und hätte ihm Würde verliehen, wäre er kein so notorisches Schandmaul gewesen. Er kam als Weisser in einem Dorf im Norden zur Welt und wuchs in Armut auf. Doch schon mit fünfzehn arbeitete er sich innerhalb weniger Jahre zum Pferdeexperten und Besitzer eines eigenen Fohlens hoch.
Morrison hatte eine Gabe dafür, aus Heu Gold zu dreschen, die seine Mitmenschen immer wieder erstaunte. Er, ein gerissenes Schlitzohr, das seine niedrige Herkunft zum eigenen Vorteil nutzte, manipulierte seine wohlhabenderen Cousins, damit sie Mitleid mit ihm hatten. Er übertrumpfte wohlgeborene Herren im Poker und beim Pferderennen, machte sich bei den reichen Weissen lieb Kind und trieb es mit den missratenen Töchtern der Oberschicht – den Frauen, die keine Lust mehr auf Weisse hatten, sich aber nie mit Schwarzen abgeben würden. Sein reicher Onkel in der Stadt nahm ihn mit siebzehn bei sich auf, um ihm Manieren und ordentliches Benehmen beizubringen. Hängen blieb bei Morrison allerdings nur, wie man den Unterschied erkannte zwischen den Frauen, die es mit einem treiben würden, und denen, die nicht.
Morrison war gross und weiss, und die Menschen sahen zu ihm auf, bewunderten ihn in Denken und Verhalten. Ausserdem liebte er die Menschen aufrichtig, besonders die Schwarzen. Die schwarzen Frauen, um ganz genau zu sein. Drei Skandale konnte er dank seiner Spezialmixtur umgehen, die ihm von einer Obeahfrau an der Nordwestküste anvertraut worden war, mit der «das Problem ein für alle Mal gelöst wurde», wie er sagte. Das einfache Patentrezept – mit Pfeffer bestreute Stücke grüner Papaya – wurde den Negermädchen, die andere Pläne hatten, mit Gewalt eingetrichtert und führte zum Abgang selbst der hartnäckigsten Föten. Wenn er an damals dachte, zwickte es ihn in den Lenden, ein Gefühl, das er zwar willkommen hiess, dem er aber nicht traute. Es war wie das Phantomjucken eines amputierten Beins – er erinnerte sich, dass seine Mutter ihn immer gebeten hatte, sie an ihrem fehlenden Bein zu kratzen. Seine eigenen Beine waren nicht zu gebrauchen. Stehen konnte Morrison, aber Diabetes und Sünden hatten ihn eingeholt und er konnte kaum laufen. In der Hinsicht glich er endlich seinem grossen Vorbild, Franklin Delano Roosevelt.
In nur drei Tagen sollte eine grosse Feierlichkeit stattfinden. Seine Feinde veranstalteten die wichtigste, grossartigste und kostspieligste Zeremonie des Jahres für ihn, so wichtig war er. In drei Tagen würde Maximilian Morrison die höchste Würde des Landes verliehen werden. Er würde zum Nationalhelden geschlagen werden, zum Most Honorable, Right Excellent, National Hero.
Doch kein Wort davon in der Zeitung. 1967. Immer war sie gegen ihn gewesen, die Presse. Die Zeitungsleute hassten seine direkten Worte, seine brüske Art, seinen fehlenden Universitätsabschluss. Sie nahmen es ihm übel, dass er «Silas Marner» nicht gelesen, sich nicht in der Beamtenschaft allmählich hochgearbeitet hatte, nicht einmal auf die Munro Boys’ School gegangen war. Sie fanden es unziemlich, wie er die Queen bei ihrem letzten Besuch auf gar nicht majestätische Art und Weise zum Lachen gebracht hatte. Sie hassten es, dass er immer rote Erde unter den Fingernägeln zu haben schien. «Was für ein Schlingel, der Premierminister», soll die Queen angeblich gesagt haben, als sie sich schmunzelnd die Hand vor den Mund hielt.
Viele Männer entscheiden sich, Angst und Schrecken zu verbreiten, wenn sie nicht geliebt werden. Maximilian schaffte es allein kraft seines bösen Willens an die Führungsspitze der Partei. Manchmal, für gewöhnlich kurz vor den Wahlen, kamen irgendwelche totgeglaubten Gerüchte wieder hoch wie alter Staub. Gerüchte, wie seine beiden Rivalen im kurzen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren viel zu früh zu Tode gekommen waren, der eine in einem Feuer, bei dem sein Leichnam so fürchterlich entstellt wurde, dass eine Identifizierung praktisch unmöglich war, der andere durch einen schlafwandelnden Sprung vom Balkon, ohne je zuvor an Somnabulismus gelitten zu haben.
Oft hörte Maximilian ein marodierendes Geflüster. Dann lauschte er auf Glockengeklingel hinter sich, den eiligen Wind durch die Fensterlamellen oder Gesprächsfetzen aus dem Haus nebenan und dachte, sie seien zurückgekommen, um ihn zu warnen, ein Jacob Marley für ihn, den Scrooge – die Stunde der Abrechnung sei da. Es wäre nicht das erste Mal. Erst vor drei Nächten hatten sie ihm gesagt, er solle mit ihrer Rückkehr am Mittwoch rechnen. Heute.
Aber er war so weit.
Maximilian Morrison betrachtete sich. Seine Hände und Füsse waren mit roten Flecken übersät, die wie kleine Inseln aussahen. Nun ward der Winter unseres Missvergnügens, rezitierte eine Stimme, die er nicht kannte, aus einem Buch, das er nie gelesen hatte. Lesen war etwas für eine ganz gewisse Sorte Jamaikaner, solche, die mit anderen Jamaikanern derselben Sorte auf manikürten Rasenflächen standen und über die Probleme des Landes diskutierten. Redenschwingern hatte Maximilian nie getraut. Er war ein Mann fürs Praktische. Er löste Probleme, wusste, was die Leute wollten, half ihnen auf den richtigen Pfad; das hatte er seiner Herkunft zu verdanken: Die privilegierte Hautfarbe, aber ohne den dazu passenden Wohlstand.
«Ich sagte: Möchten Sie was zu essen?», rief Clemencia aus dem hohlen Korridor.
«Und wer kocht, du?», erwiderte Maximilian.
«Na, wer wohl sonst, Mister Minister?»
«Weiss ich doch nicht. Ich hatte an Hungertod gedacht, nach den vielen Kutteln, die ich in letzter Zeit von dir vorgesetzt kriege.»
«Von mir aus», gab sie zurück.

Da, sie tat es schon wieder. Er erkannte den genialen Schachzug des Weibsstücks erst, wenn es schon zu spät war. Sie liess den Streitsüchtigen am Rand einer Schimpfkanonade hängen und behandelte ihn einfach wie Luft, dabei wartete er nur auf den entscheidenden Funken, damit sein Mundwerk explodieren konnte. Jetzt musste er Gift und Galle wieder herunterschlucken. Vielleicht wurde sie doch noch gewitzt auf ihre alten Tage, eine Art weise Torheit, die dem Verstand überlegen war. Er hatte sie wieder einmal unterschätzt.
Maximilian langweilte sich. Seine Nachbarn waren Männer ohne Haare auf oder Grips im Kopf und Frauen, die bis zum Knie hochgerollte Seidenstrümpfe trugen; alle schienen sie ihren Frieden gefunden zu haben, in dem Langeweile die letzte Leiterstufe vor dem Himmel darstellte. Nicht so Maximilian. Er verfluchte sein Schicksal, dass er einen klaren Geist, aber einen kaputten Körper hatte.
Auf dem Tisch lagen Käfer und Schmetterlinge, allesamt tot, doch auf den Flügeln glomm noch das Licht. Eigentlich hatte er eine Sammlung anlegen wollen, die Stecknadeln besass er bereits, aber er hatte nie richtig damit angefangen.
Der Abend stand vor der Tür. Die beiden Männer hatten gesagt: in drei Tagen. Maximilian beruhigte sich damit, dass er auf den gefürchteten Besuch vorbereitet war. Und falls sie ihn mit in die Hölle nehmen wollten, tja, dann würden sie halt einfach warten müssen. Nicht einmal der Teufel würde ihn holen können, bevor er zum Nationalhelden erklärt wurde. Die Ehrung würde die grosse Schieflage seines Lebens ins Lot rücken, damit sich ein Leben ohne Kinder gelohnt hatte. Nicht, dass er je Kinder gewollt hätte. Aber die Männer in dem Traum, oder in der Vision, hatten ihn vor dem Besuch heute gewarnt. Vielleicht war es ja gar keine Warnung, sondern ein Versprechen.
Seiner Frau erzählte Maximilian nichts von dem Traum. Der Schlaf war ihm immer ein unsicherer Genosse gewesen, auch als er noch jünger war. Im Traum reiste er an neue Gestade und zu dunklen Frauen, aber zugleich hörte er das Bellen eines Hundes im Nachbargarten oder das Brummen entfernter Lastwagen oder den gedämpften Ruf einer Frau, ob er wach sei.
Insofern wusste er nicht mehr, ob er schlief oder wach war, als Aloysius Dawkins und Teddy James ihm sagten, er solle sich auf einen Besuch vorbereiten. Ein Wust von Worten war es gewesen, und er hätte auf Teufel komm raus nicht mehr sagen können, ob er diese gehört oder nur gespürt hatte, aber neben ihm schnarchte seine Frau, auch wenn er sich nicht zu ihr umgedreht hatte, um sich zu vergewissern. Maximilian erinnerte sich an die Umrisse der Männer, aber nicht mehr daran, ob er ihre Gesichter im Dunkel gesehen hatte oder nicht. Auch nicht mehr, welcher zuerst gesprochen hatte und wie seine Stimme klang. Sie waren schon so lange tot, dass er ihre Stimmen vergessen hatte, und wie sie nach vier Bier aus dem Mund rochen. Am Mittwoch sind wir wieder da, hatte einer oder hatten beide gesagt. Heute.
Maximilian sah zu, wie der Abend das grüne Gras silbern färbte. Bald war es Nacht, dann Mitternacht, dann wieder Tag, und seine Befürchtungen würden sich auflösen wie der Frühnebel. Er hatte gedacht, dass ein Mann zu alt für die Angst werden könnte, aber dem war nicht so.
«Was hast du gesagt?», fragte er seine Frau. Sie gab keine Antwort.
Wieder warf er einen Blick auf die Zeitung, auf Che, der ihn anlachte. War das wirklich Che oder jemand, der für ihn ausgegeben wurde, ein armer Schweinehund, der zur falschen Zeit am falschen Ort war und nun nichts mehr vorzuweisen hatte als ein blutiges Loch im Körper? War der echte Che vielleicht entkommen, wie so viele Male zuvor? War er nicht sowieso schon tot gewesen? Lebte er noch? Wo war er? Hatte er die Revolution letzten Endes doch noch betrogen und sich nach Amerika abgesetzt, wo er die schönsten weissen Damen der Gesellschaft mit seiner Liberator fickte?
In dem Artikel wurde Fidel Castro zitiert, der die Herausgabe von Ches Leichnam verlangte. Maximilian hatte Che immer kennenlernen wollen. Fidel kannte er natürlich persönlich, aber noch so viel Gesichtsbehaarung und grüne Uniformen konnten den katholischen Schuljungen im Commandante nicht vergessen machen. «Parlamentswahlen für 1970 angesetzt» lautete die Zeitungsschlagzeile unter dem Knick.
Ein paar Wahlen hatte er gewonnen, aber noch mehr verloren. Sein Cousin wurde zu seinem Rivalen und gewann die letzte. Jemand musste Jamaikas Führung an sich reissen – dazu war nichts weiter nötig als ein echter Mann mit einer starken Hand. Maximilian hatte das Land mit der Faust umfasst und dann zugedrückt. Wie es ihm hatte entgleiten können, war ihm ein Rätsel. Glitschige Gedanken liessen ihn an Milch denken und dass er die Milchtüten immer bis zu einer Woche nach dem Ablaufdatum noch weiter verwendete. «Die ist noch gut», sagte er und verfluchte seine Frau, wenn sie die Milch wegschüttete. Jetzt stand die Tüte auf dem Tisch neben Che.
Maximilian fragte sich, wie lang Che wohl schon tot gewesen war, als das Foto aufgenommen wurde. Lächelnd bis zum Letzten. Das Bild konnte nicht älter als zwei Wochen sein. Alles veränderte sich so schnell heutzutage. Schneller als Telex. Maximilian konnte sich an sein erstes und an sein letztes Pferd erinnern, sein erstes Auto und das letzte, das beim Aufprall an einer stählernen Hängebrücke einen Totalschaden erlitten hatte. Wie vielversprechend und hoffnungsvoll war sein Leben damals gewesen, seins und das von Che. Und nun war Che tot. 1967 musste ohne ihn weitergehen.
Aber war er nicht auch ein Befreiungsheld? Auf seine eigene Art? Ein Lastwagen rumpelte vorbei, verweigerte aber die Antwort. Stattdessen dröhnte ein Hämmern aus den Fenstern, das von den Armen «Reggae» genannt wurde, eine Männerstimme ritt auf dem treibenden Rhythmus mit und gab heulend zum Besten: The gal Caroline say she live across the line / The gal Caroline say she live across the line / Some of them say she a thirty-nine / Some of them say she a forty-nine / She just a walk from Pegasus to Skyline.
Er fragte sich, ob Ches Leiche zum offiziellen Begräbnis nach Kuba zurückgeschickt würde. Amtsträger mussten angerufen, Minister zusammengetrommelt werden. Die Kubaner würden natürlich erwarten, dass mindestens der Vizepremier und der Aussenminister anwesend sein würden, wenn der Premierminister schon nicht kam. Darauf würde Fidel bestehen, auch wenn die kommunistische Republik von der jamaikanischen Regierung nicht offiziell anerkannt wurde. Er fragte sich, wer wohl bei der Beerdigung dabei sein würde. Vielleicht ein Beatle oder ein Rolling Stone oder Michael Caine – ein ganz Schlimmer in «Der Verführer lässt schön grüssen».
Als er aufstehen wollte, versagten ihm die Beine den Dienst. Warum hatte sich das Alter so unbemerkt wie ein geflüstertes Versprechen bei ihm eingeschlichen? Oder eine geflüsterte Warnung. Draussen wartete die Nacht. Die zwei würden sicher nicht mehr kommen. Was für eine Erleichterung. Heute nacht brauchte Maximilian nicht mehr den Gastgeber für tote Männer zu spielen. Seine Frau durfte auf keinen Fall denken, er sei senil. Die Xanthippe war wahrscheinlich sowieso schon dabei, seine Abschiebung ins Altenheim vorzubereiten, wo den alten Leutchen nachts die Ratten in die Zehen bissen.
«Ist alles in Ordnung, Exzellenz?»
«Was? Wagst du es, dich über mich lustig zu machen, Weibsstück?»
«Ich wollte nur nachfragen, ob Sie etwas brauchen, Sir.»
«Lass mich in Ruhe», sagte er. Er wollte hinzufügen: Ich erwarte Besuch, sprach den Satz aber nicht aus. Irgendwie stank es süsslich nach Desinfektionsmittel. Er fragte sich, warum er das jetzt erst bemerkte. Ihm fielen noch andere Dinge im Zimmer auf: Dass der Geruch vom Boden und seinen Kleidern zugleich auszugehen schien, dass der Boden selbst in der kommenden Dunkelheit das graue Licht von draussen zu reflektieren schien und dass seine Frau in letzter Zeit ständig weiss trug, als habe sie eine Neuvermählung im Sinn. Gerüchte gingen um über sie und Teddy James – das war der, der schlafwandelnd vom Balkon gefallen war, obwohl er nie zuvor geschlafwandelt hatte. Das war im Januar 1960 gewesen.
1960? Maximilian schaute aufs Datum der Zeitung, da stand 1967 drauf. Ein Lied kam ihm in den Kopf. Engine, engine number nine / Engine, engine number nine, ging der Text. Verdammter Stuhl, er stand jetzt auf. Genau wie Franklin Roosevelt 1945. Wie Nelson. Er stützte sich auf der Stuhllehne ab und schob sich in die Senkrechte. Sein Kopf war schon lange beim ersten Schritt, bevor sein Körper hinterherkam. Aber dann bewegte sich der linke Fuss, dann der rechte, dann wieder der linke, und er überlegte, ob er vielleicht von zu Hause abhauen und vor seiner Frau in dem weissen Kleid – ein bisschen wie bei einer niedlichen Krankenschwester sah das aus – und dem Desinfektionsgestank fliehen sollte. Sein linkes Bein rutschte weg und gegen einen Stuhl.

«Verdammter Bomboclaat!», schrie er.
«Was geht da drüben vor sich?»
«Nichts!»
«Das klingt aber nicht wie nichts, das klingt eher, als würden Sie was im Schilde führen, Mister.»
«Ein Stuhl ist umgekippt.»
«Zwingen Sie mich nicht, zu Ihnen reinzukommen!»
Ihre Art machte Maximilian fuchsteufelswild. Für wen hielt sie sich eigentlich, dass sie mit ihm redete, als sei er ein kleiner Hosenscheisser? Wusste sie überhaupt noch, dass er vor nicht allzu langer Zeit noch mit den berüchtigtsten Gestalten der Insel an einem Tisch gesessen und die Arme ausgebreitet hatte, damit jeder die zwei Holster unter seinem Jackett sehen konnte, eins unter jeder Achsel, darin zwei Revolver mit Elfenbeingriff, die ihm der Premierminister des Kongo persönlich geschenkt hatte? Wusste sie überhaupt, dass er nur zu nicken brauchte, und im Ghetto ging Sodom und Gomorrha los? Wusste sie noch, dass kein verdammtes Arschloch es mehr gewagt hatte, ihm in die Quere zu kommen, seit Teddy James vom Balkon geschlafwandelt war? Wollte sie etwa, dass er das ganze Land mit in die Scheisse zog, verdammter Raasclaat? Wollte sie das wirklich, die blöde Ziege?
Die Macht juckte ihn. Er manövrierte sich einen weiteren Schritt vorwärts und bemerkte eine fliehende Person, nichts als eine huschende Bewegung, und seine Hand schnellte vor zum nicht vorhandenen Schulterholster. Er stiess einen weiteren Fluch aus und machte einen Schritt zurück. Dort, in der Dunkelheit der linken Zimmerecke, war jemand, ein Weisser, ihm ähnlich, er schien ihn nachzuäffen. Ein Spiegel.
Engine, engine number nine / Engine, engine number nine / Going cross Chicago line, ging das Lied. Schweren Schrittes bewegte Maximilian sich auf den Spiegel zu. Ein Weisser schaute ihn an. Ein Mann mit weissen Haaren und wild abstehenden Koteletten, als wollten sie vor seinem Gesicht wegrennen. Seine Haut schien grau, was aber auch am Mondlicht liegen konnte. Seine Haare glichen einer wilden Mähne und er hätte am liebsten gebrüllt, aber das hätte wieder seine Frau auf den Plan gerufen. Von wegen Nationalheld! Wann waren seine Augenbrauen so schlohweiss geworden? Er wusste, dass es 1967 war und die nächsten Wahlen in drei Jahren stattfinden würden. Er dachte an das träge Mädchen, mit dem er vor nicht mehr als vier Wochen geschlafen hatte, ein schwarzes Prachtweib mit Honigtaubrüsten aus dem Back ’o Wall Ghetto. «Honigtau» war ein Wort, das sein Cousin gern in den Mund nahm. Sie hatten sich nur einmal ein Mädchen geteilt, vor fünf Jahren – oder waren das fünf Mädchen vor einem Jahr gewesen? Che hätte es ihm sagen können, aber die Zeitung lag neben den toten Insekten und der abgelaufenen Milch auf dem Tisch.
Er schnupperte, roch Asche und saures Fleisch und zuckte zusammen, weil er glaubte, ein Feuer sei ausgebrochen. Da stand auf einmal Aloysius Dawkins hinter ihm im Spiegel, noch schwärzer als sonst, um den Kopf wirbelte ihm Rauch. Vor dem Kohlschwarz seiner Haut leuchteten die Augen weiss. Aloysius hob die Hand, ein Finger fiel ab. Nie ein Mann vieler Worte, der Aloysius, sagte eine andere Stimme in perfektem Oxfordenglisch.
«Teddy», sagte Maximilian.
Cousin.
Teddy stand auch hinter ihm; seine weisse Haut schien neben Aloysius richtiggehend zu leuchten. Sein Lächeln war strahlend wie eh und je, doch als er den Mund weiter verzog, sah man die ausgefallenen Zähne. Mit einem Mal lief sein halbes Gesicht knallrot an, als ihm das Blut in den Kopf strömte.
Auohhhh, ich glaube, mir kommt’s, sagte Teddy.
«Was wollt ihr hier? Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen?»
Maxy, Maxy, behandelt man so etwa seinen Cous–
«Was wollt ihr? Kommt ihr euch euer Pfund Fleisch holen?»
Der Kaufmann von Venedig? Dabei hat man doch immer gesagt, ich wäre der Belesene von uns zweien.
«Was habt ihr hier zu suchen? Warum zum Raas kreuzt ihr hier auf, seid ihr nicht etwa schon zu Nationalhelden erklärt worden? Was ist mit mir? Was wollt ihr jetzt noch?»
«Mit wem reden Sie da drin?» Clemencias Stimme kam aus einem anderen Zimmer.
«Bloodclaat! Kannst du mich nicht in Frieden lassen? Ich hab nur laut gedacht.» Maximilian entfernte sich vom Spiegel.
Warum wir jetzt kommen? Wir waren nie weg, alter Freund.
«Im Lauf, das Notwendige … im Lauf der, der Ereignisse wird das Praktische manchmal das Notwendige zum grösseren Wohl der –»
Ist ja gut. Ich weiss noch, wie ich das geschrieben habe. Starke Worte. Sturm und Drang, der ganze Blödsinn. Ich muss allerdings sagen, du hast es viel besser vorgetragen, als ich das je gekonnt hätte. Du hattest genau das notwendige Quentchen … Ungeschlachtheit. Ist das das richtige Wort? Ja, so kann man’s nennen, Ungeschlachtheit. Genau, du hattest exakt die dafür notwendige Ungeschlachtheit. Deswegen hab ich die Rede extra für dich da liegen lassen.
«Das hast du nicht, ich habe das Ding in deinem Zimmer mitgehen lassen, als, als …» Maximilian hielt sich den Mund zu.
Pass auf, was du sagst, meinte der aschfahle Aloysius. Aber das kostete ihn die Lippe, die ihm wegbrach.
Wer hätte das gedacht? Da brauchte es nur ein Feuer und einen Schubs, und schon war Nummer drei die Nummer eins, fügte Teddy hinzu.
Maximilian entfernte sich vom Spiegel. Er hüpfte und hangelte sich an den Armen zurück zu seinem Stuhl. Im Zimmer roch es nach Asche und trockenem Blut.
«Egal, was ich in diesem Scheissleben gewollt hab, immer musste ich’s mir selber holen, es mir grapschen wie ein gieriges Baby! Mir hat nie einer was geschenkt!»
Ja, ja, stimmt schon.
«Was hat unser Herrgott sich verdammt noch mal dabei gedacht? Sollte das ein Witz sein? Dass er mir die Haut von ʼnem Weissen gibt, aber die Armut von einem Schwarzen? Aber ich hab’s ihm gezeigt, ich hab’s dem Schweinehund gezeigt.»
Du hast es allen gezeigt, Maxy.
«Worauf du einen lassen kannst. Dir hab ich’s auch gezeigt.»
Na ja … strenggenommen, du weisst, was das Wort bedeutet, ja? Also ganz strenggenommen hast du mir gar nichts «gezeigt». Du hast mich nämlich von hinten gestossen, da konnte ich dich also nicht sehen.
«Schnauze! Immer redest du zu viel und drehst einem die Worte im Mund herum.»
Aloysius schien zu zischen, aber es war nur das Brutzeln seines verbrannten Fleischs.
«Ihr, alle beide, raus hier, und kommt ja nicht wieder!»
Der Nationalheld redet nicht mehr mit uns, sagte Aloysius.
«Raus!»
Aber wir sind doch immer da, Maxy. Was meinst du, was dich seit 1960 da am Hinterkopf kitzelt?
«Was? Jetzt ist 1967. Che Guevara ist gerade erschossen worden. Steht in der Zeitung. Bist ein gottverdammter Idiot, dass du –»
Aloysius gab ein hohes Kichern von sich, das ein bisschen wie ein Röcheln klang. Das Gelächter von Teddy James hallte wie ein Donnerschlag durch den Raum. Ein mehrstimmiger Chor des Hohns. Maximilian griff nach einem Teller und warf ihn in die dunkle Ecke, wo der Spiegel hing. Das Geschepper brachte den Raum zum Leben, das Licht ging an.
«Was ist hier los, in Dreiteufelsnamen?», verlangte sie zu wissen, die Hand immer noch am Lichtschalter.
«Nichts. Rein gar nichts. Geh zurück in die Küche und verdirb weiter mein Abendessen.»
Sie seufzte. «Warum setzen Sie sich nicht schön hin und benehmen sich?»
«Warum setzt du dich nicht hin und benimmst du dich, hä? Seh ich aus wie ein kleiner Rotzbengel oder was? Ich bin ein Nationalheld.»
«Jawohl, Mister Minister. Ich hab Sie ja wohl vor zwei Jahren im Rollstuhl geschoben, als Sie Ihre Medaille bekommen haben, oder etwa nicht?»
«Ausserdem. Es passt mir nicht, wenn du so mit mir redest. Das passt mir überhaupt nicht.»
«Und wie soll ich dann mit Ihnen reden?»
«Ich, … ich weiss nicht … nur nicht so, meine ich damit!»
«Lassen Sie Ihre Pillen etwa wieder verschwinden?»
«Was für einen Furz hast du jetzt wieder im Hirn? Und – einen Augenblick, was hast du da gerade gesagt?»
«Ich habe gefragt, ob Sie Ihre Pillen verschwinden lassen.»
«Nein, davor meine ich.»
«Ich bin kein Kassettenrecorder, Mister Minister. Mich kann man nicht einfach zurückspulen.»
«Werd bloss nicht frech.»
«Mister Minister, Sie haben mir versprochen, dass Sie die Dinger schlucken. Ich habe Ihnen geglaubt. Müssen wir sie Ihnen etwa wieder gewaltsam in den Rachen schieben?»
Maximilian zitterte. Er setzte sich. Die Frau kam herüber zum Tisch und griff nach seiner Zeitung. Sie rollte sie zusammen und erschlug damit einen Käfer auf dem Stuhl.
«Der ist schon tot», sagte Maximilian. Er liess den Kopf sinken.
«Jeden Tag holen Sie diese Zeitung raus. Was soll denn so Besonderes daran sein, hm?»
«Ich … ich darf Ches Beerdigung nicht vergessen. Das wird ein grosses Ereignis.»
«Tja, wenn’s in der Zeitung steht, dann ist es auf jeden Fall schon vorbei.»
Engine, engine number nine, gab es da dieses Lied.
Verdammtes Ehegespons. Wie sie mit ihrer miesen Weiberart auf ihm herumhackte. «Du willst bloss nicht, dass ich hingehe», sagte er.
«Bitte, gehen Sie nur. Mir doch wurscht.»
«Warum bist du nur immer so, Clemencia? Was hab ich dir denn angetan, dass du ständig an mir rumnörgelst?»
«Und wer ist jetzt Clemencia?»
Maximilian Morrison sah die Frau an und schloss die Augen. Der Unterkiefer sackte ihm herunter, als würde ihm das Atmen zu schwer. Es gab keine Asche, kein Schwefel, kein Fleisch und kein Blut. Nur Desinfektionsmittel, und der Gestank kam von der Frau. Er betrachtete sie, wie sie sich am Kopf kratzte. Ihr Käppchen bewegte sich hin und her.
«Und glauben Sie bloss nicht, ich würde nicht gleich kommen und Sie mit dem Schwamm waschen, nur weil es fast Nacht ist.»
Maximilian blickte ihr ins Gesicht, sah aber nichts.
«Jetzt verrat mir eine einzige Sache. Nur eine. Wie viele Monate noch, bis 1967 zu Ende ist?», fragte er.
Lachend musterte ihn die Krankenschwester. Als sie unter dem Versprechen ging, gleich mit Schale und Schwamm zurückzukehren, lachte sie immer noch. Maximilian nahm die Zeitung in die Hand, die sich auf einmal schlaff anfühlte. Das Papier war braun, nicht weiss. 1967 war ein Jahr voller Versprechen. 1967 wurde ihm Jamaika in die offene Hand serviert, und er würde mit eiserner Faust zugreifen. 1976? Die Zeitung fiel zu Boden. Der Abend verabschiedete sich, und die Nacht liess seinen Blick kurz klar werden. Nur für einen Augenblick.
Engine, engine number nine / Engine, engine number nine / Running cross Chicago line / Next year a 1979 / Next year a 1979 / Hey!
Marlon James (Text)
ist jamaikanischer Schriftsteller und Träger des Man Booker Prize 2015. Zuletzt von ihm erschienen: «A Brief History of Seven Killings» (Oneworld, 2014), die deutsche Übersetzung des Romans erscheint im Frühjahr 2017 im Heyne-Verlag.
Anke Caroline Burger (Übersetzung)
ist literarische Übersetzerin und lebt in Berlin und Montreal.
Wojtek Klimek (Illustration)
ist Kunstmaler und Illustrator. Er lebt in Zürich.