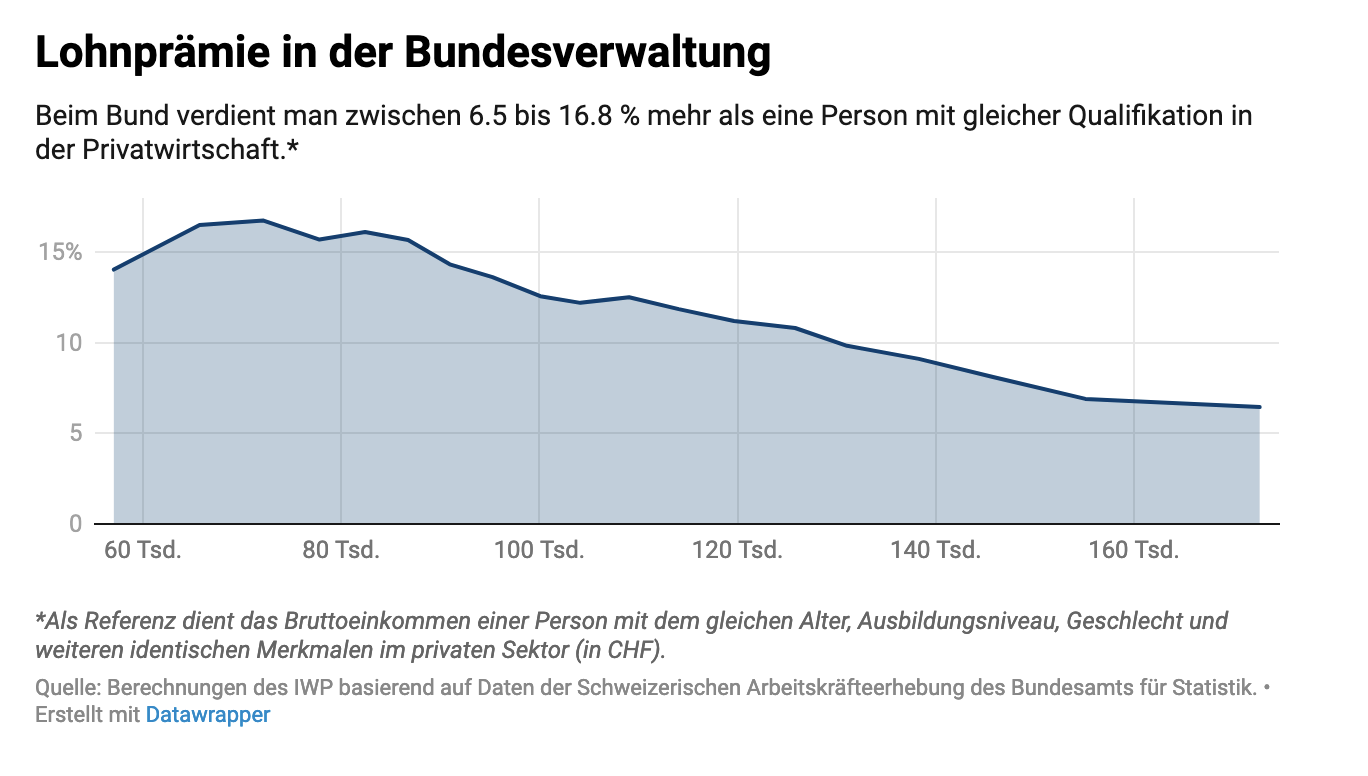Elementare Probleme bei Dr. Watson
Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet: der Supercomputer Watson for Oncology, der die Krebstherapie revolutionieren sollte, kämpft noch immer mit Kinderkrankheiten.
Nichts weniger als «die Behandlung von Krebs revolutionieren»: das versprach das IT-Unternehmen IBM Spitälern und der Öffentlichkeit, als es 2014 «Watson for Oncology» einführte. Der Supercomputer werde beim Erstellen von Diagnosen und Therapievorschlägen jedem Tumorboard überlegen sein – ähnlich wie er schon seine (menschlichen) Konkurrenten in der amerikanischen Gameshow «Jeopardy» geschlagen habe.
Gut drei Jahre später zeigt eine breite Recherche des US-Newsportals STAT, dass IBM den Mund offenbar etwas zu voll genommen hat. «Watson for Oncology» erfüllt die hochfliegenden Erwartungen noch kaum. Das System kämpft mit der Verschiedenartigkeit von Krebserkrankungen. Denn jeder Krebs ist anders, egal ob er Lunge, die Brust, Prostata oder Nieren trifft. Krebsformen sind so vielfältig und individuell wie die Patientinnen und Patienten, die an ihnen erkranken.
Genau diese unüberschaubare Datenmenge sollte «Watson for Oncology» sortieren helfen, mehr noch: das System sollte daraus die optimalen Therapieansätze ableiten. Doch das kann es offenbar noch nicht. «‹Watson for Oncology› steckt in den Kinderschuhen», sagte Taewoo Kang, ein südkoreanischer Krebsspezialist, der mit dem System arbeitet. Es werde noch lange dauern, bis der Supercomputer jene Präzisionsmedizin liefere, die von ihm erwartet werde.
Für den Schweizer Publizisten und Technologiespezialisten Matthias Zehnder ist das bisherige Abschneiden von «Watson for Oncology» nicht überraschend. «Intelligente Systeme sind nicht per se intelligent», sagt Zehnder. Ein Supercomputer sei zwar hypereffizient beim Sieben von Daten – deswegen sei «Watson» zum Beispiel beim Diagnostizieren von Röntgenbildern dem Auge des Radiologen überlegen, wie Studien gezeigt hätten. Aber: «Der Supercomputer ist keine kreative Wundermaschine. Denken muss der Mensch immer noch selber», sagt Zehnder, der an einem Buch schreibt zum Thema «Digitale Kränkung – wenn der Mensch durch Computer ersetzt wird». Gerade bei so etwas Komplexem wie Krebs und der Krebsforschung sei medizinische Kreativität ganz besonders gefragt.
Diese Einschätzung deckt sich mit den Recherchen der STAT-Reporter, die bei «Watson»-Anwendern weltweit Dutzende von Interviews geführt haben. Ihre Bilanz: das System kreiert kein neues Wissen, und es ist nur in einem äusserst rudimentären Sinn «künstlich intelligent». Der Grund: «Watson for Oncology» kann zwar Unmengen von Daten verdauen – von ärztlichen Aufzeichnungen über Studienergebnisse bis zu klinischen Guidelines. Aber von diesen Datenmengen kann das System nicht aus sich heraus irgendwelche Behandlungsempfehlungen generieren. Die Therapieansätze basieren ausschliesslich auf dem Input, mit dem menschliche Köpfe das System «füttern». In anderen Worten: hinter der kreativen Leistung steht nicht der Computer, sondern ärztliche Kunst.
Konkret ist es eine einzige Institution, auf deren Know-how «Watson for Oncology» sich abstützt: das renommierte Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Dessen Ärzte und Ärztinnen sind dazu befugt, den Supercomputer zu trainieren – selbst wenn die Evidenz für ihre Empfehlungen dünn ist. «Es kostet enorme Anstrengung, das System auf dem neusten Stand zu halten», lässt sich Mark Kris, der Haupttrainer von «Watson for Oncology» am Memorial Sloan Kettering, zitieren. Behandlungsrichtlinien für bestimmte Krebsformen änderten oft wöchentlich, etwa wenn irgendwo auf der Welt eine wichtige Konferenz stattgefunden habe. Dem Computer solche Änderungen beizubringen, sei eine zähe Sache. «Man muss Publikationen, Fallstudien und vieles mehr integrieren», sagte Kris.
Zurzeit benutzen gemäss STAT-Recherchen weltweit ein paar Dutzend Spitäler «Watson for Oncology», bei Benutzerkosten von 200 bis 1000 Dollar pro Patient. Die Institutionen verlassen sich unterschiedlich auf das System: kleinere Spitäler mit wenig Spezialisten gaben an, sie würden sich bei ihren Diagnosen stark auf den Supercomputer abstützen, andere benutzen ihn eher als Rückfallebene.
IBM Health hat gegenüber STAT eingeräumt, «Watson for Oncology» sei noch am Anfang. Doch das System lerne schnell. Auf seiner Website streicht das Unternehmen heraus, 90 Prozent der Behandlungsempfehlungen stimmten mit jenen von Tumorboards überein. Immerhin.