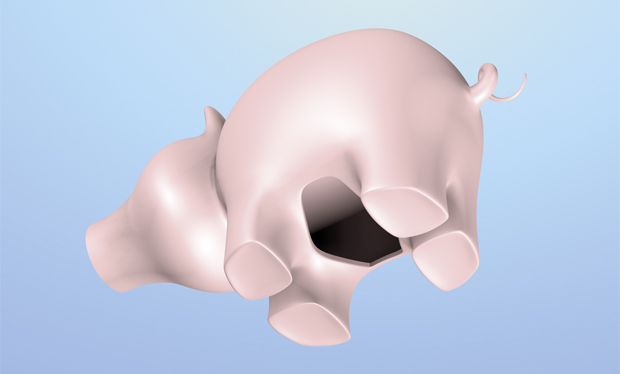Alles muss raus!
Nullzins + Gebühren = Negativzins. Das Bankguthaben des Normalanlegers verringert sich, wenn es liegenbleibt. Also muss investiert werden! Nur wie? Ein Selbstversuch.

2008 war das Jahr der Finanzkrise. Seither senkten die Notenbanken in den USA, Grossbritannien und Europa die Leitzinsen, die sich bis dahin in einer Höhe von 4 bis 6 Prozent bewegt hatten, auf 1 Prozent und weniger ab. Noch im Jahr 1990 wurden Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit positiven Zinssätzen von 6,3 Prozent (20-jährige Anleihen) bis 7,3 Prozent (2-jährige Anleihen) vergütet. 2016 jedoch war der Zinssatz stets unter null Prozent, also negativ. Wer heute ein Stück der Schweiz besitzen will, verliert Geld, statt es zu mehren.
2015, sieben Jahre nach der Finanzkrise, führte die Schweizer Nationalbank Negativzinsen ein. Banken, die Geld bei der SNB deponieren, müssen seither einen Negativzins von 0,75 Prozent bezahlen. Bisher wälzte erst die Alternative Bank Schweiz (ABS) diese Negativzinsen auf ihre Kunden ab, andere Banken zögern noch, ihrem Beispiel zu folgen. Eine GfK-Umfrage ergab 2016, dass nur vier Prozent von 1000 Befragten ihr Erspartes auch bei einer negativen Verzinsung auf dem Bankkonto lassen wollen. Jeder vierte Befragte gab an, bei Einführung von Strafzinsen sein Geld abheben und mehr Bargeld horten zu wollen. Dass die Befragten alle auch so handeln werden, ist aber unwahrscheinlich, denn der Mensch, oft träge und wenig interessiert an kompliziert erscheinenden Finanz- und Vermögensfragen, müsste sich ja aktiv für alternative Anlageformen entscheiden.
Wie also anlegen?
Ich treffe mich mit Maximilian Kunkel, einem grossgewachsenen, smarten, geschliffen formulierenden Mitarbeiter des UBS Chief Investment Office Wealth Management mit dem wohlklingenden Jobtitel Cross-Asset-Strategist. Zunächst klären wir ein paar Grundvoraussetzungen, also der Umfang des Investments, die Renditeerwartungen und die Risikotoleranz: bin ich eher bereit, 10 Prozent zu verlieren oder 30 Prozent? «Vielen geht es vor allem darum, ihr Kapital langfristig zu halten und wenn möglich zu vermehren. Überraschungen will man wenn möglich keine erleben», sagt Kunkel und legt mir drei Grundprinzipien nahe:
1. Diversifizieren. Also Anlagen in unterschiedlichen Vermögensklassen, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Branchen tätigen. Die Frage lautet: Welche Kombination gibt auf fünf bis sieben Jahre hinweg die beste strategische Vermögensallokation? Abweichungen auf taktischer Ebene sind hier zu vernachlässigen.
2. Von Trends profitieren. «Megatrends» wie die Urbanisierung, das Bevölkerungswachstum, die Alterung der Gesellschaft oder das durch den Wohlstand ausgelöste Sicherheitsbedürfnis blieben in den letzten Jahren bemerkenswert stabil. Man kann von ihnen profitieren, indem man beispielsweise in die Infrastruktur von Schwellenländern investiert, in die Krebsforschung oder in Sicherheitslösungen.
3. Abweichungen innerhalb der Vermögensallokation. Extrarendite kann erwirtschaftet werden durch kluge taktische Bewegungen innerhalb der strategischen Vermögensallokation. Es geht dabei um Fristen von bis zu sechs Monaten.
Kleinen Anlegern wie mir empfiehlt Kunkel ein klassisches, über verschiedene Anlagen diversifiziertes Portfolio, vielleicht angereichert mit Hedgefunds. Kleinsparern generell empfohlen sei die dritte Säule, ergänzt Kunkel. So könne man auch Steuern sparen. Also mache ich mich auf die Suche nach Anlagemöglichkeiten für mein beschränktes Budget: Immobilien, Kunst, Goldbarren und andere Anlagen, in die sowieso schon alle investieren, lass ich mal aus.
Seltene Erden: eine Tonne Gallium in der Garage
«Heureka!», rufe ich, nachdem ich eine Weile angestrengt über Investments nachgedacht und schliesslich bei Seltenerdmetalle24.de gelandet bin, wo es ein Starterset für gerade mal 329 Euro gibt. Darin: je 1 bis 2 Gramm von 16 natürlichen Seltenerdmetallen, in Ampullen aufbewahrt, denn «einige dieser seltenen und wertvollen Metalle oxidieren innerhalb weniger Minuten an der Luft». Eine geniale Anlage, denke ich mir, doch drängt sich mir unweigerlich die Frage auf, an wen ich diese Ampullen, deren Inhalte zur Herstellung der allermeisten elektronischen Gadgets gebraucht werden, in ein paar Jahren verkaufen werde. Ich entscheide, mich beraten zu lassen. «Eine Zeit wie die, in der wir uns gerade befinden, hat es noch nie gegeben!», teilt mir Caren Voss von der TerraMetal Invest GmbH in Quickborn mit – eine Firma, die Seltene Erden in grösseren Mengen anbietet, als ich sie hier auf meinem Schreibtisch lagern könnte. Wie funktioniert das? «Man eröffnet ein Depot und kann, auch wenn die Order über Deutschland geht, sein Geld direkt auf ein Schweizer Konto überweisen», sagt Voss. Ist das geschehen, wird die bestellte Ware im Zollfreilager Embrach eingelagert. Eine Eigentumsurkunde wird ausgehändigt, mit der man die Ware, nach Voranmeldung, jederzeit abholen kann. «Aber ist diese Ware denn tatsächlich auch physisch verfügbar?», frage ich zweifelnd. «Ja», versichert mir Frau Voss, «tatsächlich ist alles, was wir verkaufen, physisch auch vorhanden. Jedes einzelne Korn. Das ist die Garantie, die wir geben. Die einzige Garantie.» Dann muss ich mich nur noch für etwas entscheiden: Neodym? Antimon? Indium? Germanium? Ein Kilo Gallium kostet derzeit um die 250 Euro. 2011, auf dem Höhepunkt eines durch temporäre Knappheit ausgelösten Booms, kostete es viermal so viel. Da Seltene Erden in 100-Kilo-Tonnen verkauft und auf einer Holzpalette angeliefert werden, müsste ich für eine Tonne 25 000 Franken zahlen. Gelagert werden sie bei kon-stant 18 bis 20 Grad, denn auch wenn die Tonnen verschlossen und verplombt sind, können sie Schaden nehmen – viele der -Seltenen Erden sind leicht entflammbar. Einige Käufer lagern die Tonnen trotzdem zu Hause, zum Beispiel «in der Garage oder im Keller». Mit Rendite sollte man in diesem Bereich allerdings nicht mehr rechnen, sagt Frau Voss etwas kleinlaut: «Wir haben uns vollständig vom Renditegedanken verabschiedet und versuchen, das auch unseren Kunden klarzumachen. Bei der Anlage in Seltene Erden geht es um den Kaufkrafterhalt auf längere Frist. Schliesslich ist 1 Kilo Gallium immer 1 Kilo Gallium.»
Zigarren: Investment in den Genuss
Zurück nach Zürich. Rund um den Paradeplatz kann man nicht nur Geld bei Banken anlegen, sondern auch in Zigarren. Im «Manuel’s» an der Löwenstrasse rauche ich mit Manuel Fröhlich eine 2007 verpackte und seitdem gelagerte «Hoyo de Monterrey». Fröhlich, der zusammen mit seiner kubanischen Frau Kaffee, Rum und Zigarren anbietet, schwärmt von der Anlagemöglichkeit der Havanna-Zigarren. Er selbst kauft vor allem frische Bestseller, limitierte Editionen und natürlich auch Restposten, wenn sie sich anbieten – und lagert sie im kellereigenen Humidor: «In unserem Kundenfach kann man Zigarren im Wert von 10 000 Franken lagern, inklusive Versicherung.» Beim aktuellen Aufbewahrungspreis von 450 Franken pro Jahr muss man also nach zehn Jahren eine Lagergebühr von 4500 Franken über Wertsteigerungen herausholen. «Das Beste daran: man kann die Zigarren auch jederzeit selbst rauchen.» Investments in andere Genussmittel, also Wein oder Whiskey, sind vergleichbar. Wäre ich Zigarrenraucher, würde ich investieren. Bin ich aber nicht. Und ich frage mich auch, ob Investieren nicht auch mehr sein kann als blosses Einlagern und Abwarten. Können andere mit meinem Geld vielleicht mehr für uns alle herausholen als ich mit Tabakblättern in einem Humidor?
Mikrokredite: den Start in die Selbständigkeit ermöglichen
Ich betätige mich also einmal selbst als Bank und investiere 50 US-Dollar in die «Happy Pigs Group», eine Gruppe von drei Frauen in Vietnam. Auf die «Happy Pigs Group» bin ich über die Non-Profit-Organisation Kiva gestossen, die das Mikrokredit-Portal Kiva.org betreibt – als alternative Portale dazu bieten sich Babyloan.org, Milaap.org oder Zidisha.org an. Die Wortführerin der Gruppe, Frau Năm, 51 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, ist seit über zehn Jahren in der Tierzucht tätig. Sie benötigt das Geld für den Kauf von Ferkeln, die sie aufziehen und danach verkaufen will. Warum aber holen diese Frauen ihren Kredit nicht einfach von der lokalen Bank? Weil Menschen mit niedrigen Einkommen in den abgelegenen ländlichen Gemeinden Vietnams grosse Mühe haben, Banken zu finden, die ihnen solche Kredite gewähren. Năm fragt bereits zum elften Mal nach einem Darlehen – die zehn davor habe sie alle erfolgreich zurückbezahlt, informiert mich Kiva. Ob Geschirr in Pakistan, Dünger in Armenien, Zementsäcke in der Demokratischen Republik Kongo, finanzieren kann man branchenübergreifend und weltweit, auch in Microfinance-Fonds, wie sie Firmen wie Blue Orchard, responsAbility oder Symbiotics anbieten. Arme, aber aktive Bevölkerungsschichten erhalten so den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt, die Anleger eine Investitionsmöglichkeit mit Wertzuwachs. Hier bin ich dabei, entscheide ich. Ob der Kredit wie vereinbart mit Zins zurückbezahlt wird, sehe ich in zwanzig Monaten, wenn die letzte Tranche fällig ist.
Kryptowährungen: Spekulieren im alternativen Währungsmarkt
Wer dem Schweizer Franken zutraut, eine verlässliche Währung zu bleiben, kann einige 1000er-Noten bündeln, stapeln und in Schliessfächern oder Tresoren aufbewahren. Viele machen das, offensichtlich: 2015 stellten 1000er-Noten 62 Prozent des Werts von Schweizer Banknoten. Neben den tradierten Währungen gibt es aber auch digitale Zahlungsmittel, die sogenannten Kryptowährungen – einer Übersicht auf Coinmarketcap.com gemäss gibt es derzeit über 700 verschiedene. Am bekanntesten ist natürlich der Bitcoin (BTC) mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 12 Milliarden US-Dollar – seit November 2016 kann man ihn an den Billettautomaten der SBB beziehen. Die Nummer 2 auf der Liste, Ethereum (ETH), wird herausgegeben von der Stiftung Ethereum in Zug und hat eine Marktkapitalisierung von rund 900 Millionen US-Dollar. Ich kaufe also via Coinbase.com für fast 500 Euro Ethereum und erhalte dafür im Gegenzug rund 58 ETH – die sich in den Wochen darauf zuerst mal abwerten. Wie der Betrag auf dem herkömmlichen Bankkonto ist dieser Betrag rein virtuell, ich kann ihn aber zwischen verschiedenen digitalen Geldbörsen verschieben. Ethereum versteht sich nicht als Konkurrenzwährung zum Bitcoin, sondern als komplementäre Währung innerhalb des digitalen Ökosystems. Der langfristige Erfolg oder Misserfolg wird sich zeigen, bei Redaktionsschluss bin ich jedenfalls im Plus.
Schliessfächer: eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit
Ein Besuch im Untergeschoss der Credit Suisse am Paradeplatz zeigt eine grau-metallische Landschaft aus Fächern mit Schlössern dran – es sieht etwas aus wie die Umkleidekabine in einem Elitesportclub. 8000 Schliessfächer sind für Credit-Suisse-Kunden am Paradeplatz verfügbar, zu einer Jahresmiete von 200 bis zu 1000 Franken. Wer hier 100 000 Franken Bargeld bei Mietkosten von 200 Franken pro Jahr deponiert, zahlt sozusagen einen Negativzins von – 0,2 Prozent; denn nicht nur Negativzinsen, auch Schliessfachkosten verringern das Vermögen. Dennoch ist die Nachfrage nach Schliessfächern seit Jahren ungebrochen hoch. Sicher eingelagert werden müssen schliesslich nicht nur Verträge, Bankunterlagen, Liegenschaftenverschreibungen, Di-plome, Darlehensverträge, Briefmarkensammlungen, Liebesbriefe und Sicherungskopien von Daten, sondern auch Schmuck, Bargeld, Goldbarren, Goldmünzen und andere Edelmetalle. Doch selbst die grössten, mannshohen Fächer sind nicht für eine Last von über 250 Kilogramm konzipiert. «Die einzelnen hinterlegten Stücke sollten maximal zwanzig Kilogramm wiegen. Man sollte den Inhalt noch selbst herausnehmen können», heisst es von Seiten der Bank. Der Bankmitarbeiter entfernt sich jeweils diskret, nachdem er zusammen mit dem Kunden ein Schliessfach geöffnet hat. Wer ein Schrankfach erbt, muss sich identifizieren und mit Erbbescheinigung oder einer Erbenvollmacht erscheinen. Nicht selten kommt es dann zu Überraschungen für die Erben, zu positiven und negativen. Und zu Diskussionen, die mitunter in Szenen ausarten.
Uhren und Autos: Investmentmöglichkeiten mit Nutzwert und Status
Das Konzept der Schliessfächer könnte sich auf Überdimen-sionen ausdehnen, die Zukunft der Banken so aussehen: Kundenfilialen in städtischen Einkaufspassagen werden abgelöst von Lagerstätten in sicherheitstechnisch ideal gelegenen Orten, zum Beispiel in steuer- und kostengünstigen strukturschwachen Re-gionen. Der Schweizer Banker bürgt neu etwa dafür, dass fünfzig fabrikneue, eingelagerte Mercedes-Maybach S 600 im Wert von rund zehn Millionen Schweizer Franken auch nach hundert Jahren Lagerung noch wie fabrikneu sind. Ob sie eine gute Kapitalanlage sind, wird sich noch herausstellen – sollten Benzinmotoren dann nicht mehr zugelassen sein, taugten sie lediglich noch als Ausstellungs- und Erinnerungsstücke. Dass mit alten Autos viel Geld zu verdienen ist, ist aber kein Geheimnis: ein Ferrari 250 GTO von 1962 wurde 2014 in Kalifornien für rund 38 Millionen US-Dollar verkauft. Uhren, die in den 1960er und 1970er Jahren ein paar hundert Franken kosteten, werden heute zu Marktpreisen von mehreren hunderttausend Franken verkauft. 2013 etwa verkaufte das Auktionshaus Christieʼs in Genf eine 1969 hergestellte Rolex Daytona «Paul Newman» für 989 000 Franken an einen unbekannten Käufer. Der bisherige Höchstpreis für eine Armbanduhr wurde 2015 an einer Charity-Auktion mit einer Patek Philippe 5016 erzielt: 7,3 Millionen Franken. Solange Menschen Uhren für etwas Schönes und Nützliches halten, eignen sie sich als Wertanlage. Und wenn etwas kaputtgeht, bemühen sich die Hersteller um die Reparatur – gegen Bezahlung, versteht sich. Ich trage schon seit Jahren keine Uhr mehr und fahre auch keine Autos. Allein bin ich diesbezüglich nicht – und da viele Indikatoren darauf hindeuten, dass sich die Zahl derer, die künftig ohne Uhr ganz ähnlich ticken wie ich, erhöht, entscheide ich mich gegen ein Investment.
Mobilien: Wie wärʼs mit einem neuen Sofa?
Als ich kürzlich in eine neue Wohnung einzog, musste ich mich für Möbel entscheiden. Gebrauchte aus dem Brockenhaus? Oder neue, und wenn ja, zu welchem Preis? In Zeiten des Negativzinses fällt es leichter, eine höhere Preisklasse zu wählen. Also besitze ich nun ein neues Sofa, das mir nicht nur besser gefällt als ein gebrauchtes, ich habe auch in etwas investiert, das ich täglich nutzen und bei Bedarf immer mitnehmen kann. Viele vergessen ja, dass Geld, das auf dem Kontokorrent rumliegt, auch schon ein Investment, ein Bilanzposten ist. Der Kauf eines Sofas ist nur eine Verlagerung von Aktiva «Bankguthaben» zu Aktiva «Mobiliar und Einrichtung». Mein Entscheid: ich sitze gut und erfreue mich dessen täglich. Und ich bilde mir ein, das Sofa eines Tages wieder verkaufen zu können – in Zürich gibt man für die richtige «Patina» schliesslich nicht selten sogar mehr aus als den Neuwert.
Journalismus und Kultur: ein Produkt mit ideeller Rendite
Direkt in den Journalismus zu investieren, aber ohne auf die Inhalte Einfluss zu nehmen, ohne eine Ausrichtung erzwingen zu wollen, also zum Beispiel mit dem Schalten einer Anzeige oder eines Werbespots, ist in Zeiten des Negativzinses die vielleicht beste Option. Wer meint, dass im Bereich der Pensionskassen, Hilfsgelder oder Sportrechte ein korrupter Sumpf existiert, oder wer die eigene Familien- oder Firmengeschichte aufarbeiten will, kann und soll unabhängige Journalisten darauf ansetzen und bezahlen. Wer sich Geschichten aus der Heimatstadt, eine TV-Serie über Alfred Escher oder eine Neuaufführung der «Kleinen Niederdorfoper» wünscht, soll Künstler angehen und sie direkt oder indirekt, zum Beispiel via Crowdfunding, finanzieren – sofern sie denn Interesse haben. Das so eingesetzte Geld ist dann nicht einfach weg, sondern hat ein Kulturprodukt erzeugt, von dem nicht nur der Investor, sondern bestenfalls auch die Allgemeinheit profitiert. Ein Vollerfolg beim Publikum, der sich nicht nur refinanziert, sondern auch rentiert, ist schliesslich die Ausnahme. In aller Regel jedoch wird eine Rendite erzielt, die sich auf den Geist und das Gemüt auswirkt. Mein Entscheid: ich investiere weiterhin, indem ich Journalismus produziere und für Kultur bezahle.
Die Folgen des Negativzinses
«YOLO!», rufen sich die Anleger in diesen Tagen zu, wenn sie Liquidität zu Handfestem machen wollen. Passt dieser sich ganz der Jetztzeit verpflichtende Leitspruch («you only live once», «du lebst nur einmal») nicht perfekt in die Null- und Negativzinszeit? Wer YOLO sagt und auch meint, lebt, um das eigene Glück des Moments zu maximieren, und nimmt dafür auch eine nachfolgende Sintflut in Kauf. Bis vor kurzem war das noch anders: das Zinsumfeld belohnte vorausschauendes Handeln, und die Menschen versuchten, das Kapital, das sie angespart hatten, zu vergrössern – das war einfach und lohnte sich auch für die allermeisten. Doch jetzt, in goldenen Zeiten, aber unsicherer Zukunft? Ein schöner Urlaub, den man verbracht hat, scheint mehr Sinn zu machen, als das Reisegeld zu sparen – wenn sich der auf dem Konto liegende Betrag ja doch nur verringert. Dieser fehlende Anreiz des positiven Zinses ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere hat gefährliche Folgen:
1. Auslaufmodell Sparen: Weil es sich nicht mehr lohnt, sparen die Menschen nicht mehr und sorgen also nicht mehr selbständig vor für die eigene Zukunft. Die private Eigenverantwortung wird entwertet. Mehr und mehr überlassen die Menschen die Verantwortung für ihr Dasein und ihre Zukunft der Politik.
2. Entwertung von liquidem Besitz: Der Leitspruch «Nur Bares ist Wahres» hat ausgedient. Weil die Bürger faktisch dazu gezwungen werden, ein Bankkonto zu haben, können sie den Negativzinsen (und der Inflation) nicht entfliehen. Das in Bargeld / Kontoguthaben angelegte Eigentum wird nach und nach entwertet.
3. Zurück zum Tauschhandel: Wahr wird somit wieder Handfestes, Realwerte: ein Goldklumpen für ein Pferd, ein Pferd für eine Kuh und so weiter. Die Zukunft ist die Vergangenheit.
4. Fehlinvestitionen: Das aus all diesen Entwicklungen resultierende Erfordernis eines schnellen Abzugs aus der Liquidität verleitet zu wahllosen Investitionen, also zu Fehlinvestitionen. Denn zu null Zinsen geliehenes Geld bedeutet null Risiko bei der Anlage.
5. Blasenbildung: Wie vor der Finanzkrise 2008 werden Nichtkreditwürdige mit Krediten bedient, es wird Geld in marode Immobilien und Firmen gesteckt. Es bilden sich Blasen.
6. Crash: Irgendwann platzt jede Blase. Marode Firmen und Schuldner machen Konkurs, die Anleger verlieren ihr Geld. Und hin und wieder entsteht dann Panik an den Börsen.
Einen Crash mit unabsehbaren Folgen, also das Gegenteil einer kontrollierten Situation, wünscht sich kaum jemand. Die Entwertung von Bargeld, die Kontrolle von Eigentum dagegen kommt nicht dem freien Bürger zupass, sondern einem übergriffigen Staat. Dem Ziel der totalen Transparenz, so zeigen es die Snowden-Files, ist er schon bedenklich nahegekommen. Noch bleiben die Transaktionen von Eigentum und Bargeld aber jene Bereiche, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen. Wie lange noch?
Das globale Finanzsystem wurde bisher stets vom Treibstoff Positivzins angefeuert. Auch alle wissenschaftliche Lektüre geht von positiven, nicht von negativen Zinsen aus. Was passiert, wenn Negativzinsen die Regel sind, ist weitgehend unerforscht. Was sich ereignet, wenn die Banken ihren Kunden nicht mehr zwischen 0 und 1 Prozent Zins verrechnen, sondern 5, 10 oder 20 Prozent, sie also für das deponierte Geld teuer bezahlen müssen, kann niemand sagen. Werden sie dann ihre Telefon-, Steuer- und Hypothekarrechnungen über Jahre im voraus abzahlen? Wird es statt «bezahlbar mit 2 Prozent Skonto in 10 Tagen» heissen: «bezahlbar mit 2 Prozent Skonto nach einem Jahr»? Wird das Horten von Waren zum «Megatrend»?
Per Zufall verbrachte das Team des «Schweizer Monats» sein Weihnachtsessen im gleichen Restaurant wie das Team der Schweizerischen Nationalbank. Auf die anschliessende Frage, wohin es künftig geht mit den Zinsen, antwortete der Präsident des SNB-Direktoriums, Thomas Jordan, spontan: «Es kann in alle Richtungen gehen.» Wie die bemerkenswert ernsten Gesichter der SNB-Führungscrew beim Essen zu deuten sind, bleibt eine offene Frage. Das Gremium steht jedenfalls unter grossem Druck.