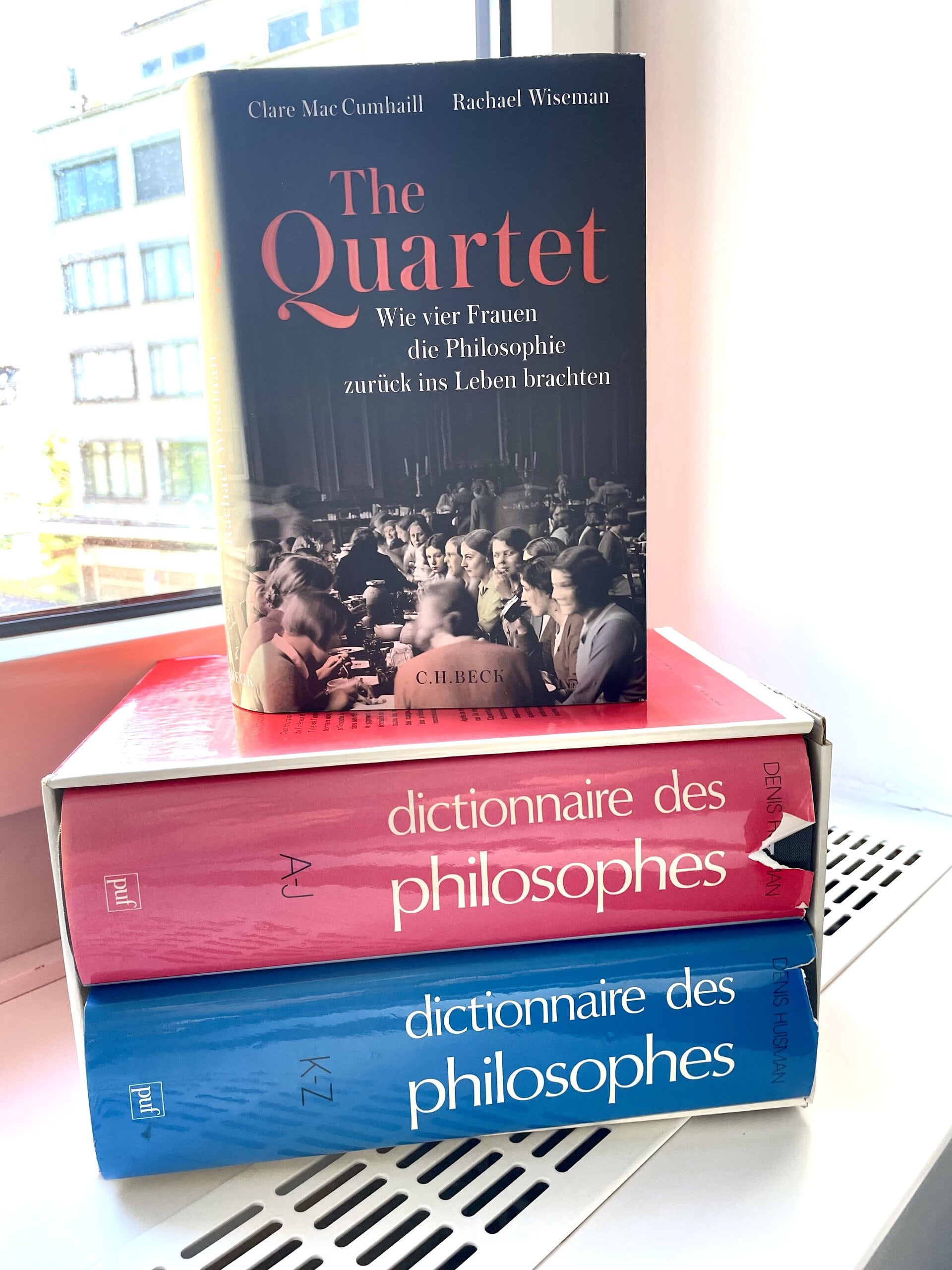Wo bitte diktiert der Markt?
Zahlen und Gedanken zum Erfolg eines Zerrbildes
Vor 20 Jahren richtete das Weissbuch «Mut zum Aufbruch» einen knapp 80seitigen marktwirtschaftlichen Weckruf an die von Wachstumsschwäche und Lethargie gezeichnete Schweiz. Die Unterzeichner des Manifests, Wirtschaftsführer, aber auch einige Professoren (und einer der beiden Autoren dieses Aufsatzes), wurden als Sozialabbaumillionäre an den Pranger gestellt. Die Medien gaben sich alle Mühe, die Ideen als radikal und unsozial zu diskreditieren. In den Folgejahren wurden zwar manche Reformvorschläge – zumindest teilweise – umgesetzt, und die Schweiz fand wieder zu einem ansehnlichen Wachstum zurück. Aber Prof. Ernst Baltensperger kam im Jahr 2005 dessen ungeachtet zu Recht zum Schluss, dass sich, gemessen an den Ambitionen, «der Realisierungsgrad der Reformvorhaben als ernüchternd niedrig und der Reformprozess als enttäuschend zähflüssig und schwierig» erwiesen habe.
Offensichtlich waren die Reformgegner mit ihrer Diffamierungsstrategie – Deregulierungswut, Diktat des Marktes, Kaputtsparen oder Sozialabbau – ziemlich erfolgreich. Das Bemühen um mehr Wettbewerb und Selbstverantwortung wurde gebremst. Daran hat sich nicht viel geändert. Noch immer wird bei fast jedem marktorientierten Reformvorschlag so getan, als lebten wir in einer so ungemütlich freien Marktwirtschaft, dass noch «mehr Markt» alle in einen unmenschlichen Kampf ums nackte Überleben stürzte und uns jeglicher zivilisatorischer Errungenschaften beraubte. Doch wo bitte existiert in der Wirklichkeit unserer Breitengrade der ungezügelte Markt, der in mannigfachen Zerrbildern beschrieben wird? Von welcher Welt reden Bewahrer des Status quo und Kritiker liberaler Reformen eigentlich? Jedenfalls nicht von der schweizerischen Realität, wie nur schon eine approximative Vermessung von Staat und Markt zeigt.
Zur Hälfte entmündigt
Eine zentrale Rolle für die Beurteilung der Freiheit einer Gesellschaft spielt der Anteil an der jährlichen Wertschöpfung eines Landes, über den die Individuen unmittelbar verfügen. Der Rest geht zunächst an das Kollektiv, den öffentlichen Sektor, um dann teilweise in Form von staatlichen Leistungen und Umverteilung wieder an die Individuen zurückzufliessen. Dieser Anteil der Steuern am Bruttoinlandsprodukt (BIP), die sogenannte Fiskalquote – gemäss Gerard Radnitzky der «Entmündigungskoeffizient» einer Gesellschaft –, ist in der engsten Definition der amtlichen Statistik seit 1965 um 12 Prozentpunkte auf 27 Prozent gestiegen und hat sich damit nur leicht schwächer entwickelt als in den nordischen Ländern. Deutlich drastischer präsentiert sich die Quote, wenn man die Zwangsabgaben, die an private Sozialversicherungen gehen, dazuzählt. Und das muss man tun, will man die schweizerische Realität korrekt abbilden. Man muss sich also der «erweiterten Fiskalquote» bedienen. Entscheidend ist ja, wie viel Geld den Menschen verbleibt, über das sie frei verfügen können, mit dem sie mehr vom einen und weniger vom anderen konsumieren oder mit dem sie allenfalls sparen können. Da macht es wenig Unterschied, ob die Zwangsabgabe an den Staat, parastaatliche Institutionen wie die SRG oder private Krankenkassen und Vorsorgewerke abgeliefert werden muss.
Wer korrekt rechnet, ist zudem gehalten, für die Berechnung einer aussagekräftigen Fiskalquote den Nenner, also das BIP, um die Abschreibungen zu bereinigen; denn bevor Dividenden ausgeschüttet oder Löhne bezahlt werden können, müssen Maschinen unterhalten und Ersatzinvestitionen getätigt werden. Nimmt man diese Anpassungen vor, ergibt sich für 2013 eine Fiskalquote von 48 Prozent – das ist nahe an den 50 Prozent jener Systeme, für die Peter Sloterdijk den treffenden Ausdruck «steuerstaatlich zugreifender Semisozialismus auf eigentumswirtschaftlicher Grundlage» geprägt hat. Wenn man früher den Zehnten als Ausdruck feudaler Ausbeutung verstand, kann man heute das Vier- bis Fünffache davon mit noch so vielen Relativierungen kaum als Ausdruck grosser Freiheitlichkeit interpretieren.
Fast all diese Zwangsabgaben bedeuten nicht nur einen Freiheitsverlust, sie führen auch zu Verzerrungen des Verhaltens, zur Bremsung des Leistungswillens und zu Effizienzverlusten. Zwar lässt sich auf makroökonomischer Ebene kein klarer Zusammenhang zwischen der Höhe oder der Veränderung der Fiskalquote und dem Wirtschaftswachstum darstellen, weil die «kausale Dichte» zu gross ist, also eine Fülle anderer Faktoren eine Rolle spielt, etwa die Art der Besteuerung oder der Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft. Eines jedoch ist gewiss: das Leistungsangebot des Staates entspricht nicht dem, was auf einem freien Markt angeboten würde, es entspricht bestenfalls zu einem Teil der Nachfrage der Bürger nach solchen Leistungen. Dieses Angebot ist vielmehr ein Abbild der politischen Durchsetzungskraft gut organisierter Sonderinteressengruppen, die manchmal vorgeben, das grössere Ganze zu vertreten, manchmal aber auch relativ hemmungslos ihre eigenen Anliegen auf die Fahnen schreiben – auf Kosten aller anderen. Wo bitte ist hier die Diktatur des Marktes?
Umverteilung zulasten kommender Generationen
Seit einigen Jahren ist die hohe Staatsquote nun relativ stabil geblieben; von Staatsabbau, der liberalen Reformen gerne angedichtet wird, kann nicht die Rede sein. Die Schuldenbremse auf Bundesebene, die wichtigste finanzpolitische Errungenschaft seit Jahrzehnten, die die Forderung des Weissbuchs nach einem anhaltenden Rechnungsausgleich aufnahm und im Jahr 2003 eingeführt wurde, hat hierzu wohl einen Beitrag geleistet. Doch das vordergründige Bild täuscht: Weil Steuererhöhungen zu sichtbar wären (besonders bei der Einkommenssteuer), neigt die Politik dazu, ihre Umverteilungslust vermehrt über den Umweg der So-zialversicherungen auszuleben, allem voran in der Altersvorsorge. Dies geschieht hauptsächlich zulasten künftiger Generationen, die noch nichts zu sagen haben.
Die Zurückdrängung der privaten Verfügungsgewalt zugunsten des Staates verlagert sich somit von der Steuerpolitik zunehmend auf das komplexe Gebiet der Sozialversicherung – und wird damit weniger sicht- bzw. greifbar. Und jener Teil der Zwangsabgaben, der durch die Schuldenbremse diszipliniert wird, wird immer kleiner, wodurch die Wirksamkeit der Schuldenbremse schleichend abnimmt. Es geht hier um grosse Summen: Der Finanzierungsbedarf der öffentlichen Pensionskassen ist beträchtlich; 2013 betrug er allein für die kantonalen Pensionskassen, für die zuverlässige Zahlen vorliegen, 44 Milliarden Franken. Das ergibt pro einzelnen Versicherten (Aktive und Rentner) im Durchschnitt einen Fehlbetrag von 69 000 Franken, wobei die regionalen Unterschiede erheblich sind. Den Genfer Staatsangestellten fehlen beispielsweise pro Kopf sogar 174 000 Franken.1
Bisher sind die Lohnbeiträge für die Sozialversicherungen konstant geblieben, doch angesichts der wachsenden impliziten Verschuldung dürfte sich dies ändern, zumal die Erhöhung des Rentenalters in der Schweiz ein Tabu zu bleiben scheint. Die Reform der Altersvorsorge 2020 sieht einen Anstieg der Lohnbeiträge für die 2. Säule von 2,5 Milliarden Franken oder rund 5 Prozent vor. Für die AHV sind weitere 4 Milliarden pro Jahr vorgesehen, dank einer Erhöhung der Mehrwertsteuersätze um 2 Prozentpunkte. Die erweiterte Fiskalquote würde damit die 50-Prozent-Grenze plus/minus erreichen. Dennoch wäre dies keine finanziell nachhaltige Lösung: Gemäss einer Simulation der Universität Freiburg i. Br. für die UBS würde damit die implizite Verschuldung der öffentlichen Haushalte zwar deutlich reduziert – aber das hiesse, dass immer noch eine Verschuldung von 500 Milliarden Franken bliebe.2 Solch massive Schulden nicht für zukunftsträchtige Investitionen, sondern allein zur Finanzierung heutigen Konsums sind nicht nur Diebstahl an unseren Enkeln, sondern haben vor allem nichts mit Marktorientierung zu tun.
Wachsende Bürokratie
Noch mehr als eine hohe Fiskalquote engen Regulierungen die Menschen in den modernen Gesellschaften ein. Regulierungen verursachen Kosten, die für die Allgemeinheit kaum sichtbar sind und deswegen weniger Widerstand auslösen. Statt mit dem abgeschöpften Geld selbst aktiv zu werden, zwingt der Staat seine Bürger zu bestimmten Handlungen, sei es mit übergenauen Rechnungslegungsvorschriften, schlecht durchdachten Emissionsstandards für Autos, einer Fülle von technischen Geboten und Verboten, etwa für Glühbirnen, oder diversen unüberschaubaren Bauvorgaben.
Was das alles kostet, kann man nur erahnen. Ein Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) bezeichnet die Bereiche Rechnungslegung und Revisionsaufsicht als jene mit den höchsten Regulierungskosten für die Wirtschaft. Sie sollen bei der Rechnungslegung 10 Prozent an den Gesamtausgaben von 11,5 Milliarden Franken ausmachen – die restlichen Kosten würden freiwillig eingehen, weil die Rechnungslegung für alle Unternehmen von zentraler Bedeutung sei. Bezeichnend ist, dass gemäss einer Umfrage die Finanzchefs grösserer Unternehmungen die jährliche Revision vor allem unter dem Aspekt der Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sehen – und nicht als Dienst an den Investoren des Unternehmens.3
Gemäss dem Bürokratiemonitor des Seco schätzen 54 Prozent der Unternehmen die Belastung durch Regulierungen als hoch ein. Diese Belastung ist nicht etwa nur «gefühlt», wie es in den Mainstreammedien gerne heisst: Zwischen 2004 und 2014 ist, wie Avenir Suisse kürzlich gezeigt hat, allein der Umfang der Erlasse auf Bundesebene von 54 000 Seiten auf über 67 000 Seiten gestiegen.4 So überrascht es nicht, dass das World Economic Forum (WEF) mit Blick auf das Kriterium «Burden of government regulation» in den letzten fünf Jahren eine Verschlechterung der Schweiz von Rang 11 auf Rang 17 konstatiert. Beim ebenfalls stark auf Regulierungen ausgerichteten Weltbank-Indikator «Ease of doing business» ist die Schweiz gar von Rang 11 (im Jahr 2005) auf Rang 29 (2014) abgestiegen. Ganz schlecht schneidet das Land bei Bauregulierungen ab. Hier ist es im Ranking der Weltbank zwischen 2008 und 2014 von Rang 28 auf Rang 58 zurückgefallen. Eine beachtliche Leistung – im negativen Sinne.
Weniger sichtbar, aber vielleicht noch mehr freiheitseinengend – ähnlich den Fäden, mit denen Gulliver von den Liliputanern gefesselt wurde – sind jene Regulierungen, mit denen die Konsumenten(-innen) und Bürger(innen) unmittelbar konfrontiert werden, etwa beim «Konsumentenschutz» (eher ein Schutz gewisser Produzenten zulasten der Verbraucher) und im Umwelt- und Energiebereich, wo der Einfluss der staatlichen Bürokratie in den letzten Jahrzehnten am meisten erweitert wurde. Munter wurden Standards für die Energieeffizienz von Waschmaschinen, Trocknern, Backöfen, Bürogeräten, Set-Top-Boxen, elektrischen Motoren, TV-Geräten, Computerservern, Kühlschränken oder Autos festgelegt. Dabei geht es nicht nur um das Wohl der Umwelt oder, wie Behörden gerne (den Jargon der Ökonomen nachahmend) sagen, um die Reduktion von «negativen externen Effekten». Die durch diese Regulierungen den Konsumenten aufgebürdeten Kosten übersteigen nämlich den vermiedenen Umweltschaden oft um ein Vielfaches. Dahinter steckt vielmehr der grundsätzliche Zweifel der Behörden am gesunden Menschenverstand und an der Mündigkeit der Konsumenten. So hat etwa die Dachorganisation der Konsumentenschützer Europas (BEUC) der EU-Kommission wärmstens empfohlen, die CO2-Emissionsgrenzwerte für Personenwagen drastisch zu verschärfen, damit «die Konsumenten vor weiteren Anstiegen der Benzinpreise geschützt werden können». Mit der Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips im Jahr 2010, das in vielen Bereichen ausländische technische Vorschriften den schweizerischen gleichstellt und damit den Wettbewerb verschärft, hat die Schweiz zunächst den vielen eigenen Regulierungen etwas die Schärfe genommen. Dass der Nationalrat nun dieses Prinzip für Lebensmittel wieder aufheben möchte, kommt einem gravierenden Schritt weg vom Markt gleich und schädigt vor allem die schwächeren Haushalte gerade in einem Moment, in dem sie unter dem hohen Frankenkurs ächzen.
Trotz Kosten und Freiheitseinengung herrscht im Bereich der Regulierung besonders ausgeprägter Reformwiderstand. Spätestens seit der Finanzkrise gilt es als anerkanntes Dogma, dass der Markt ohne weitgehende Regulierung nur zu Exzessen, zu Unmoral und zu unfairen Ergebnissen führen kann (dies ungeachtet der Tatsache, dass es genau bestimmte Regulierungen waren, die die Krise erst ermöglichten). Die Begriffe Überregulierung und Bürokratisierung sind auf dem Radar der Medien und der Ökonomen weitgehend verschwunden. Wer heute die Bürokratie kritisch erwähnt, riskiert, als Ewiggestriger abgestempelt zu werden. Auch beim breiten Publikum steht das Thema nicht mehr auf der Prioritätenliste, wie die FDP am eigenen Leib spüren musste, als sie 2011 mit ihrer Initiative «Bürokratie-Stopp» die nötige Zahl an Unterschriften verpasste. Das ist wohl Ausdruck des Zeitgeistes. Der an der London School of Economics lehrende Anthropologe David Graeber meinte unlängst in seinem Buch «The Utopia of Rules» nonchalant, aber in der Sache richtig, die Bürokratie sei so sehr Teil des sozialen Gefüges geworden, dass die Bürger gar nicht mehr darüber nachdächten.
Mehr als nur etwas reguliert, sondern dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage weitgehend entzogen ist der Mietwohnungsmarkt. Hier kann man gut sehen, dass dies auch höchst fragwürdige Verteilungswirkungen hat. Seit der Jahrtausendwende hat die Nachfrage nach städtischem Wohnraum stark zugenommen; Boden ist in den Zentren knapper geworden. In einem normal funktionierenden Markt würden die Mieten diese Knappheit signalisieren. Nicht so in der Schweiz, denn diese Periode fiel zufälligerweise mit einer langen Phase fallender Zinsen zusammen, und hierzulande koppelt eine gut gemeinte Regel die Mieten an die Hypothekarzinssätze – ein Unikum in Europa. Während Mieten und Immobilienpreise von Neubauten durch die Decke gehen, bleiben die Wohnkosten für Altmieter unverändert. Diese stellen die grosse Mehrheit der Bevölkerung dar – gemäss einer Analyse der ZKB sind 2014 89 Prozent der Schweizer Haushalte in der gleichen Wohnung verblieben.5 Und sie haben einen starken ökonomischen Anreiz, ihre Wohnung, auch wenn sie inzwischen vielleicht zu gross geworden ist oder sonst wie den Bedürfnissen nicht mehr entspricht, nur ja nicht zu verlassen. Je mehr Wohnungen dem Markt faktisch entzogen werden, desto stärker wird der Aufwärtsdruck bei den auf dem Neuvermietungsmarkt angebotenen Wohnungen.
Junge und mobile Haushalte haben das Nachsehen – sie müssen viel höhere Mieten zahlen, als wenn der «Wohnungsmarkt» tatsächlich ein Markt wäre, sie müssen sich gedulden, arrangieren, im Platz massiv einschränken, pendeln und trotz Umzugswunsch auf einen Umzug verzichten. Diesen durch massive Eingriffe in den Markt erzeugten Teufelskreis machen sich die Anhänger der «Sozialisierung» des Immobilienmarktes zunutze: Der gemeinnützige Wohnungsbau wird weiter ausgebaut, der Anteil des halbwegs freien Marktes im Immobiliensektor sinkt weiter, die Mieten im freien Segment steigen dadurch noch stärker, und gleichzeitig wachsen Anteil und Einfluss jener, die von dieser «Gemeinnützigkeit» profitieren. Es drohen gefrorene Städte, in denen sich langjährige Mieter wie Eigentümer verhalten, ohne die Risiken tragen zu müssen. In Genf ist dies schon Realität: Mittlerweile liegt die Umzugshäufigkeit dort auf dem Niveau des Kantons Glarus und tiefer als im ländlichen Jura.
Nur wenige wirklich freie Preise
Mietpreise sind nur ein Beispiel, wo nicht das Zusammenspiel von Käufern und Verkäufern, sondern der lange Arm des Staates schliesslich die Preise bestimmt oder zumindest beeinflusst. Wo aber die Preise nicht frei sind, herrscht kein freier Markt. Ein besonders krasser Fall ist die Landwirtschaft. Schätzungen zeigen, dass der Agrarsektor in der Schweiz mittlerweile eine negative Wertschöpfung aufweist, also mehr Ressourcen verbraucht, als er schafft – und dies sogar unter Berücksichtigung der «Dienste an der Allgemeinheit» wie dem Landschaftsschutz.6 Auch im Gesundheitswesen, in dem die Zunahme der Beschäftigung in den letzten Jahren besonders gross war und das daher zur Ausdehnung des öffentlichen Sektors wesentlich beigetragen hat, werden die Preise abseits des Marktes festgelegt.
Wo nicht ganze Branchen in ihrer Preisbildung gegängelt werden, wird der Endverkaufspreis meist zumindest durch die Steuern und Zölle beeinflusst. Nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern auch Abgaben wie Tabaksteuer, Stempelsteuer, Mineralölsteuer oder die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) zeigen den staatlichen Einfluss. Etwas weniger offensichtlich ist der indirekte Einfluss des Staates durch technische Handelshemmnisse. Sie verteuern unsere Produkte im Vergleich zum Ausland deutlich. Gemäss Economiesuisse wird insgesamt mehr als die Hälfte der Preise direkt oder indirekt durch staatliches Handeln geprägt: auch hier von einem Diktat des Marktes keine Spur.7
Die Menschen, nicht der Markt
Kürzlich befragte der englische Wirtschaftsjournalist Tim Harford ein Panel von prominenten Mainstreamökonomen zu den dringendsten wirtschaftspolitischen Problemen Grossbritanniens (und ihren Lösungen). Mit Erstaunen stellte er fest, dass keiner die Bürokratie anprangerte, Steuersenkungen vorschlug oder den Freihandel auch nur am Rande erwähnte. Man kann dies verschieden deuten. Zum einen könnte man unterstellen, es gebe offensichtlich keine Probleme mit Regulierung, wucherndem Steuerstaat und Protektionismus. Zum andern aber kann man vermuten, dass selbst der Zunft der Ökonomen, die in ihrer Mehrheit marktwirtschaftlich und staatsskeptisch eingestellt ist, der Kompass abhanden gekommen ist. Unsere Betrachtungen haben gezeigt, dass mit grösster Wahrscheinlichkeit letzteres zutrifft. Welche Indikatoren man auch nimmt – das Private, Individuelle, der Markt, auf dem sich ein privates Angebot und eine freie Nachfrage treffen, ist alles andere als dominant. Unregulierte Bereiche gibt es kaum, gänzlich freie Preise ebenfalls nur wenige, viele Sektoren sind staatsnah oder parastaatlich und verstärken damit den öffentlichen Sektor im engeren Sinne, also die öffentliche Verwaltung. Gegen die Hälfte dessen, was wir Jahr für Jahr erwirtschaften, liefern wir dem Staat und den Sozialversicherungen ab, auf dass sie damit Dinge tun, die wir vielleicht für wichtig halten, vielleicht aber auch nicht; auf dass sie Umverteilung betreiben oder dass sie unser Geld anlegen, um es uns dann später wieder einmal in Form von Renten zurückzugeben. Und über die Jahrzehnte hinweg, seit den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das Private, der Markt, zugunsten des Öffentlichen, des Staates, in geradezu drastischem Masse zurückgedrängt worden, auch wenn faktenresistente Medien weiterhin das Gegenteil erzählen.
Diese Entwicklung ist in den letzten 15 Jahren vielleicht weniger sichtbar gewesen als zuvor, aber sie hat nicht aufgehört. Während nämlich die Staatsquote und die Fiskalquote, die bis zur Jahrtausendwende gewachsen sind, seither praktisch stagnieren – aber nicht zurückgehen –, nimmt die Regulierung weiter zu, auch deswegen, weil selbst viele Marktwirtschafter glauben, es müsse alles Mögliche von technokratischen, aber letztlich doch staatlichen Aufsichtsbehörden geregelt und überwacht werden. Ebenfalls weniger sichtbar als ein Anstieg der Staatsquote ist das überproportionale Wachstum jener Bereiche der Wirtschaft wie Gesundheit, Bildung, Medien, Verkehr oder Energie, die sich aus historischen Gründen teilweise in staatlichem Eigentum befinden, hochgradig reguliert oder parastaatlich organisiert sind.
Freiwilligkeit statt Zwang
Woher rührt die weit verbreitete Empörung über die angebliche Dominanz des Marktes? Liegt dem tatsächlich nur ungenügende Kenntnis über die marktferne Organisation so vieler Märkte zugrunde? Das mag ein Teil der Erklärung sein. Noch mehr hat das Zerrbild des alles diktierenden Marktes aber mit einer Art Verdinglichung zu tun. Der Markt habe nicht immer recht, hört man immer wieder, so als ob der Markt eine handelnde Person sei, die recht oder unrecht haben könne. Dabei ist der Markt nichts anderes als das Zusammenspiel von oft nur einigen, meist aber unzähligen Menschen, die sich in der Regel nicht kennen, die autonom entscheiden und die damit die Marktergebnisse, die Preise der Güter, die Mengen und Qualitäten, die angeboten und nachgefragt werden, produzieren. Dahinter steckt kein Mastermind. Marktergebnisse kommen, gemäss der berühmten Formulierung Adam Fergusons, «by human action, not by human design» zustande. Märkte sind Verbindungen von Menschen, die handeln. Es sind Menschen, die gierig sind oder gar unmoralisch, aber vielleicht auch besonders grosszügig, einfühlsam und erfinderisch.
Wer Markt sagt, sagt zugleich Individuum und Freiwilligkeit. Wer Staat sagt, sagt zugleich Kollektiv und Zwang. Natürlich sind Märkte dynamisch, ein permanenter Such- und Entdeckungsprozess. Das ist zuweilen anstrengend, weil die produktive Unruhe des Marktes vom einzelnen beträchtliche Anpassungsleistungen verlangt – aber das Schöne daran ist, dass die Menschen über eine Vielfalt von Produkten, Dienstleistungen, Lebensverbesserungen und -erleichterungen verfügen können. Je mehr Kaufkraft abgeschöpft wird, je mehr reguliert wird, desto weniger bleibt für den einzelnen zu entscheiden – desto eher entscheiden andere an seiner statt. Der erste Schritt auf dem Weg zur Veränderung ist Erkenntnis. Sie lautet: Wir leben nicht in ungezügelten Marktwirtschaften. Die Fakten sprechen eine andere Sprache.