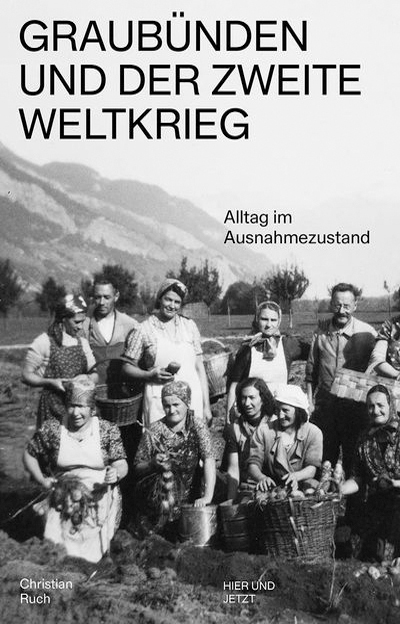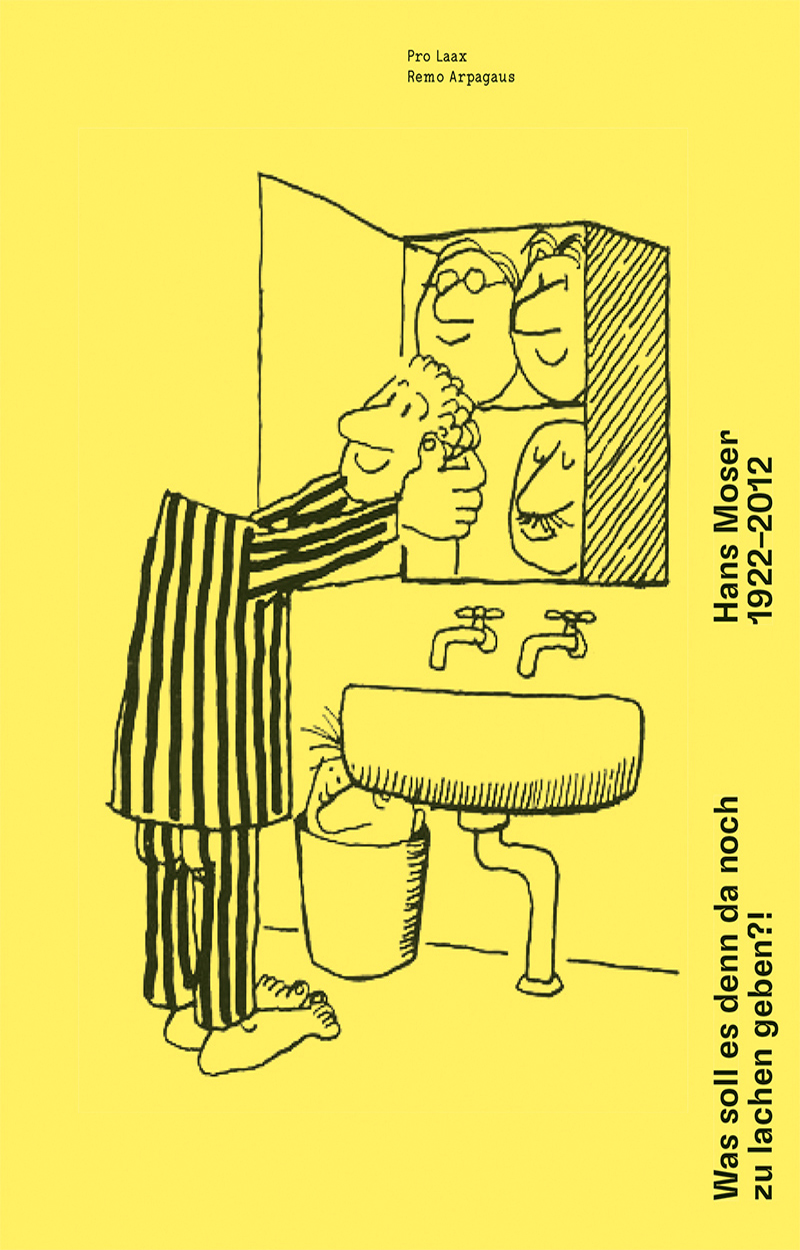Undicht bleiben
Wer kann, strebt heute nach einem höheren Abschluss. Gut so, findet der Philosoph Walther Ch. Zimmerli und plädiert für gesellschaftsweite Gesellschaftsreife. Um dann mit dem langen Herumsitzen im Schulzimmer die Berufslehre weiter zu schwächen, fragt der Ökonom Mathias Binswanger. Ein Streitgespräch über Maturaquoten und die
Konsequenzen von Kontingenten für Bildungsausländer.

Herr Binswanger, Herr Zimmerli, wie «studierfähig» und «gesellschaftsreif» fühlten Sie sich, als Sie einst das Gymnasium abschlossen?
Mathias Binswanger: Als ich 1982 die Matura gemacht hatte, war ich gut vorbereitet darauf, Stoff zu lernen und mir Wissen anzueignen. Eines der Ziele des Gymnasiums ist aber auch die Förderung «selbständig denkender Menschen» – und dieses selbständige Denken habe ich eigentlich erst nach dem Studium gelernt.
Walther Ch. Zimmerli: Auch bei mir wurden die reflexiven Kompetenzen eher im Studium gefördert, nicht zuletzt durch die starke Politisierung, die die Universitäten nach 1968 erlebten. Das Gymnasium hat mich ausgezeichnet auf das Studium vorbereitet. Ich bin jedoch ein schlechtes Beispiel, denn ich habe keine Matura in der Schweiz, sondern als Auslandschweizer in Göttingen ein deutsches Abitur gemacht. Das war 1964 und ziemlich elitär; nur 6 Prozent eines Jahrgangs haben studiert, und meine Klasse bestand zu mehr als der Hälfte aus Professorenkindern – ein Paradebeispiel für das, was heute als «Bildungsvererbung» bezeichnet und der Schweiz vorgeworfen wird.
Seither hat sich die Zahl der Mittelschulabschlüsse stark erhöht, auch in der Schweiz. Indes ist hier die Quote jener, die eine gymnasiale Matura absolvieren, mit knapp 20 Prozent im internationalen Vergleich noch immer tief. Sind wir in der Schweiz in einem verkrustet-elitären System verblieben?
Binswanger: Im Gegenteil! Die tiefe Maturaquote ist ein Qualitätsmerkmal unseres Bildungssystems, sie garantiert ein gewisses
Niveau – das allerdings durch die Tendenz zur allgemeinen Akademisierung in Gefahr gerät. Elitär sind hingegen die Bildungssysteme in jenen Ländern, die eine hohe Matura- oder Abiturquote aufweisen: Dort bilden sich grosse Klüfte zwischen den einzelnen Institutionen, und die angesehenen Universitäten führen deshalb rigorose Selektionen durch.
Zimmerli: Einspruch! Eine niedrige Maturitätsquote führt nie und nimmer zu weniger elitären Strukturen.
Binswanger: Immerhin macht es in der Schweiz zurzeit noch keinen grossen Unterschied, ob ich in Zürich, St. Gallen oder Bern studiere.
Gut. Ihre konträren Positionen zur Maturaquote sind mit ein Grund dafür, dass wir dieses Gespräch mit Ihnen beiden führen, wir wollen es aber in eine konkrete Richtung lenken. Denn die Diskussion um die «richtige» Maturaquote und ihre Auswirkungen beschäftigt die Schweiz zwar schon seit einer Weile, seit dem 9. Februar ist sie aber unter geänderten Vorzeichen zu führen. Nachdem die Schweizer Stimmbürger an der Urne entschieden haben, dass nicht mehr beliebig viele Fachkräfte aus dem Ausland importiert werden können, stellt sich doch ganz praktisch die Frage: Wird dieser Entscheid Auswirkungen auf unser Bildungssystem haben? Müssen wir jetzt mehr Leute an unseren Gymnasien ausbilden?
Zimmerli: Ja. Wenn die Masseneinwanderungsinitiative strikt umgesetzt wird, wird sich dies sehr schnell auf das Bildungssystem auswirken. Da hat man sich ein schönes Ei ins Nest gelegt. Aber ich bin ja Optimist und glaube, dass sich dadurch etwas in Gymnasium und Berufslehre verändern wird.
Binswanger: Nein. Weil die Konsequenzen der Initiative insgesamt klein sein werden, wird dies auch keine grossen Folgen für das Schweizer Ausbildungssystem haben.
Zimmerli: Das sehe ich anders. Bisher sind die Defizite unseres Bildungssystems nicht aufgefallen, weil wir die Lücken mit ausländischen Studierenden aufgefüllt haben. Und im Arbeitsmarkt haben wir ausländische Fachkräfte und Kader importiert. Wenn aber der Souverän entscheidet, dass dies nun nicht mehr so sein soll, dann stehen wir auf dem Schlauch. Nehmen wir das Beispiel der Ärzte: Man kann nicht Kontingente machen, die alle Ärzte zulassen und alle Nichtärzte abweisen. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir mit dem unsinnigen Numerus clausus aufhören und die Zahl der Studienplätze erhöhen. Die Mittel, um genügend Ärzte auszubilden, haben wir ja.
Binswanger: Es stimmt: wir verhalten uns in dieser Hinsicht wie Real Madrid und kaufen die Leute ein, statt sie selber auszubilden. Gerade bei den Ärzten ist dies unsinnig. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Zimmerli. Wir müssen schauen, dass wir die Substanz erhalten. Und dies betrifft zunehmend auch technische Berufe.
Es bleibt die Frage, wie man zu mehr Ärzten oder zu mehr «technischer Substanz» kommt. Mehr Maturanden bedeuten ja nicht zwangsläufig mehr naturwissenschaftliche Studenten – im Gegenteil: Angestiegen ist in den vergangenen Jahren insbesondere die Studierendenzahl in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Was wäre zu tun, um die Mittelschulabsolventen in die «richtige» Richtung zu bringen und die gesuchten Fachkräfte zu «generieren»?
Binswanger: Das ist nicht zuletzt eine Frage der Anerkennung. Den Ingenieuren etwa fehlt das gesellschaftliche Ansehen, das nötig wäre, um dieses schwierige Studium reizvoll zu machen. Und dann verdienen sie auch noch schlechter. Es ist einfach nicht attraktiv, die Anstrengungen einer dieser schwierigen Studienrichtungen auf sich zu nehmen. Wir haben also ein Problem mit den Anreizen.
Zimmerli: Das trifft ganz offenkundig so nicht zu: Wenn nur die finanziell lukrativen Fachrichtungen mit hohem Sozialprestige gewählt würden, warum haben wir in der Schweiz dann das erwähnte Übergewicht an Geistes- und Sozialwissenschaftern?
Binswanger: Vielleicht, weil diese Richtungen nicht ganz so anforderungsreich sind wie ein MINT-Studium.
Zimmerli: Das ist mir zu einfach. Es ist eher so, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften andere Anforderungen stellen. Gewiss, es ist Aufgabe der Gymnasien, ihre Absolventen auf das Studium aller Fachrichtungen vorzubereiten, und ich glaube, dass sie das durchaus auch versuchen. Allerdings gilt es zusätzlich einen externen Trend in Rechnung zu stellen: Je saturierter die Wirtschaft eines Landes ist, desto grösser ist das MINT-Problem. Die Schweiz und Deutschland sind besonders betroffen. Wo keine unmittelbare Notwendigkeit besteht, sich um das wirtschaftliche Überleben zu kümmern und den technologischen Fortschritt voranzutreiben, ist der Wille, ein MINT-Fach zu studieren, geringer als anderswo.
Das klingt einigermassen fatalistisch: Solange es uns gut geht, können wir nichts tun, um die MINT-Quote anzuheben?
Zimmerli: Nicht nichts; wir in der Schweiz können zwar allein die Lage nicht drastisch verändern, dazu sind wir zu klein. Aber wir können selbstverständlich jene Hürden minimieren, die wir selbst gebaut haben.
Auf welche Hürden zielen Sie?
Zimmerli: Etwa entdecken und fördern wir die rein mathematischen Talente viel zu wenig, weil wir in der Mathematik den Textaufgaben sehr viel Gewicht geben. Da könnten wir den Hebel ansetzen.
Binswanger: Wenn wir wollen, dass mehr Maturanden MINT-Fächer studieren, müssen wir dafür sorgen, dass diese Disziplinen wieder mehr Ansehen haben. Heute gilt der eine neue Erfindung austüftelnde Ingenieur kaum mehr etwas. Hohen Status besitzen Topmanager und Stars in den Medien. Warum eigentlich?
Zimmerli: In dieser Verkürzung trifft das nicht zu. Allerdings gilt in der Tat die normale Arbeit eines Ingenieurs, der Verbesserungen am Aussenspiegel von VW macht, nicht als besonders sexy. Was dagegen zählt, sind Hybridfähigkeiten. Nach Schumpeter ist Innovation nicht die neue Idee, sondern nur jene Idee, die sich erfolgreich am Markt behauptet. Unsere innovativen Helden sind also Menschen, die eine technische Idee haben und wissen, wie sie sie vermarkten können. Das sind Vorbilder – Steve Jobs als Wegbereiter für alle MINT-Aktivitäten.
Binswanger: Ansetzen können wir auch auf einer tieferen Ebene. Wir brauchen Leute, die mit den immer komplexeren Geräten, Maschinen und Informatiksystemen umgehen können. Es wird zunehmend schwieriger, die Leute für entsprechende Lehrberufe zu finden. Hierauf müssen wir unser Augenmerk richten und die Berufslehre attraktiv halten.
Die Klagen von Unternehmen, die nicht mehr genügend Lehrlinge für technisch anspruchsvolle Ausbildungen finden, häufen sich. Herr Zimmerli, untergräbt eine höhere Maturaquote einen Pfeiler unseres erfolgreichen Ausbildungssystems, indem sie die Berufslehre unattraktiv macht?
Zimmerli: Definitiv nicht. Ich habe viel Prügel einstecken müssen, als ich vor fünf Jahren gesagt habe, dass das duale Bildungssystem in eine Sackgasse laufen werde, wenn es sich nicht verändere. Seither hat sich vieles gewaltig geändert. Schauen Sie einmal, wie stark verschult oder verkopft auch die Berufsbildung heute ist. Sie können heute nicht mehr Heizungsmonteur sein, ohne die komplexen Funktionen der Maxwell-Gleichungen für Elektromagnetismus in der Anwendung zu beherrschen. Das heutige Handwerk ist eine hochkomplexe Angelegenheit, und dieser Entwicklung trägt die stärkere Akademisierung der Berufsausbildung in einer Wissensgesellschaft zum Glück auch in der Schweiz zunehmend Rechnung.
Binswanger: Wenn ich mich für den Erhalt der Berufslehre ausspreche, meine ich damit nicht, dass wir wieder Sattler und Drechsler ausbilden sollen. Natürlich werden die Lehrberufe immer technischer und anforderungsreicher, und selbstverständlich muss man sie ständig reformieren und dafür sorgen, dass die Ausbildung auf der Höhe der Zeit bleibt. Das kann man aber innerhalb des dualen Systems machen – und so den Lehrlingsweg auch für gute Leute wieder attraktiv werden lassen.
Zimmerli: Wie soll das gehen?
Binswanger: Das Ansehen der Lehre steigern! Man muss aufzeigen, dass man als Lehrling in Unternehmen Karriere machen kann, und die verringerte Durchlässigkeit innerhalb der Betriebe bekämpfen. Selbst in Banken wird es zunehmend schwieriger, mit einer Lehre aufzusteigen. Das ist sehr bedauerlich, denn es gibt eine grosse Reihe von Tätigkeiten, die man nun mal einfach effizienter «on the job» lernt und nicht, indem man in einem Zimmer sitzt und Dozenten zuhört.
Zimmerli: Die Entwicklung läuft aber in eine andere Richtung. Gerade war ich an einer Swissmem-Tagung, an der zwei Berufsweltmeister vorgestellt wurden. Man fragte die beiden dann vor Ort, was sie heute machen. Und was machen sie? Sie studieren an der ETH! Mit anderen Worten: das duale System ist vertikal strukturiert und nicht horizontal. Zwar gibt es viele Passerellen, die Übergänge schaffen. Nur führen die alle in eine Richtung – ich kenne niemanden, der nach einem ETH-Studium noch eine Berufslehre macht. Das heisst: wer kann, strebt heute nach einem höheren Abschluss.
Ginge es nach Ihnen, Herr Zimmerli, würden das künftig noch mehr junge Leute tun: Das Weissbuch «Zukunft Bildung Schweiz»,
das Sie mitverantworten, sieht vor, dass im Jahr 2030 zwei Drittel aller Leute einen tertiären Bildungsabschluss haben.
Zimmerli: Was natürlich nicht heisst, dass zwei Drittel aller jungen Menschen in der Schweiz ein Universitätsstudium absolvieren werden. Zu den «Tertiärabschlüssen» gehören bekanntlich auch jene, die wir als «Tertiär B» bezeichnen: Diplome von Berufsfachschulen, Fachhochschulen und beruflichen Meisterprüfungen. Von dem vorhergesagten Zweidrittelziel sind wir heute rund 10 Prozent entfernt, und ich lege meine Hand ins Feuer, dass wir es bis 2030 erreichen werden.
Und woher sollen die fehlenden 10 Prozent kommen? Aus den Gymnasien?
Zimmerli: Zum Teil ja – Tendenz zunehmend.
Angenommen, wir hätten in den nächsten Jahren tatsächlich merklich mehr Gymnasiasten: Wie ist dann die schon heute von manchen
Universitäten beklagte Qualität dieser Schulen zu gewährleisten?
Zimmerli: Die beiden Systeme «Gymnasium» und «Hochschule» passen zurzeit nicht gut aufeinander. Das heisst: der Übergang zwischen ihnen ist nicht sinnvoll geregelt. Heute definiert zum überwiegenden Teil die abgebende Einrichtung – das Gymnasium –, wer weitergehen darf. Das ist nicht zielführend; in keinem anderen Gebiet funktioniert das so. Wie alle anderen Einrichtungen sollen auch die Hochschulen selber entscheiden können, wer bei ihnen studiert.
Der prüfungsfreie Zugang zur Hochschule ist – wie das duale System – ein Spezifikum der Schweizer Bildungslandschaft. Ist es Zeit, es zu verabschieden, Herr Binswanger?
Binswanger: Nein. Wir kommen damit zurück zur Elitedebatte: Die Universitäten sollen nicht selber entscheiden können, wer bei ihnen studiert – tun sie es, landen wir in einem System von Eliteuniversitäten, die sich vorbehalten, die Besten auszuwählen. Herrn Zimmerlis Darstellung zufolge müssten wir heute in der Schweiz ein schlechtes System haben. Ich bin da anderer Meinung. Wir leiden auf sehr hohem Niveau und haben insgesamt ein sehr gutes Bildungssystem, das sich über lange Zeit bewährt und an neue Bedingungen angepasst hat.
Zimmerli: Kein System ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte.
Binswanger: Es lohnt sich nicht, ein bewährtes System aufgrund von Erfahrungen anderer Systeme zu verändern, wenn die Erfahrungen anderer Bildungssysteme unter dem Strich nicht besser sind.
Zimmerli: Es gibt für alle Systeme nur eine wirkliche Gefahr: wenn sie so sehr von sich selbst überzeugt sind, dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln. Der Erfolg von gestern ist der Feind des Erfolges von morgen.
Binswanger: Sie sorgen ja höchstpersönlich dafür, dass wir uns weiterentwickeln!
Zimmerli: Das hoffe ich sehr! Sogar unsere Selbstkritik müssen wir aus dem Ausland importieren (lacht), und ich bin bereit, dabei auch weiterhin mitzuhelfen.
Einer Ihrer Kritikpunkte ist der frühe Zeitpunkt, an dem Jugendliche ihre Bildungsentscheide treffen müssen. Was ist besser daran,
die Entscheidungen hinauszuschieben, anstatt früh auf seine jeweiligen Stärken zu setzen?
Zimmerli: Lassen Sie mich das Problem mit einem persönlichen Beispiel illustrieren: Meine Frau und ich haben vier Kinder, und es wäre fatal gewesen, diese mit 11 oder 12 Jahren dem Gewaltstress auszusetzen, den die Frage bedeutet: Darf ich aufs Gymnasium oder nicht? Meine Kinder haben alle eine relativ stressfreie Schulzeit gehabt und in Deutschland Abitur gemacht. Zwei von ihnen sind heute in Deutschland und zwei in der Schweiz. Die hätten die Aufnahmeprüfung fürs Schweizer Gymnasium wohl nur um den Preis von grossem Stress geschafft. Sie waren in diesem Alter einfach noch nicht so weit. Der jetzige Selektionsmechanismus setzt entwicklungspsychologisch an der falschen Stelle an. Ich bin deshalb ein überzeugter Kritiker einer Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium. Denn niemand kann mit einer Momentaufnahme sagen, wie sich ein in der Vorpubertät steckender Jugendlicher weiterentwickelt.
Binswanger: Stress entsteht in einem Bildungssystem ohnehin irgendwo. Als negatives Beispiel dient Japan, wo für den Universitätszutritt ein Test nötig ist, für den man sich Jahre vorbereiten muss. Verglichen damit haben wir in unserem System keinen extremen Stress. Und sofern man die Lehre als gleichwertige Alternative sieht, ist es auch keine Katastrophe, wenn man an der gymnasialen Hürde scheitert.
Herr Zimmerli, wenn Sie ein eigenes Gymnasium leiten würden, wie stellten Sie ohne Aufnahmeprüfung sicher, dass Sie gute Schüler anziehen und danach studierfähig auf den weiteren Bildungsweg schicken können?
Zimmerli: Sinn machen würde z.B. Probeunterricht zu einem Zeitpunkt, da der Grossteil der sekundären Schulbildung abgeschlossen ist. Vorher sollen die Schüler relativ locker begleitet werden. Das heisst: man soll sieben, wo gesiebt werden kann und muss. Aber nicht dort, wo fast zwangsläufig falsche Ergebnisse resultieren. Das heisst: ich plädiere für ein relativ offenes System bis zum Abschluss einer verkürzten sekundären Stufe und eine anschliessende spezifische Selektion für die weitere Ausbildung – gleichgültig, ob handwerklich oder intellektuell.
Sie meinen: jene Jungen, die nach Abschluss des «offenen Systems» merken, dass sie nicht an die Uni wollen oder können, absolvieren dann mit 18 noch eine Lehre?
Zimmerli: Im Prinzip ja, obwohl der Ausdruck «Lehre» dann nicht mehr ganz passt. So läuft es ja in all den vielen anderen Ländern, die das duale Bildungssystem nicht kennen. Finnland etwa ist ein gutes Beispiel: Dort besuchen alle bis 16 oder 17 die Schule – aber keineswegs absolvieren danach alle ein Studium, sondern viele ergreifen nichtakademische Berufe.
Herr Binswanger, was spricht denn dagegen, die Entscheidung zu vertagen und allen jungen Menschen zunächst «gesellschaftliche Reife» zu vermitteln?
Binswanger: Dagegen spricht, dass sehr viel Zeit mit Herumsitzen im Schulzimmer vertan würde. Man darf den Schulalltag nicht idealisieren. Ein grosser Teil des Unterrichts wird unproduktiv abgesessen, und viele Leute würden lieber etwas anderes machen, das sie wahrscheinlich auch besser könnten. Wir bilden schon heute viele Leute in eine Richtung aus, die ihnen nicht unbedingt viel nützt. Sie sind dann zwar auf ein Hochschulstudium vorbereitet, aber nicht für eine praktische Tätigkeit ausgebildet.
Der naheliegende Schluss ist jener, dass dadurch Arbeitslosigkeit produziert wird, und tatsächlich haben Länder mit hohen Akademikerquoten, wie etwa Spanien, auch hohe Arbeitslosenzahlen – und Kantone mit hohen Maturaquoten, etwa das Tessin, ebenso…
Binswanger: Natürlich! Die Jugendarbeitslosigkeit hängt mit der Maturitätsquote zusammen.
Zimmerli: Das ist nicht nur empirisch, sondern auch methodologisch falsch. Die Korrelation, die Sie herstellen, existiert zwar, aber sie hat keine kausale Bedeutung. Die Jugendarbeitslosigkeit muss immer mit der allgemeinen Arbeitslosigkeit sowie mit den ökonomischen Bedingungen eines Landes oder einer Region verglichen werden. Die Jugendarbeitslosigkeit kann in Spanien nicht niedriger sein als die allgemeine Arbeitslosigkeit.
Binswanger: Das stimmt. Aber in einem Land wie Finnland ist die generelle Arbeitslosigkeit tief und die Jugendarbeitslosigkeit einiges höher.
Zimmerli: Das ist beispielsweise auch eine Frage der dort vorhandenen Industrien. Darüber hinaus gibt es eine international stark diskutierte Studie, die zeigt, dass die Arbeitslosigkeit über den ganzen Lebenszyklus gesehen im dualen System nach einer Berufsausbildung relativ höher ist als nach dem akademischen Weg. Dieser Befund wird von den Befürwortern des dualen Systems natürlich nur selten zitiert.
Binswanger: Warum ist denn aber die Gesamtarbeitslosigkeit in der Schweiz so tief? Vielleicht hängt gerade dies ja mit unserem Bildungssystem zusammen. Ihr Beispiel der beiden Berufsweltmeister zeigt ja: wer eine duale Ausbildung absolviert, hat danach die Chance, an der ETH zu studieren. Das duale System kann also so schlecht nicht sein.
Zimmerli: Das Beispiel zeigt, dass das Anreizsystem im Bildungsmarkt funktioniert und nicht planwirtschaftlich gestört werden sollte: Die Jungen gehen dorthin, wo gute Verdienst- und Karrieremöglichkeiten winken. Ich sage damit nicht, dass das duale System verabschiedet werden soll. Ich meine nur, dass wir es nicht verbessern, indem wir sagen, dass früher die Aufstiegsmöglichkeiten mit einer Lehre besser waren als heute. Und erst recht nicht, indem wir nun den Fehler bei einer zu hohen Maturaquote suchen.
Binswanger: So oder so: die Durchlässigkeit muss erhalten werden.
Die Durchlässigkeit ist also der gemeinsame Nenner, auf den wir Sie am Schluss doch bringen?
Zimmerli: Genau. Wir sind allerdings uneins in der entscheidenden Frage: ob es sinnvoller ist, zuerst Mauern einzuziehen, um diese später wieder einzureissen, oder ein System zu bauen, das von Beginn an keine Mauern setzt. Gibt es ein real existierendes System, das perfekt ist? Natürlich nicht. Es ist daher durchaus nicht verboten, sondern dringend zu empfehlen, ins Ausland zu schauen und die guten Elemente zu kopieren. Sich nicht weiterentwickeln zu wollen, ist immer die schlechteste Option.
Binswanger: Das duale Bildungssystem ist ein wesentlicher Bestandteil der Schweiz. Es ist gefährlich, solche Errungenschaften aufs Spiel zu setzen, nur weil man bei bestimmten international gemessenen Indikatoren, etwa der Anzahl Maturanden oder Studenten, nicht gut dasteht. Es bringt nichts, Dinge zu übernehmen, die sich anderswo schon nicht mehr bewähren. Wir haben in der Schweiz eine eigenartige Diskrepanz: Wir sind unheimlich stolz auf unser System mit demokratischen Mitspracherechten und tiefer Arbeitslosigkeit. Und gleichzeitig haben wir panische Angst, durch das Festhalten an Funktionierendem den internationalen Anschluss zu verpassen. Überheblichkeit auf der einen und vorauseilender Gehorsam auf der anderen Seite – dieser Schizophrenie sollten wir entkommen und auf keinen Fall das duale Bildungssystem einer unüberlegten Akademisierung opfern.