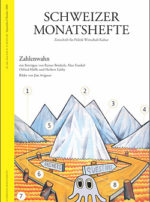Nacht des Monats mit Giwi Margwelaschwili
Ukazravat, Batoni Giwi minda, Ukazravat, Batoni Giwi minda, murmle ich vor mich hin und wünschte, jemand würde meinen Lebenstext umschreiben. Seit je habe ich eine Abscheu davor, wildfremde Leute anzurufen, sitze berufsbedingt doch immer wieder bibbernd vor Hörern und soll nun auch noch Georgisch in einen solchen reinplappern – Ukazravat, Batoni Giwi minda, Ukazravat, … jalla jetzt endlich! Und «Hallo?», letztendlich! Deutsch! Anders als vom Verleger vermutet, geht nicht die georgischsprachige Haushaltshilfe, sondern Giwi Margwelaschwili selbst ans Telephon und lädt mich mit unüberhörbar berlinischem Akzent ein, ihn anderntags in Tbilisi zu besuchen.
Draussen ist es noch hell, als ich am frühen Abend eines milden Frühherbsttages durch das Universitätsquartier gehe, den telephonisch erhaltenen Weisungen folge und beim Literaturuli-Buchcafé, leise über die köstliche Sprache kichernd, links in eine vielteilige Blocksiedlung abbiege. Sowie ich aber im Erdgeschoss in die Zweizimmerwohnung trete, stoppt der Lauf der Zeit: Heruntergelassene Storen verdunkeln den Wohnraum, Überbleibsel oder Pionierstücke einer Weihnachtsdekoration stellen das saisonale Gefüge in Frage, und aus dem riesigen Büchergestell, in dem Philosophen und Literaten sichtbar zerlesen Rücken an Rücken stehen, dringt der Geist der Zeitlosigkeit. Ob ich schon gegessen habe, will Margwelaschwili wissen, kaum dass mich seine Haushälterin zu ihm geführt hat. Ich habe keine Ahnung, auf welche Mahlzeit diese Frage um 17 Uhr abzielt, meine Antwort ist aber sowieso ohne jeden Belang: Margwelaschwili mag Deutscher sein und Berlinisch sprechen, im Umgang mit Gästen ist er ganz Georgier, und folglich kehren wir erst eine Dreiviertelstunde und etliche Feigenhälften und Kuchenstücke später aus der kleinen Küche zurück in die Stube, wo sich der schlohweisse Mann zum Gespräch zurechtsetzt.
Ich hatte Giwi Margwelaschwili treffen wollen, weil mich kaum ein Literatenleben stärker fasziniert als das seine, in dem sich die Buchstaben zu einem Fluchtmittel aus den ideologischen Kerkern des 20. Jahrhunderts geballt haben. 1927 in Berlin geboren, befand sich Margwelaschwili ein Leben lang in der – zumindest inneren – Emigration. Sein Vater, der als Christdemokrat am Aufbau der Ersten Georgischen Republik beteiligt gewesen war, musste fliehen, als die Russen das nationale Projekt ihres Nachbarländchens 1921 mit der Roten Armee beendeten. Der Weg nach Deutschland freilich war einer vom Regen in die Traufe – den sein Sohn später in umgekehrter Richtung nochmals gehen sollte: Nach Kriegsende wurde der Vater vom sowjetischen Geheimdienst ermordet und Giwi zunächst in Sachsenhausen interniert und dann nach Tbilisi verbracht. Aufgewachsen unter der «ganzen Marschiererei» der Hitlerzeit, hatte er sich so ab 1947 in den Engnissen des Sowjetregimes einzurichten. «Ich war der Meinung, mein wertes Fräulein, ich würde das nicht überleben können. Aber dann, guck an, war sie auf einmal weg, die Sowjetunion. Man muss Geduld haben.»
Geduld aber ist weder Resignation noch Stagnation. In den Jahrzehnten des genormten Lebens und Denkens machte Margwelaschwili die deutsche Sprache zum Element, in dem er sich frei bewegte, und seine Texte zu Welten, in denen keine Zwänge galten. Scheinbar Fest- und Vorgesetztes schrieb er um – etwa rettete er in Bethlehem die neugeborenen Knaben vor dem Kindermord, mit dem Herodes ihnen im Matthäusevangelium zu Leibe gerückt war –, versetzte Figuren aus anderen Büchern in angenehmere Geschichten und verhalf etlichen Buchstabenmenschen zu Freiheit: «Die Buchpersonen, verstehst du, meine Liebe, sind alle thematisch gefesselt, und immer dreht es sich darum, sie dahin zu bringen, wo sie ihre Fesseln abstreifen können.» Das liebe Fräulein meint einiges zu verstehen, anderes bloss zu erahnen – an der Rezeptionsästhetik, die der Philosoph in und über seine Schriften entwickelt hat, beisst es sich schreibend schon wieder die Zähne aus –, und sicher weiss es nur, dass es nicht weiss, wie spät es ist, als die Kapazitätsgrenzen seines Aufnahmegeräts wie seines Kopfs erreicht sind. Daran, dass mein Magen noch einiges zu fassen vermag, hat der Gastgeber indes nicht den geringsten Zweifel, und erst nach einer weiteren Früchteplatte kann ich mich also verabschieden: Madloba, Giwi, didi madloba.