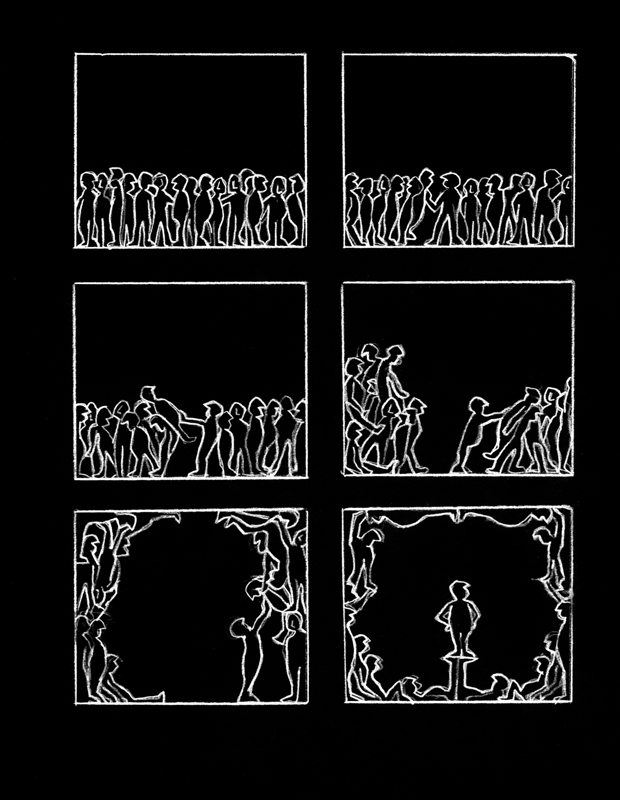Ach, Europa
Euro- und Flüchtlingskrise haben das politische Klima in der EU vergiftet. Wie hängen beide zusammen? Und welche Rolle spielt dabei Deutschland?

Wie kommt die Währungsunion wieder aus der Krise? Jeder Umbau muss mit der Erkenntnis beginnen, dass Haftung und Kontrolle zusammengehören. Es muss wieder das marktwirtschaftliche Prinzip gelten, das der Ökonom Walter Eucken mit den Worten auf den Punkt brachte: «Wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen.» Wer dieser Prämisse folgt, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten.
Die erste wird unter dem Stichwort Fiskalunion diskutiert und zielt auf eine gemeinsame Wirtschaftsregierung und eine Fiskalpolitik für den gesamten Euroraum ab. Die zweite kann man als atmende Währungsunion bezeichnen, die auf Eigenverantwortung und Subsidiarität setzt und in der das Ausscheiden aus dem Euro möglich ist und auch der Wiedereintritt. Frankreich, Italien und die EU-Kommission tendieren zu noch mehr Zentralisierung. Die Haltung Roms und Paris’ ist allerdings nicht konsistent, denn die Abgabe von wirtschaftspolitischer Souveränität nach Brüssel lehnen beide Länder ab. Ausserhalb Berlins will kaum jemand die politische Union. Kein Wunder, denn eine wachsende Mehrheit der Bürger sieht das Elitenprojekt EU kritisch. Das mag man bedauern, aber das kann man nicht ignorieren. Weil die Regierungen der Mitgliedsländer wiedergewählt werden wollen, können sie den Kern ihrer nationalen Souveränität nicht abgeben, sich in der Finanz- und Steuerpolitik also nicht entmachten. Solange nur Deutschland bereit ist, den EU-Vertrag zu ändern, bleibt die Fiskalunion ein Hirngespinst.
Die zweite Option ist die Rückkehr zur Eigenverantwortung und zu Dezentralisierung. Wenn die Balance von Haftung und Kontrolle wieder gelten soll, dürfen Staaten nicht mehr für die Schulden anderer Mitglieder einstehen. In der Krise passierte das Gegenteil. Indem die Eurogruppe die Zinsen drastisch gesenkt und die Kreditlaufzeiten extrem verlängert hat, verschwimmt die Grenze zur Transferunion. Kredite und Haftung wurden sozialisiert, indem die EZB Zombiebanken am Leben erhielt und Staaten finanzierte. Statt auf die Kontrolle der Märkte zu vertrauen, gibt es einen politischen Nullzins und den Euro-Rettungsfonds, der den «Moral Hazard» institutionalisiert und das Investorenrisiko auf den Steuerzahler abwälzt. Ein Zurück zur Nichtbeistandsklausel von Maastricht ist nur dann glaubhaft, wenn eine Staatsinsolvenz nicht nur ein fiktives Szenario ist. Schuldner und Gläubiger haben sich daran gewöhnt, dass Krisenstaaten «gerettet» werden. Sie werden erst dann wieder an die Gültigkeit des Beistandsverbots und des Verbots der monetären Staatsfinanzierung glauben, wenn es ein Insolvenzverfahren für Staaten gibt und in der Währungsunion ein Verfahren, das den Austritt aus dem Euro möglich macht.
Nehmen wir die Vereinigten Staaten als Beispiel: Dort machte 1790 der amerikanische Finanzminister Hamilton die Schulden der Bundesstaaten, die aus der Revolutionszeit stammten, zu Bundesschulden. Er sah in der Sozialisierung der Schulden einen «wirkungsvollen Zement» für die Union. In der Erwartung, auch künftige Schulden in Washington abladen zu können, wurde daraufhin eine muntere Kreditpolitik betrieben, die erst zum Boom, dann zur Blase, danach in die tiefe Depression und anschliessend zum amerikanischen Bürgerkrieg führte.
Amerika ist ein Lehrstück für Europa, wie Hans-Werner Sinn in seinem neusten Buch «Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel» begründet. Beim Riss durch den alten Kontinent geht es nicht nur um hohe Staatsschulden und hektisch geschnürte Rettungspakete, sondern auch um die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer. Damit ihre Wirtschaft wieder Tritt fassen kann, müssten dort Löhne und Preise im Vergleich zu den übrigen Euroländern sinken. Das ist leider nur in Ansätzen geschehen. Griechenland hat real um etwa 5 Prozent abgewertet, notwendig sind aber wohl 30 Prozent. Stattdessen hat man zwei Rettungspakete geschnürt über 344 Milliarden Euro oder 31 000 Euro für jeden Griechen und ein drittes Rettungspaket über 86 Milliarden Euro noch dazu. Doch die Kräfte, die normalerweise in Krisenzeiten schmerzhafte Strukturreformen erzwingen, hat die Eurozone abgeschafft – und wundert sich nun darüber, dass die Krise weiterschwelt. Obwohl die bisherigen Sparprogramme als untragbar empfunden werden, haben sie nur in Ansätzen zu einer Senkung der Preise geführt, wie Sinn vorrechnet. Natürlich muss man die nominalen Löhne ins Verhältnis zur Produktivität setzen. Doch auch dann ist Griechenland noch zu teuer.
Eine reale Abwertung oder Deflation im Ausmass, wie es Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik erlebt hat, würde die Gesellschaft zerreissen. Das ist keine Lösung, das will auch niemand. Die von der EZB angestrebte Alternative, die Inflationierung Nordeuropas, funktioniert aber auch nicht. Erstens lautet der Auftrag der EZB: stabile Preise. Zweitens lehnt Deutschland eine hohe Inflation ab. Drittens ist es gar nicht so leicht, Inflation zu erzeugen, wie man in Japan sieht. Was also tun, wenn die EZB in Kerneuropa die Inflation nicht anfachen kann und die Deflation im Süden Grenzen hat? Dann bleiben als Handlungsoptionen nur noch die Alimentierung oder der Austritt aus der Währungsunion. Im Süden ist schon heute die Unzufriedenheit über die Arbeitslosigkeit gross und im Norden breitet sich Rettungsmüdigkeit aus. Eine echte Transferunion würde auf Dauer den Norden überfordern und langfristig die Strukturen im Süden zementieren. Der Stillstand in Süditalien und in Ostdeutschland sollte Warnung genug sein. Wenn die Währungsunion weitermacht wie bisher, werden die starken Staaten noch stärker und die Schwachen noch schwächer. In Deutschland profitiert die wettbewerbsfähige Industrie von der ultralockeren Geldpolitik der EZB, es herrscht praktisch Vollbeschäftigung, die Steuereinnahmen sprudeln wie nie zuvor, die Reallöhne steigen wieder kräftig, während den Krisenländern die Möglichkeit genommen ist, mit einer Abwertung der eigenen Währung wieder wettbewerbsfähiger zu werden.
Bleibt als letzter und gangbarer Weg der Austritt mit einer Abwertung der neuen Währung, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit ohne Aufstand der Bevölkerung wiederhergestellt werden könnte. Ein Grexit wurde zwar in letzter Sekunde politisch verhindert. Doch die Eurokrise ist noch nicht vorbei. Möglicherweise lehnt ein anderes Land Dauertransfers ab und wählt die Wiederherstellung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Sollte ein Land den schwierigen Austritt wagen, müsste die Gemeinschaft ihm dabei helfen, die sozialen Lasten zu tragen, die Banken mit frischem Kapital auszustatten und einen Teil der Schulden zu streichen. Eine Eurozone mit einer Konkursordnung, die einen Schuldenschnitt und einen temporären Austritt sowie einen späteren Wiedereintritt vorsieht, sei das Gebot der Stunde, lautet Sinns Fazit. Nur so hätten die Krisenländer eine Chance auf wirtschaftliche Gesundung, nur so könnte die Eurozone als Ganzes ihre chronische Zahlungsbilanzkrise überwinden.
Doch bis es so weit ist, wird der Unmut über die EU und die Währungsunion weiter wachsen. Im Süden haben radikale Linksparteien Zulauf, im Norden und Osten legen Rechtsextreme oder Nationalkonservative zu. Die Ursache für die steigenden europäischen Spannungen ist der Konflikt zwischen politischen Wünschen und ökonomischer Wirklichkeit. Seit der Weltfinanzkrise, die in Amerika ihren Ursprung und in der Insolvenz der Lehman Bank ihren Höhepunkt hatte, gilt das Primat der Politik. Nachdem reihenweise Regierungen die Banken retten mussten, herrscht in den Staatskanzleien der Irrglaube vor, die Politik herrsche dauerhaft über ökonomische Gesetze. Statt zu den Haftungsregeln der Marktwirtschaft zurückzukehren, setzen die EZB und die Euroretter ihre Politik der weichen Budgetbeschränkungen fort. So verhinderten sie einen Systemzusammenbruch, schoben aber auch die Strukturreformen in den Krisenländern auf. Die Folge ist eine hartnäckige Stagnation.
Nur auf den ersten Blick hat die Eurokrise nichts mit der Flüchtlingskrise zu tun. Der zweite Blick offenbart Parallelen. In beiden Fällen haben die Europäer nur den angenehmen Teil des Vertrags gelesen und die Nebenbedingungen übersehen. Beim Maastrichter Vertrag haben die Krisenländer das grösste Geschenk des Euros, die ungewohnt niedrigen Zinsen, gern genommen. Die Vorteile der günstigen Zinsen wurden leider nicht genutzt, um die Schulden- und Defizitregeln zu erfüllen, sondern um neue Kredite aufzunehmen. Ähnlich verhält es sich mit dem Wegfall der Binnengrenzen. Den Vertrag von Schengen feierten alle mit dem Abbau der Grenzbäume. Die damit verbundene Pflicht, die Aussengrenzen der EU besser zu schützen, kümmerte keinen. In beiden Fällen folgte der einseitigen Auslegung der EU-Verträge die Krise. Die Dimensionen von Eurokrise und Flüchtlingskrise sind gewaltig. In Deutschland weiss niemand, wie viele Flüchtlinge im vergangenen Jahr gekommen sind. Der Kontrollverlust der Bundesregierung trägt dazu bei, dass Berlin mit der Forderung nach Solidarität in der EU auf Granit beisst. Offenbar ist der Risikoschutz, den die Eurokrisenländer beim Geld beanspruchen, eine Einbahnstrasse. Die Union, die als Versicherung auf Gegenseitigkeit angelegt war, funktioniert nur beim Geld.
In der Eurokrise liefen die Fäden im Bundeskanzleramt zusammen. Nichts ging ohne Angela Merkel. Doch in der Flüchtlingskrise ist es einsam um sie geworden. Sie hat sich im Kreis der Regierungschefs isoliert, nur auf den österreichischen Bundeskanzler kann sie noch zählen. Während in Deutschland der Frust über die mangelnde Solidarität in Europa steigt, verzweifeln die Nachbarländer über Berlin. In Frankreich glauben nicht nur die Sozialisten, dass von der deutschen Willkommenskultur der Front National profitiert. Vier von fünf Franzosen lehnen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge ab. Frankreichs Premier Manuel Vals setzte sich mit folgenden Worten von Merkel ab: Europa «kann nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen – das ist unmöglich». Selbst auf einstige Verbündete kann sich die Kanzlerin nicht mehr verlassen. «Wenn wir Regeln haben, dann müssen wir sie auch einhalten», sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Das gelte auch für das Dublin-Verfahren, das die Rückführung von Flüchtlingen in das EU-Land vorsieht, über das sie eingereist sind. In Berlin fühlt man sich zu Unrecht ermahnt. Aber die anderen Hauptstädte Europas haben eine ganz andere Perspektive. Danach hat Angela Merkel durch ihre Willkommenskultur ein ohnehin riesiges Problem unbeherrschbar gemacht. Das belegt ein Zitat der neuen polnischen Regierungschefin Beata Szydlo: Es sei keine Solidarität, wenn «bestimmte Staaten» – sprich Deutschland – versuchten, Probleme zu exportieren, die sie «ohne Beteiligung anderer geschaffen haben». Und die pragmatischen und im Umgang mit Migranten erfahrenen Briten stellen klar: Das Problem lässt sich nicht mit unendlicher Grosszügigkeit lösen.
Sogar die humanitäre Grossmacht Schweden hat jetzt die Notbremse gezogen, nachdem sich die Flüchtlingszahlen verdoppelt hatten. «Es gibt eine Grenze, wir haben sie erreicht», sagte Stefan Löfven, der schwedische Ministerpräsident. Jetzt gibt es in Schweden wieder Passkontrollen an den Grenzen, in Bahnen, Bussen und Fähren. Zuvor hatte bereits Dänemark seine Leistungen für Migranten halbiert und die Grenzen dichtgemacht. Mit Gesinnungsethik wird Angela Merkel die Flüchtlingskrise nicht meistern. Deutschland und die EU müssen wieder die Kontrolle über die Grenzen bekommen. Nach den Worten der Kanzlerin kann Deutschland seine 3000 Kilometer Landgrenze nicht mehr sichern. Aber wie soll das in der EU gehen mit einer Aussengrenze von mehr als 14 000 Kilometern?1 Der Kontrollverlust ist keinesfalls so alternativlos, wie die Kanzlerin glauben machen will. Es gibt viele Grenzzäune in der Welt, etwa zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko oder in den Enklaven von Spanien in Afrika, wo ebenfalls die Menschenrechte gelten.
Ungeachtet der sinkenden Zustimmungswerte zu ihrer Politik und trotz des wachsenden Widerstands in ihrer eigenen Partei will Angela Merkel nicht auf die Bremse treten. Dabei ist die anfängliche Gelassenheit der Bevölkerung in tiefe Besorgnis umgeschlagen. Zwei von drei Bürgern gehen davon aus, dass die Flüchtlingswelle Deutschland stark verändern wird, ebenso viele befürchten, dass Terroristen in der Welle mitschwimmen. Dennoch weigert sich die Kanzlerin, ein persönliches Signal zur Begrenzung des Zustroms zu senden. Von ihr kommt nur das Mantra «Wir schaffen das» – in allen Variationen. Sie tut so, als habe Berlin mit der Abschaffung des Dubliner Rechtsrahmens für Migranten, den Flüchtlingsselfies mit der Kanzlerin, der politisch korrekten Begeisterung über die Willkommenskultur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu tun. Solange Angela Merkel ihren Anteil an der Krise leugnet (nach dem Motto: Das ist mir egal, die sind nun mal da), steuert Berlin nur widerwillig gegen.
Weil das so ist, lassen die europäischen Partner die Kanzlerin auflaufen mit ihrem Wunsch nach Kontingenten, die direkt aus Flüchtlingslagern geholt und in Europa verteilt werden sollen. Auf die vielen Gründe für die Flüchtlingskrise muss mit einem Bündel von Massnahmen geantwortet werden, die wohl allesamt nur niedrig dosiert werden können, aber zusammen dennoch Wirkung zeigen dürften: bessere Grenzsicherung, geringere ökonomische Anreize zur Einwanderung und regionale Stabilisierung vor Ort. Wenn wir wissen, was wir schaffen wollen, können wir uns der Daueraufgabe Integration widmen. Entscheidend wird sein, wie gut wir Migranten ausbilden, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Integration ist mehr als die Anerkennung unserer freiheitlichen, gleichberechtigten Werteordnung. Auch Anpassungsbereitschaft darf verlangt werden, nicht zuletzt an unsere Arbeits- und Leistungsgesellschaft.
Der Umgang mit der Flüchtlingswelle entlarvt eine europapolitische Lebenslüge Deutschlands.2 Bislang behauptete Berlin stets, seine Europapolitik richte sich an den Interessen der Europäischen Union aus. Deshalb ist die Einsamkeit von Angela Merkel in Europa mehr als Isolation, sie ist eine Zäsur. In der Eurokrise hat sich die Bundeskanzlerin daran gewöhnt, ihren Willen in Europa weitgehend durchsetzen zu können. In der Flüchtlingskrise verweigern ihr die europäischen Partner nun die Gefolgschaft. Ist der Alleingang von Deutschland ein Vorbote einer neuen Europapolitik Berlins? Glaubt das Kanzleramt wirklich, die Kontingente gegen den Rest Europas durchdrücken zu können? Oder handelt es sich bei der Öffnung der Grenzen durch Deutschland ohne Rücksprache mit den Partnern nur um eine Ausnahme von der Regel? Dann wäre der Ruf nach europäischen Quoten keine Strategie, sondern ein Ausdruck der Verzweiflung. Wäre das so, dürfte dem Kanzleramt eine Korrektur der Politik nicht so schwer fallen. Aber vielleicht hat sich Angela Merkel in der Eurokrise so sehr an ihre Führungsrolle in Europa gewöhnt, dass sie Gefallen daran gefunden hat. Doch selbst dann sollte Berlin zu einer berechenbaren, mit den Partnern abgestimmte Europapolitik zurückkehren. Denn auch in Europa gilt: Führung muss immer wieder aufs neue begründet werden.
1 Europa als Staatengemeinschaft wollte ein offener Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts werden, in dem Binnengrenzen ihre Bedeutung verlieren. Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio, der Deutschlands Risikobereitschaft im Gegensatz zu anderen Staaten der EU lobt, erklärt dieses Ziel in der EU der sechs Gründungsmitglieder als kein sonderliches Problem. Ob aber dieser Gedanke auch noch in der heutigen Union mit 28 Staaten mit ihren sehr heterogenen gesellschaftlichen Bedingungen und Mentalitäten trage, fragt Di Fabio und warnt: «Ein offener Staat, der die Disposition über seine Grenzen aufgibt, mag offen sein, wird aber kein Staat bleiben können.»
2 Ein Zitat des Historikers Heinrich August Winkler unterstreicht dies in bezug auf Deutschland besonders: «Zur deutschen Verantwortung gehört, dass wir uns von der moralischen Selbstüberschätzung verabschieden, die vor allem sich besonders fortschrittlich dünkende Deutsche aller Welt vor Augen geführt haben. Der Glaube, wir seien berufen, gegebenenfalls auch im Alleingang, weltweit das Gute zu verwirklichen, ist ein Irrglaube. Er darf nicht zu unserer Lebenslüge werden.»